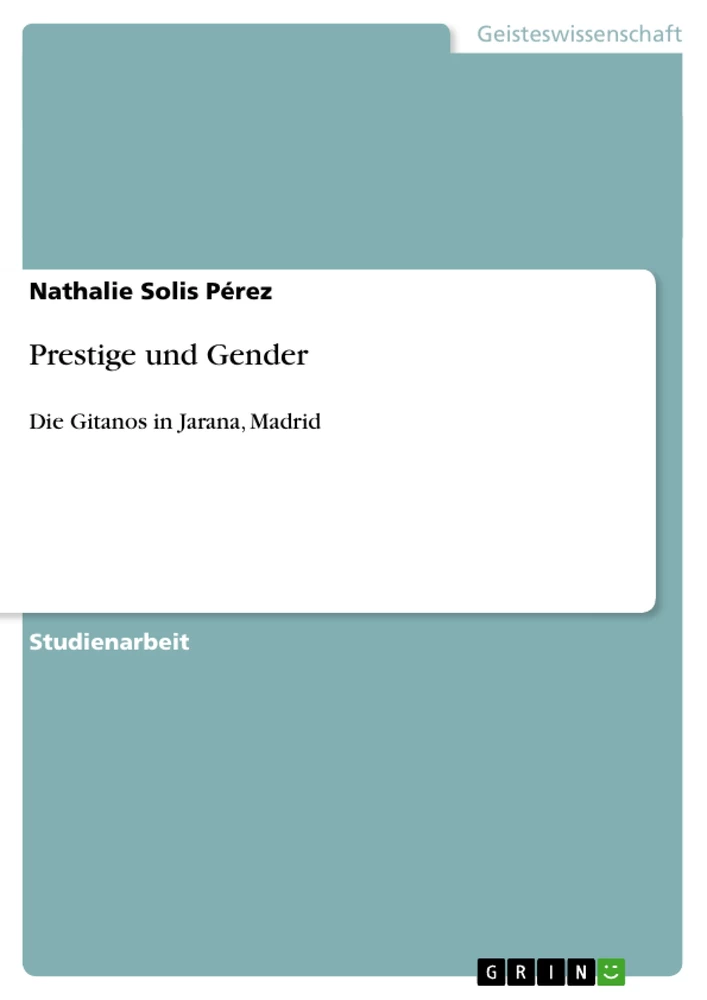Unter dem Begriff Gender versteht man ganz allgemein das kulturell bzw. gesellschaftlich konstruierte Geschlecht (gender), welches in jeder Kultur und Gesellschaft sehr unterschiedlich aussehen kann. Dieser Begriff wird insbesondere im Kontrast zum biologischen, natürlichen Geschlecht eines Menschen (sex) verwendet. Gender ist somit nicht etwas Natur gegebenes oder eine natürliche Kraft, sondern eine kulturelle Konstruktion, die durch ständige Wiederholung und eine Einbettung z.B. in kosmologische oder religiöse Kontexte immer wieder (re)produziert wird, damit sie den Mitgliedern der Gesellschaft verbindliche Rollenbilder vermittelt bzw. Grenzen und Tabus moralischen Verhaltens aufzeigt. Jedoch sind Geschlechterrollen, Körperbilder und Identitätsdiskurse stets Einflüssen von außen ausgeliefert und können sich wie alle Kulturelemente im Laufe der Zeit auch verändern, im Falle der Gitanos in Madrid geschieht dies vor allem auch in der Reibung und Auseinandersetzung mit den Moraldiskursen und Wertesystemen der spanischen Mehrheitsgesellschaft. In der Ethnologie haben die Gender Studies bisher nur eine sehr marginale Position eingenommen, sie werden unter anderem eher den Ethnologinnen zugeschrieben:
„[…] die ethnologischen Gender Studies [sind] innerhalb der Disziplin marginal geblieben, aus ihnen [ist] keine ‚große Theorie’ hervorgegangen. Auch stellen sie, v. a. im deutschsprachigen Raum, immer noch ein nahezu ausschließlich "weibliches Terrain" dar, […]ihre Institutionalisierung [ist] bislang nicht gelungen. „
Paloma Gay-Y-Blasco widmet sich als eine der wenigen Ethnologinnen dem Bereich Zigeuner und Gender. In dieser Arbeit soll vor allem auf ihren Aufsatz „A Different Body? Desire and Virginity among Gitanos” eingegangen werden, der 1997 erschien im Journal of the Royal Anthropological Institute. Anhand der Gitanos in Jarana, Madrid, lässt sich eine Kontrastkultur erkennen, die ihre Geschlechterrollen so konzipiert, dass sie in starker Opposition stehen zu den Werten und dem Verständnis in der Mehrheitsgesellschaft. Diese beiden Diskurse stehen sich in einer komplementären Opposition gegenüber, einerseits negieren sie sich gegenseitig, andererseits bedingen sie aber auch einander und benötigen sich um die eigenen Selbstbilder entlang der Grenzen des jeweils Anderen zu entwerfen. In diesem Aufsatz soll dabei vor allem die Rolle und das Bild der Frau besprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Gender Diskurse bei den Gitanos in Jarana, Madrid, nach Gay-Y-Blasco
3 Zusammenfassung:
4 Bibliographie
4.1 Primärliteratur:
4.2 Sekundärliteratur:
4.3 Internetquellen:
1 Einleitung
Unter dem Begriff Gender versteht man ganz allgemein das kulturell bzw. gesellschaftlich konstruierte Geschlecht (gender), welches in jeder Kultur und Gesellschaft sehr unterschiedlich aussehen kann. Dieser Begriff wird insbesondere im Kontrast zum biologischen, natürlichen Geschlecht eines Menschen (sex) verwendet. Gender ist somit nicht etwas Natur gegebenes oder eine natürliche Kraft, sondern eine kulturelle Konstruktion, die durch ständige Wiederholung und eine Einbettung z.B. in kosmologische oder religiöse Kontexte immer wieder (re)produziert wird, damit sie den Mitgliedern der Gesellschaft verbindliche Rollenbilder vermittelt bzw. Grenzen und Tabus moralischen Verhaltens aufzeigt. Jedoch sind Geschlechterrollen, Körperbilder und Identitätsdiskurse stets Einflüssen von außen ausgeliefert und können sich wie alle Kulturelemente im Laufe der Zeit auch verändern, im Falle der Gitanos in Madrid geschieht dies vor allem auch in der Reibung und Auseinandersetzung mit den Moraldiskursen und Wertesystemen der spanischen Mehrheitsgesellschaft. In der Ethnologie haben die Gender Studies bisher nur eine sehr marginale Position eingenommen, sie werden unter anderem eher den Ethnologinnen zugeschrieben:
„[…] die ethnologischen Gender Studies [sind] innerhalb der Disziplin marginal geblieben, aus ihnen [ist] keine ‚große Theorie’ hervorgegangen. Auch stellen sie, v. a. im deutschsprachigen Raum, immer noch ein nahezu ausschließlich "weibliches Terrain" dar, […]ihre Institutionalisierung [ist] bislang nicht gelungen. „[1]
Untersucht man soziale Hierarchien und Themen wie Status, Prestige und Macht in Zigeuner- Gruppen oder auch bei anderen ethnischen Minderheiten, sind die Geschlechterverhältnisse und –rollen wichtige zu untersuchende Elemente, die in einem dynamischen Verhältnis zu den Diskursen der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft stehen. Paloma Gay-Y-Blasco widmet sich als eine der wenigen Ethnologinnen dem Bereich Zigeuner und Gender. In dieser Arbeit soll vor allem auf ihren Aufsatz „A Different Body? Desire and Virginity among Gitanos” eingegangen werden, der 1997 erschien im Journal of the Royal Anthropological Institute. Anhand der Gitanos in Jarana, Madrid, lässt sich eine Kontrastkultur erkennen, die ihre Geschlechterrollen so konzipiert, dass sie in starker Opposition stehen zu den Werten und dem Verständnis in der Mehrheitsgesellschaft. Diese beiden Diskurse stehen sich in einer komplementären Opposition gegenüber, einerseits negieren sie sich gegenseitig, andererseits bedingen sie aber auch einander und benötigen sich um die eigenen Selbstbilder entlang der Grenzen des jeweils Anderen zu entwerfen. In diesem Aufsatz soll dabei vor allem die Rolle und das Bild der Frau besprochen werden.
2 Hauptteil
2.1 Gender Diskurse bei den Gitanos in Jarana, Madrid, nach Gay-Y-Blasco
Gay-Y-Blasco versteht den Körper zunächst als eine diskursive und nicht als biologisch- physikalische Einheit. Bei den Gitanos in Jarana, einem Viertel im Süden Madrids, erforschte sie ausführlich die Art und Weise wie die Gitanos ihre kulturellen Selbstentwürfe bilden und was für eine Rolle der Frau dabei zukommt. Nach Gay-Y-Blasco konstruieren die Gitanos ihre eigene Identität und etablieren ihre Moraldiskurse besonders im Kontrast zur spanischen Mehrheitsbevölkerung, deren Mitglieder von ihnen als “Payos” bezeichnet werden. Während Gay-Y-Blascos Feldforschung leben in Jarana 65 Gitano- Familien, 9 Payo- Familien und 6 gemischte Familien, insgesamt also etwa 300 Menschen, die in sesshaften Strukturen leben und Spanisch sprechen. Teilweise wurden die Gitanos von der spanischen Regierung mehrmals umgesiedelt bis sie schließlich in besagtem Viertel untergebracht wurden. Die Abgrenzung zu den Payos einerseits und die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern andererseits sind laut Gay-Y-Blasco die zwei wichtigsten und elementarsten Faktoren, welche das Weltbild der Gitanos prägen. Nur im Zusammenhang mit und im Kontrast zur Mehrheitsbevölkerung ergeben die Moraldiskurse der Gitanos einen größeren Sinnzusammenhang. Wie man es auch aus anderen Zigeuner- Gesellschaften kennt[2] bilden auch die Gitanos eine Art Kontrastkultur zur spanischen Mehrheitsgesellschaft, die ich nun im Folgenden erläutern werde.
In der Kultur der Gitanos wird ganz klar unterteilt in Mann und Frau, Homosexualität wird in ihrer Gesellschaft grundsätzlich ausgeschlossen, dieses Verhalten wird ausschließlich den Payos zugeschrieben. Das was im Verständnis von Weiblichkeit die wichtigste Rolle spielt ist die honra, ein spanischer Begriff, der sich mit Ehrbarkeit, Ansehen und Ehre übersetzen lässt. Dieses kulturelle Konstrukt beschreibt die Ehre der Frau in Form von Unberührtheit, Unversehrtheit, sprich Jungfräulichkeit, insbesondere auch als Voraussetzung für eine Heirat im traditionellen Sinne. Eine Heirat vermehrt das Ansehen der Familie nur, wenn die zu verheiratende Tochter noch Jungfrau ist, ansonsten gilt eine Heirat eher als Schande für die gesamte Familie. Es wird angenommen, dass sich insbesondere im Verlauf des 20. Jahrhunderts in der spanischen Gesellschaft eine Tendenz erkennen lässt, welche aufzeigt, dass unterschiedliche, oft widersprüchliche, moralische Diskurse entwickelt werden, innerhalb eines Kampfes um die politische Vormachtstellung.[3] Die Gitanos, die sich ganz am unteren Ende der sozialen und ökonomischen Skala wieder finden, haben sich in diesen Diskurs durch ein bestimmtes Bild von Moral unter den sozialen Geschlechtern eingeschrieben. Im Verlauf dieses Prozesses haben sie sich als die einzigen ehrbaren und achtenswerten Spanier entworfen. Wie z.B. auch bei den Corturari in Rumänien[4] werden auch hier traditionelle Stigmata, die die Mehrheitsgesellschaft sonst auf die Zigeuner projiziert nun genau in die entgegen gesetzte Richtung gelenkt und auf die Payos angewendet. Auf diesen Aspekt soll jedoch im zweiten Teil näher eingegangen werden. Obwohl es in den Gender- Diskursen der Gitanos einige Übereinstimmungen mit der spanischen Mehrheitsbevölkerung gibt[5], unterscheiden sie sich z.B. in ihrem Konzept vom weiblichen Körper doch erheblich. Der Körper der Frau ist bei den Gitanos sozusagen die Austragungsfläche ihres Moraldiskurses, er dient als Projektionsfläche für alle positiv besetzten moralischen Attribute, wie: Reinheit, Unversehrtheit, Jungfräulichkeit und Ehrbarkeit. Im Gegenzug hierzu wird der Körper einer Paya mit allen negativen, ambivalenten und sündhaften Attributen belegt. Gay-Y-Blasco untersucht die genauen Vorgänge dieses kulturellen Selbstentwurfs und erkennt im Laufe ihrer Ethnographie, dass die Gitanos anders als ihre nicht- zigeunerischen Nachbarn ihre Gruppenidentität nicht über Territorium, Tradition und soziale Harmonie definieren, sondern über gegenwärtige individuelle moralische Leistungen und moralisches Verhalten. In allem was sie tun, führen sie eine vor allem moralische Überlegenheit gegenüber den Spaniern vor. Dies manifestiert sich im individuellen Verhalten, dem Umgang mit Emotionen, in ihrer Kleidung und besonders deutlich während einer Hochzeit, bei der die Jungfräulichkeit der Braut in einem Ritual getestet wird. Gay-Y-Blasco glaubt, dass für die Gitanos der (weibliche und männliche) Körper das entscheidende Medium zur Konstruktion und Erfahrung ihrer gemeinsamen Identität ist. Der Körper an sich ist also ein wichtiges Element zur Konstruktion von Moral, Identität und Werten. Dennoch werden die Körper von Männern und Frauen hier sehr unterschiedliche bewertet. Sowohl Männer als auch Frauen bestätigen z.B., dass Frauen von Natur aus schlechter und weniger intelligent sind als Männer und deshalb eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Eine Gleichstellung der Geschlechter ist für sie ein Phänomen der Payo- Kultur, welches sie vehement ablehnen. Generell werden männliche Nachkommen bevorzugt, während der Erziehung genießen die Jungen quasi Narrenfreiheit, während die Mädchen recht schnell lernen müssen, dass sie weniger wert sind und stets gehorchen müssen. Bei der Erziehung werden vor allem die Jungen bestärkt darin, über ihre Geschlechtsteile eine Identität aufzubauen und stolz auf sie zu sein. Die weiblichen und männlichen Genitalien stehen metonymisch für Mädchen und Jungen, werden gerne gezeigt und sogar als Spitznamen gebraucht (pija bzw. chocho). Die Kategorien Mann und Frau werden so von Geburt an zueinander in eine klare hierarchische Beziehung gesetzt. Laut Gay-Y-Blasco legen die Gitanos weiterhin großen Wert auf die Kontrolle ihrer sexuellen Aktivität. Jedoch müssen sich die Frauen hier besonders zurückhalten, da sie bis zur Hochzeit Jungfrauen bleiben müssen, aber auch danach dürfen sie ihren Mann nicht betrügen.
[...]
[1] Aus der Einführung der DGV Tagung 2007 zum Forschungsfeld Gender in der Ethnologie. Auf: http://www.dgv-tagung2007.de/index411e.html?page_id=88
Stand: 22.2.2009
[2] Siehe hierzu z.B. die Ausführungen von Ries, Johannes 2007: Welten Wanderer. Über die kulturelle Souveränität siebenbürgischer Zigeuner und den Einfluß des Pfingstchristentums. Würzburg: Ergon
[3] Siehe hierzu die Ausführungen von Calvo Buezas, Tomás 1990: España Racista? Voces Payas sobre los Gitanos. Barcelona, Anthropos
[4] Siehe hierzu die Dissertation von Ries, Johannes 2007: Welten Wanderer. Über die kulturelle Souveränität siebenbürgischer Zigeuner und den Einfluß des Pfingstchristentums. Würzburg: Ergon
[5] Man kann z.B. sicherlich von einem ausgeprägten Machismo in beiden Gesellschaften sprechen. Auch in manchen Teilen Spaniens gibt es eine sehr starke Geschlechtersegregation, die sich unter anderem auch in der Volkskultur in Form von spezifischen Geschlechterrepräsentationen wieder spiegelt, welche z.B. ausgedrückt werden in Märchen oder anderen volkstümlichen Erzählungen. Siehe hierzu Taggart, James 1992: Segregation and Cultural Constructions of Sexuality in Two Hispanic Societies. In: American Ethnologist, Vol. 19, No.1, S. 75-96
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „Sex“ und „Gender“?
"Sex" bezeichnet das biologische Geschlecht, während "Gender" das kulturell und gesellschaftlich konstruierte Geschlecht sowie die damit verbundenen Rollenbilder beschreibt.
Was bedeutet „Honra“ in der Kultur der Gitanos?
Honra steht für die Ehre und Ehrbarkeit, die bei Frauen insbesondere durch Jungfräulichkeit vor der Ehe definiert wird und das Ansehen der gesamten Familie bestimmt.
Wer sind die „Payos“?
Als Payos bezeichnen die Gitanos die nicht-zigeunerische spanische Mehrheitsgesellschaft, von der sie sich durch ihre Moraldiskurse bewusst abgrenzen.
Wie wird der weibliche Körper bei den Gitanos gesehen?
Der Körper der Frau dient als Projektionsfläche für moralische Werte wie Reinheit und Unversehrtheit, steht aber gleichzeitig unter strenger sozialer Kontrolle.
Warum lehnen Gitanos die Gleichstellung der Geschlechter oft ab?
In ihrer traditionellen Weltsicht werden Geschlechterrollen hierarchisch und komplementär verstanden; Gleichstellung wird als ein Phänomen der Payo-Kultur betrachtet.
- Citar trabajo
- Nathalie Solis Pérez (Autor), 2009, Prestige und Gender, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136779