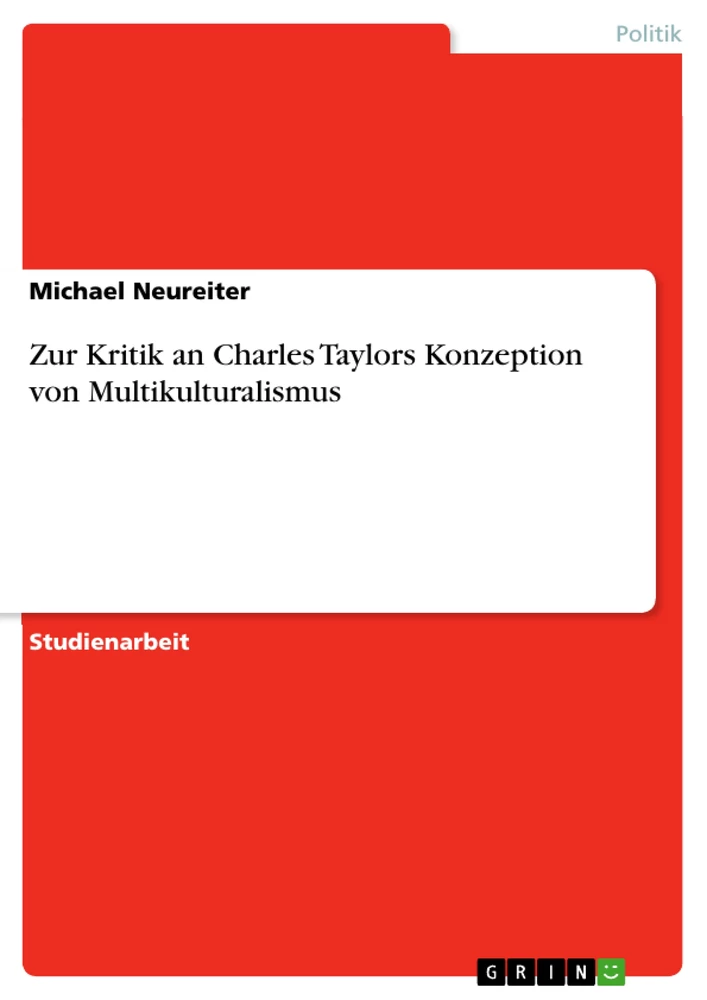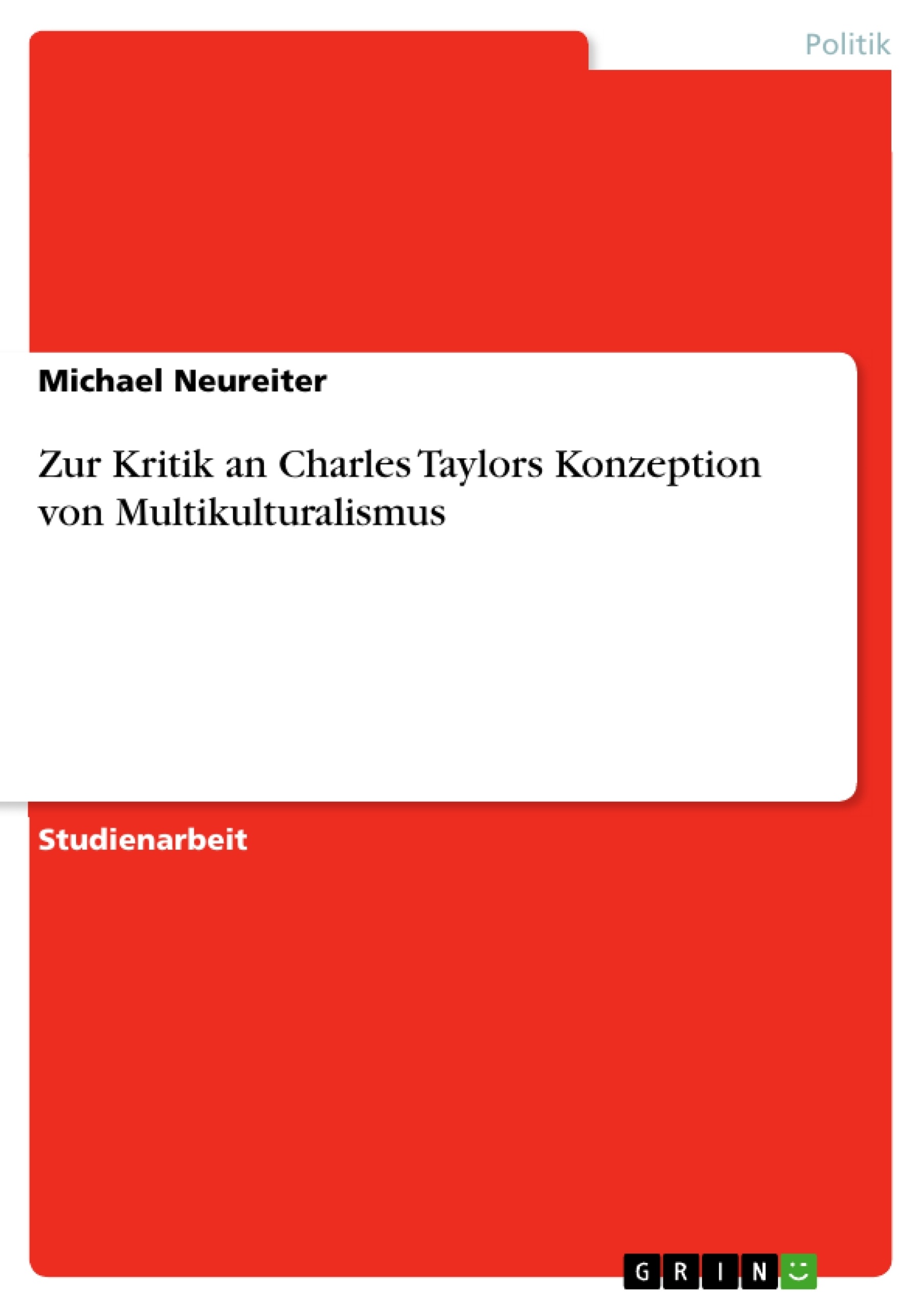Kaum ein Begriff hat die öffentliche Diskussion in den vergangenen Jahren derart beherrscht wie der der Globalisierung, welcher den Prozess der voranschreitenden weltweiten Vernetzung von Ökonomien und Kommunikationsprozessen über die Grenzen der einzelnen Nationalstaaten hinaus bezeichnet. Der Begriff ist in erster Linie deswegen so populär und zugleich polarisierend, da heute nahezu kein Lebensbereich mehr existiert, der von dieser Entwicklung nicht betroffen wäre. So sind die Auswirkungen der Globalisierung selbst für den „einfachen“ Bürger tagtäglich spürbar, bspw. beim Kauf von Gütern oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Sie werden jedoch vor allem dadurch bemerkbar, dass sich der Einzelne gegenwärtig mit der Situation konfrontiert sieht, auf engstem geographischen Raum mit Angehörigen unterschiedlichster Kulturen in Berührung zu kommen. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen verläuft jedoch nicht immer problemlos, weshalb sich sowohl praktische Politik als auch politische Theorie mit der Thematik auseinandergesetzt haben und immer noch auseinandersetzen. Im Zusammenhang mit der Frage, wie das Miteinander der Kulturen möglichst konfliktfrei und gerecht geregelt werden könne, wird häufig der Begriff des „Multikulturalismus“ gebraucht.
Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit eben diesem Begriff des „Multikulturalismus“. Der erste Punkt dieser Arbeit dient dabei zur Erläuterung der Frage, was unter besagtem Phänomen überhaupt zu verstehen ist. Anschließend sollen die Erkenntnisse eines Theoretikers zum Thema Multikulturalismus etwas näher beleuchtet werden. Dazu wurde exemplarisch das 1992 erstmals erschienene Essay Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung des kanadischen Philosophen Charles Taylor ausgewählt, da es innerhalb der Multikulturalismus-Debatte eine besondere Relevanz besitzt. Der Hauptteil meiner Ausführungen widmet sich sodann der Frage, mit welchen Schwächen die Argumentation Taylors behaftet ist bzw. welche Kritik an seiner Auffassung von Multikulturalismus geübt werden kann/muss. In einem abschließenden Fazit sollen die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit noch einmal komprimiert dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- B: Zur Kritik an Charles Taylors Konzeption von Multikulturalismus
- 1. Begriffsbestimmung: Was ist eigentlich „Multikulturalismus“?
- 2. Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung
- 3. Zur Kritik an Taylors Argumentation
- 3.1 Was rechtfertigt den Erhalt/Schutz von Kulturen?
- 3.2 Widersprüchlichkeit der Argumentation
- 3.3 Das Zusammenspiel von Kulturen – ein Nullsummenspiel
- 3.4 Probleme bei der Bestimmung von (Mehrheits- und Minderheits-)Kultur
- 3.5 Zur individualistischen/liberalen Kritik an Taylors Konzept
- C: Fazit
- D: Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kritik an Charles Taylors Konzeption von Multikulturalismus. Sie analysiert zunächst den Begriff des Multikulturalismus und stellt anschließend Taylors Argumentation im Hinblick auf die Politik der Anerkennung vor. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt darauf, Taylors Argumentation auf ihre Schwächen und Widersprüche zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet dabei die Frage, was die Erhaltung und den Schutz von Kulturen rechtfertigt, und hinterfragt das Zusammenspiel von Mehrheits- und Minderheitskulturen im Kontext von Multikulturalismus. Weiterhin werden Probleme bei der Bestimmung von Kulturen und die Kritik an Taylors Konzept aus individualistischer und liberaler Perspektive beleuchtet.
- Begriffsbestimmung des Multikulturalismus
- Taylors Argumentation zur Politik der Anerkennung
- Kritik an Taylors Argumentation: Rechtfertigung des Kulturerhalts
- Kritik an Taylors Argumentation: Das Zusammenspiel von Kulturen
- Kritik an Taylors Argumentation: Probleme bei der Bestimmung von Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Begriff des Multikulturalismus definiert und als „theoriegeleitete Reflexion“ dargestellt. Es werden verschiedene Aspekte des Zusammenlebens verschiedener Kulturen beleuchtet, die sich in ihren materiellen Gestaltungsformen, Symbolen, Werten und Idealen unterscheiden. Die Arbeit stellt heraus, dass Multikulturalismus nicht als ein Zustand oder eine Handlung zu verstehen ist, sondern als eine theoretische Auseinandersetzung mit der Frage, wie das Zusammenleben verschiedener Kulturen gleichberechtigt und friedlich gestaltet werden kann.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Charles Taylors Argumentation zum Multikulturalismus in seinem Essay „Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung“. Taylor argumentiert, dass die Identitätsbildung von Individuen von der soziokulturellen Wertschätzung abhängt, die sie von der Gesellschaft erfahren. Er stellt heraus, dass eine ausreichende Anerkennung für die kulturelle Besonderheit von Minderheitengruppen essentiell für deren seelisches Wohlbefinden ist.
Kapitel drei widmet sich der Kritik an Taylors Argumentation. Es werden verschiedene Kritikpunkte an Taylors Konzept aufgezeigt, darunter die Frage, was den Erhalt und den Schutz von Kulturen rechtfertigt, die Widersprüchlichkeit in Taylors Argumentation, das Zusammenspiel von Kulturen als Nullsummenspiel, die Probleme bei der Bestimmung von Mehrheits- und Minderheitskulturen und die Kritik aus individualistischer und liberaler Perspektive.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Multikulturalismus, Politik der Anerkennung, Charles Taylor, Identitätsbildung, kulturelle Besonderheit, Minderheitenrechte, Kritik an Taylors Konzept, liberaler Multikulturalismus, individualistische Kritik, Nullsummenspiel, Kulturerhalt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Charles Taylor unter der "Politik der Anerkennung"?
Taylor argumentiert, dass die Identität eines Menschen von der Anerkennung durch andere abhängt. Fehlende oder falsche Anerkennung kann laut ihm zu einer Schädigung des Selbstbildes führen, weshalb Minderheiten ein Recht auf Anerkennung ihrer kulturellen Besonderheit haben.
Warum ist kulturelle Anerkennung für die Identität wichtig?
Laut Taylor findet Identitätsbildung in einem dialogischen Prozess statt. Die soziokulturelle Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft ist essenziell für das seelische Wohlbefinden des Einzelnen.
Welche Kritikpunkte werden an Taylors Konzept geäußert?
Kritiker hinterfragen die Rechtfertigung des Schutzes von Kulturen zulasten individueller Freiheiten, weisen auf logische Widersprüche in seiner Argumentation hin und sehen Probleme bei der Definition von Mehrheits- und Minderheitskulturen.
Inwiefern wird Taylors Argumentation als widersprüchlich angesehen?
Die Arbeit untersucht, ob der Schutz kollektiver kultureller Rechte im Widerspruch zu liberalen, individualistischen Grundrechten steht, die eigentlich die Basis moderner Demokratien bilden.
Was bedeutet "Multikulturalismus als Nullsummenspiel"?
Dieser Kritikpunkt besagt, dass die Förderung einer spezifischen Kultur oft zulasten einer anderen geht und somit keine echte Gleichberechtigung, sondern neue Konflikte schaffen kann.
Welche Rolle spielt die Globalisierung in dieser Debatte?
Die Globalisierung führt zu einer verstärkten Vernetzung und dazu, dass Menschen unterschiedlichster Kulturen auf engem Raum zusammenleben, was die theoretische Auseinandersetzung mit Multikulturalismus dringlich macht.
- Arbeit zitieren
- Michael Neureiter (Autor:in), 2009, Zur Kritik an Charles Taylors Konzeption von Multikulturalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136804