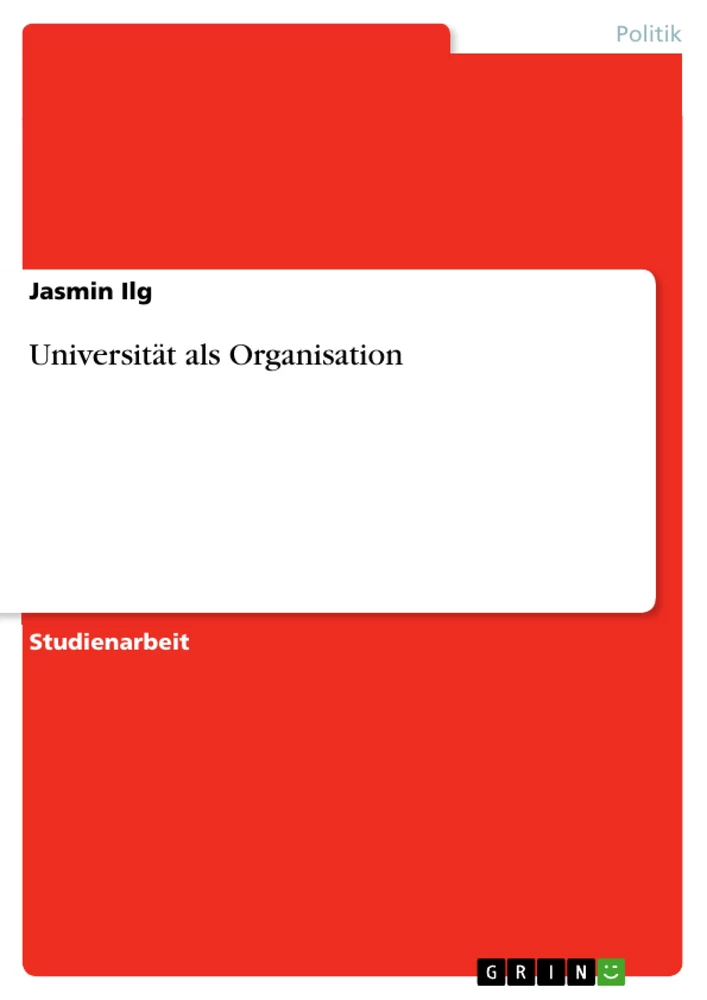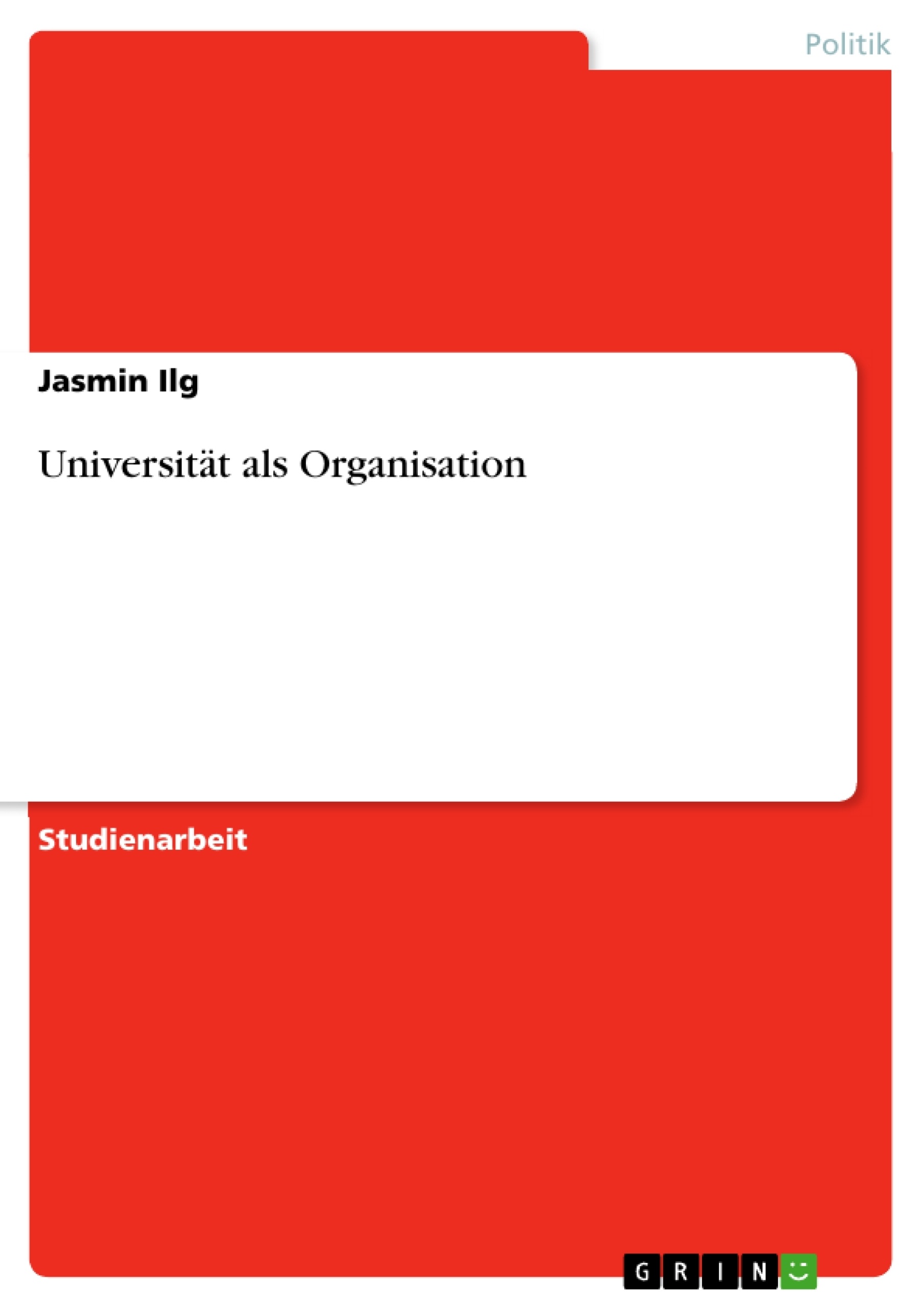Die Universität ist eine vielschichtige Organisation, in welcher sehr unterschiedliche Interessen und Ziele zusammentreffen. Zum einem sind dort die Studenten und Professoren, aber auch die zahlreichen Angestellten der Bibliothek, des Rechenzentrums oder der Mensa sind unentbehrlich für die Hochschule. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen der Personengruppen spiegelt sich in den zentralen Aufgaben Lehre, Forschung und Dienstleistung wieder (Pellert 1999, S. 107).
In dieser Hausarbeit werde ich mich mit der Frage auseinander setzten, warum die Universität als eine Organisation betrachtet werden kann. Hierzu werde ich verschiedene organisationstheoretische Ansätze vorstellen und diese dann auf die Organisation Universität anwenden. Meine Untersuchung wird sich hierbei auf die folgenden vier Organisationstheorien beschränken: Institutionsökonomie, Evolutionstheorie, konstruktivistische Ansätze und Neoinstitutionalismus.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Organisationstheorien
2.1 Institutionsökonomischer Ansatz
2.1.1 Transaktionskostenansatz
2.1.2 Prinzipal – Agent Ansatz
2.1.3 Verfügungsrechtsansatz
2.2. Evolutionsansatz
2.3 Konstruktivismus
2.4 Neoinstitutionalistische Ansätze
2.4.1 Makroinstitutionalismus
2.4.2 Mikroinstitutionalismus
3. Schluss
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Universität ist eine vielschichtige Organisation, in welcher sehr unterschiedliche Interessen und Ziele zusammentreffen. Zum einem sind dort die Studenten und Professoren, aber auch die zahlreichen Angestellten der Bibliothek, des Rechenzentrums oder der Mensa sind unentbehrlich für die Hochschule. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen der Personengruppen spiegelt sich in den zentralen Aufgaben Lehre, Forschung und Dienstleistung wieder (Pellert 1999, S. 107).
In dieser Hausarbeit werde ich mich mit der Frage auseinander setzten, warum die Universität als eine Organisation betrachtet werden kann. Hierzu werde ich verschiedene organisationstheoretische Ansätze vorstellen und diese dann auf die Organisation Universität anwenden. Meine Untersuchung wird sich hierbei auf die folgenden vier Organisationstheorien beschränken: Institutionsökonomie, Evolutionstheorie, konstruktivistische Ansätze und Neoinstitutionalismus.
2. Organisationsbegriff
Organisationstheorien haben den Zweck, Organisation zu erklären. Sie gehen dabei jeweils von einem bestimmten Vorverständnis aus und betrachten immer nur einen Teilbereich der Organisation (vgl.Vahs, 2003: S. 22). Den einen Begriff der Organisation gibt es daher nicht.
2.1 Institutionsökonomie
Aus ökonomischer Sicht ist eine Organisation eine geschaffene, wirtschaftlich abgrenzbare Einheit, durch die und in der verschiedene Personen miteinander interagieren und um kollektive ökonomische Ziele zu erreichen (Webers, 2003: S.9). Die neue Institutionsökonomie ist einer dieser Ansätze. Hierzu lassen sich drei Teilansätze unterscheiden: der Transaktionskostenansatz, der Verfügungsrechtsansatz und der Prinzipal-Agent-Ansatz. Diesen Theorien gemein, ist die Annahme vom begrenzt rationalen Akteuren, deren Wissen, Informationskapazität und Moral eingeschränkt sind (Vahs, 2003: S. 39).
2.1.1 Transaktionskostenansatz
Die Transaktionskostenökonomie geht auf Ronald Coase zurück, welcher in seinen Artikel „The Nature of the Firm“ sein Konzept erstmals vorstellte (Williamson, 1993: S. 39). Ausgangspunkt diese Ansatzes ist die Annahme, dass Markt und Hierarchie alternative Instrumente für die Ausführung von Transaktionen sind (Coase, 1937: S. 397). Fraglich ist, welche Alternative kostengünstiger und damit effizienter organisieren kann.
Forschung und Lehre, als die zentralen Aufgaben der Universität, sind sehr kostspielig. Eine effiziente und kostengünstiger Abwicklung über den Markt ist nicht gegeben. An der Universität befindet sich das kumuliertes Wissen der einzelnen Fachbereiche. Außerhalb einer Hochschule ist eine solche Anhäufung nicht vorstellbar.
2.1.2 Prinzipal-Agent Ansatz
Die Prinzipal-Agent Theorie betrachtet das Verhältnis zwischen Auftragsgeber und Auftragsnehmer. Der Prinzipal überträgt zur Realisation seiner Interessen bestimmte Aufgaben und Entscheidungskompetenzen auf der Basis eines Vertrages an einen Agenten, der für seine Dienste eine Vergütung erhält (Kieser, 2006: S. 258). Durch divergierende Interessen und ungleich verteilter Informationen ist diese Beziehung problematisch. Der Ansatz versucht nun für den Prinzipal Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Anreizsysteme oder Kontrolle wären Beispiele hierfür.
Wenn man sich die einzelnen Vertragsbeziehungen in der Universität anschaut, kann man eine solche Prinzipal-Agenten Beziehung finden. Eine studentische Hilfskraft kann als Agent betrachtet werden, der Professor als Prinzipal. Der Auftragsgeber wird regelmäßig die Arbeit des Studenten kontrollieren oder aber ihn eine Empfehlung für gute Arbeit in Aussicht stellen, damit dieser die erteilte Arbeit in seinem Interesse erledigt.
2.1.3 Verfügungsrechtsansatz
Der letzte Ansatz der neuen Institutionsökonomie hat als Ansatzpunkt Verfügungsrechte. Verfügungsrechte legen fest, in welcher Weise ihr Inhaber legitimerweise über die Ressourcen verfügen kann, an denen er die Rechte hat (Kieser, 2006: S. 248).
Ferner geht dieser Ansatz von Transaktionskosten aus, die durch Bestimmung, Übertragung und Durchsetzung von Verfügungsrechten entstehen (ebd).
Kernaussage ist nun, dass jeder Akteur seinen Nettonutzen maximieren will und zwar innerhalb der Verfügungsrechtsstrukturen als auch bei der Gestaltung dieser.
Diese Annahme analog angewendet auf öffentliches Einrichtungen, wie auch die Universität eine darstellt, sollte diese im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen weniger Anreiz haben, die Ressourcen über die sie verfügen effizient zu nutzen, da sie keine marktwirtschaftliche Konkurrenz haben. Dies trifft auf die Universität nicht zu. Vielmehr sieht sich jede Universität in Konkurrenz zu anderen Universitäten. Jede Hochschule versucht sich durch ein attraktives Umfeld, gute Lehre und Forschung von anderen Hochschulen abzuheben. Dies zeigt insbesondere der Wettbewerb in den vergangenen Jahren um die Bezeichnung der Exzellenzuniversität. Problematisch ist ferner die Einteilung der Verfügungsrechte.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Universität als Organisation betrachtet?
Weil sie eine vielschichtige Einheit ist, in der unterschiedliche Interessengruppen (Studenten, Professoren, Angestellte) zusammenarbeiten, um Ziele in Lehre und Forschung zu erreichen.
Wie erklärt der Transaktionskostenansatz die Existenz von Universitäten?
Er geht davon aus, dass die Bündelung von Wissen und Forschung innerhalb einer Hierarchie (Universität) effizienter ist als die Abwicklung über den freien Markt.
Was besagt der Prinzipal-Agent-Ansatz im Hochschulkontext?
Er analysiert Beziehungen wie die zwischen Professor (Prinzipal) und Hilfskraft (Agent), bei denen Aufgaben übertragen und Leistungen kontrolliert werden.
Stehen Universitäten untereinander im Wettbewerb?
Ja, trotz ihres Status als öffentliche Einrichtungen konkurrieren sie um Exzellenz-Titel, Fördermittel und attraktive Forschungsbedingungen.
Welche Organisationstheorien werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung beschränkt sich auf die Institutionsökonomie, die Evolutionstheorie, konstruktivistische Ansätze und den Neoinstitutionalismus.
- Citar trabajo
- Jasmin Ilg (Autor), 2009, Universität als Organisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136940