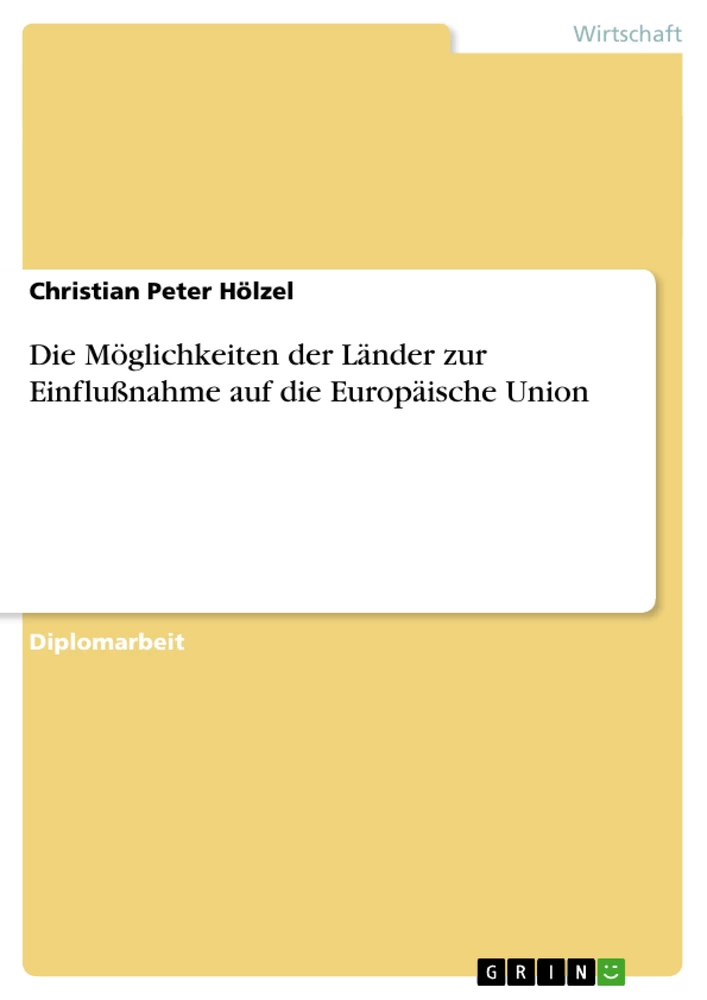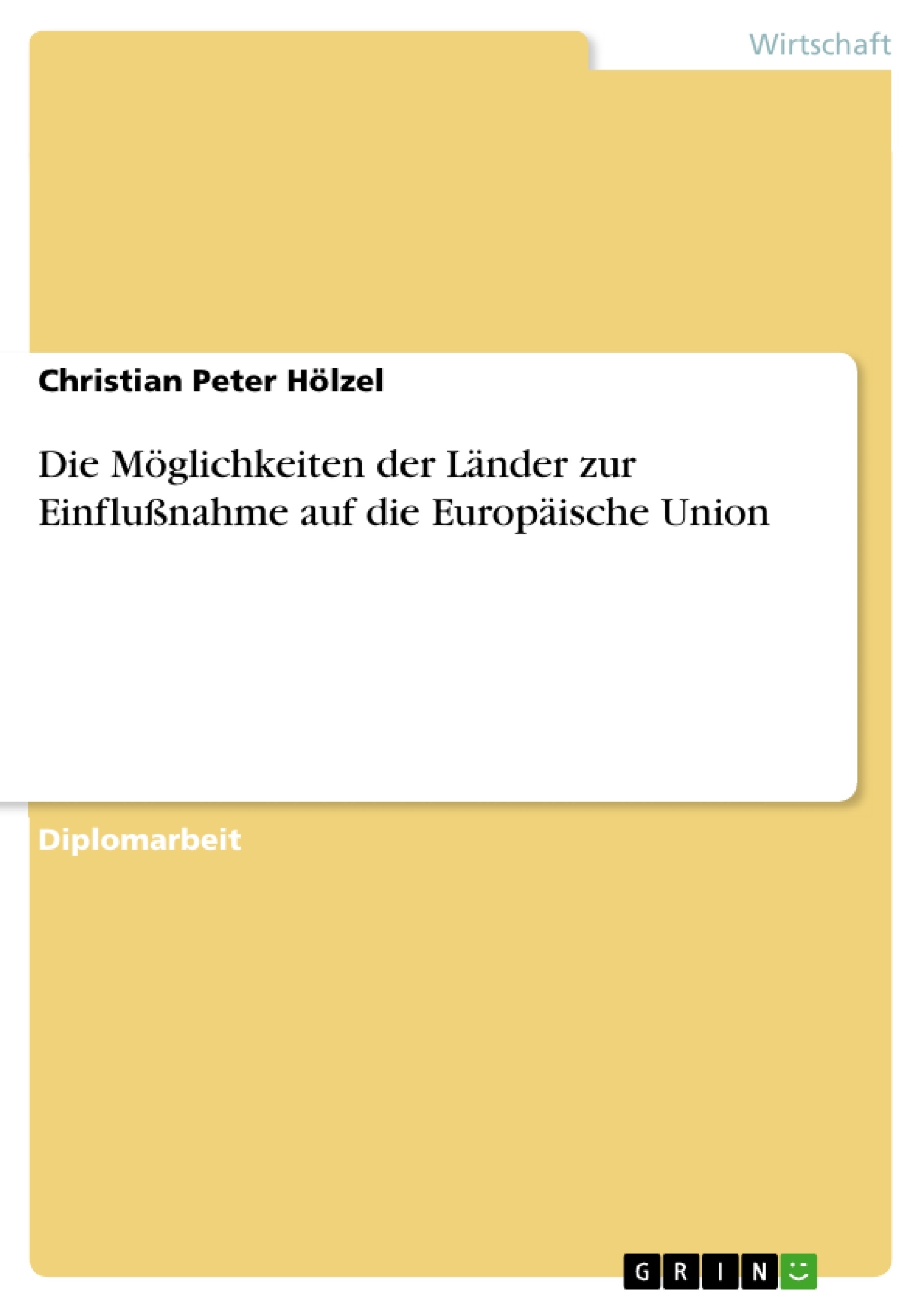"Österreich ist ein Bundesstaat und wird gebildet aus den selbständigen Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien" - so steht es zu Beginn der österreichischen Bundesverfassung. Jedoch gibt es schon seit Jahrzehnten Diskussionen über die Effektivität und Sinnhaftigkeit der Bundesländer in der heutigen Zeit. Besonders wurde diese Diskussion durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union angeheizt und immer wieder wird dabei das Argument gebracht, daß die Bundesländer sich in der modernen Welt überholt hätten und ihre Bestimmung sowieso nicht erfüllen könnten. Doch wie sieht es tatsächlich am Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts mit den Möglichkeiten der Bundesländer innerhalb der Europäischen Union aus - können sie den Willensbildungsprozeß innerstaatlich beeinflussen beziehungsweise was sind ihre Möglichkeiten in Brüssel? Diese Arbeit beleuchtet die direkten und indirekten Möglichkeiten der österreichischen Bundesländer bei der europäischen Integration und zeigt ihre Mitwirkung innerhalb Europas auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Problem- und Fragestellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Vorläuferversuche für die Mitwirkung der Länder in der Europäischen Gemeinschaft
- 2.1 Entwurf zur Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung durch die EVP
- 2.2 Vertragsentwurf des Europäischen Parlaments zur Schaffung einer Europäischen Union 1984
- 2.3 Der Beirat der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
- 2.4 Die Gemeinschaftscharta der Regionalisierung des Europäischen Parlaments
- 2.5 Rat für Fragen der österreichischen Integrationspolitik
- 3 Indirekte Möglichkeiten zur Einflußnahme der Länder auf die Europäische Union
- 3.1 Verpflichtung des Bundes zur Beachtung der Länderstandpunkte nach Artikel 10 (3) der Bundesverfassung
- 3.2 Das österreichische Länderbeteiligungsverfahren bei den indirekten Möglichkeiten
- 3.2.1 Geschichtliche Entwicklung des Länderbeteiligungsverfahren
- 3.2.2 Die Verpflichtung des Bundes nach den Artikeln 23d bis 23f B-VG
- 3.2.2.1 Verpflichtung des Bundes nach Artikel 23d der Bundesverfassung
- 3.2.2.2 Verpflichtung des Bundes nach Artikel 23e der Bundesverfassung
- 3.2.2.3 Verpflichtung des Bundes nach Artikel 23f der Bundesverfassung
- 3.2.3 Vereinbarung des Bundes mit den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über die Mitwirkungsrechte der Länder und Gemeinden in Angelegenheiten der europäischen Integration
- 3.2.4 Vereinbarung zwischen den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über die gemeinsame Willensbildung der Länder in Angelegenheiten der europäischen Integration
- 3.2.5 Begriffsdefinitionen zum Länderbeteiligungsverfahren
- 3.2.5.1 Exkurs: "zwingende außen- und integrationspolitische Gründe"
- 3.2.5.2 Exkurs: Probleme bei den einheitlichen Stellungnahmen des Nationalrates und der Länder
- 3.2.5.3 Exkurs: Die Verbindungsstelle der Bundesländer
- 3.2.5.4 Exkurs: Vereinbarungen gemäß Artikel 15a B-VG
- 3.3 Institutionen zur Vertretung der Länderstandpunkte gegenüber dem Bund
- 3.3.1 Der österreichische Bundesrat
- 3.3.2 Die Landeshauptleutekonferenz
- 3.3.2.1 Exkurs: Die Mitwirkung der Landtage an der europäischen Integration
- 3.3.3 Die Integrationskonferenz der Länder
- 3.3.4 Der Ständige Integrationsausschuß der Länder
- 3.3.5 Der Nationale Sicherheitsrat
- 4 Direkte Möglichkeiten zur Einflußnahme der Länder auf die Europäische Union
- 4.1 Das österreichische Länderbeteiligungsverfahren bei den direkten Methoden
- 4.1.1 Verpflichtung des Bundes nach Artikel 23d der Bundesverfassung
- 4.1.2 Vereinbarung des Bundes mit den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über die Mitwirkungsrechte der Länder und Gemeinden in Angelegenheiten der europäischen Integration
- 4.1.3 Die Ländervertretung in der Komitologie
- 4.2 Institutionen zur Vertretung der Länderstandpunkte
- 4.2.1 Die Versammlung der Regionen Europas
- 4.2.2 Der Ausschuß der Regionen
- 4.2.2.1 Vorbesprechung der österreichischen Delegation im Ausschuß der Regionen
- 4.2.3 Die Ländervertretung in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union
- 4.2.4 Die Länderbüros in Brüssel
- 4.2.5 Das Europäische Parlament
- 5 Bewertung der Möglichkeiten der Länder
- 5.1 Bewertung der indirekten Methoden
- 5.1.1 Der Bundesrat
- 5.1.2 Die Landeshauptleutekonferenz
- 5.1.3 Die Integrationskonferenz der Länder
- 5.1.4 Der Nationale Sicherheitsrat
- 5.2 Bewertung der direkten Methoden
- 5.2.1 Die Ländervertretung an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union und die Länderbüros
- 5.2.2 Der Ausschuß der Regionen
- 5.2.3 Das Europäische Parlament
- 5.3 Kritikpunkte an den indirekten und direkten Möglichkeiten der Länder
- 5.3.1 Kritikpunkte an den indirekten Möglichkeiten
- 5.3.2 Kritikpunkte an den direkten Möglichkeiten
- 5.4 Schlußfolgerungen
- 5.5 Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der österreichischen Bundesländer, Einfluss auf die Europäische Union auszuüben. Sie analysiert sowohl indirekte als auch direkte Einflussnahme-Möglichkeiten und bewertet deren Effektivität. Die Arbeit beleuchtet die Rolle verschiedener Institutionen und Verfahren in diesem Kontext.
- Die indirekten Einflussnahme-Möglichkeiten der Bundesländer auf die EU
- Die direkten Einflussnahme-Möglichkeiten der Bundesländer auf die EU
- Die Rolle des Bundes im österreichischen Länderbeteiligungsverfahren
- Die Effektivität der verschiedenen Einflussnahme-Mechanismen
- Institutionelle Strukturen zur Vertretung der Länderinteressen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Aufbau des österreichischen Bundesstaates und die Bedeutung der Bundesländer. Es hebt die verstärkte Diskussion um die Rolle der Länder im Kontext des EU-Beitritts und der damit verbundenen Kompetenzabtretungen hervor. Die zunehmende EU-Skepsis in der Bevölkerung und der Versuch der EU, eine Vereinheitlichung Europas herbeizuführen, werden als Hintergrund für die Untersuchung der Länderbeteiligung an europäischen Integrationsfragen genannt.
2 Vorläuferversuche für die Mitwirkung der Länder in der Europäischen Gemeinschaft: Dieses Kapitel untersucht verschiedene frühe Versuche, die Bundesländer in die europäische Integration einzubeziehen. Es analysiert verschiedene Entwürfe und Initiativen, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, die den Grundstein für spätere Verfahren und Institutionen legten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der institutionellen Strukturen und der Bemühungen um die Beteiligung regionaler und lokaler Akteure.
3 Indirekte Möglichkeiten zur Einflußnahme der Länder auf die Europäische Union: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den indirekten Wegen, wie die österreichischen Bundesländer Einfluss auf die EU-Politik nehmen können. Es analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen (Artikel 10 (3) und Artikel 23d-23f B-VG), das österreichische Länderbeteiligungsverfahren, die Rolle des Bundesrats, der Landeshauptleutekonferenz und anderer Institutionen. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Verfahren, der jeweiligen rechtlichen Verpflichtungen und der Herausforderungen bei der Koordination der Länderstandpunkte.
4 Direkte Möglichkeiten zur Einflußnahme der Länder auf die Europäische Union: Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel konzentriert sich dieser Abschnitt auf die direkten Möglichkeiten der Einflussnahme der Länder auf die EU. Das Kapitel erläutert die Rolle des Ausschusses der Regionen, die Ländervertretung in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU und in Brüssel, sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme über das Europäische Parlament. Es wird auf die institutionellen Strukturen und deren Funktionsweisen eingegangen.
5 Bewertung der Möglichkeiten der Länder: Dieses Kapitel bietet eine kritische Bewertung der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Möglichkeiten der Einflussnahme der österreichischen Bundesländer auf die Europäische Union. Es analysiert sowohl die Stärken als auch die Schwächen der indirekten und direkten Methoden und benennt Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale. Die Kapitel fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Österreichische Bundesländer, Europäische Union, Länderbeteiligung, europäische Integration, indirekte Einflussnahme, direkte Einflussnahme, Bundesrat, Landeshauptleutekonferenz, Ausschuß der Regionen, Komitologie, Artikel 10 (3) B-VG, Artikel 23d-23f B-VG, Artikel 15a B-VG, institutionelle Strukturen, Willensbildung, Kritikpunkte, Zukunftsaussichten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Möglichkeiten der österreichischen Bundesländer, Einfluss auf die Europäische Union auszuüben
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Möglichkeiten der österreichischen Bundesländer, Einfluss auf die Europäische Union (EU) auszuüben. Sie analysiert sowohl indirekte als auch direkte Einflussnahme-Möglichkeiten und bewertet deren Effektivität. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle verschiedener Institutionen und Verfahren in diesem Kontext.
Welche Einflussnahme-Möglichkeiten der Bundesländer werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl indirekte als auch direkte Einflussnahme-Möglichkeiten der österreichischen Bundesländer auf die EU. Indirekte Methoden umfassen verfassungsrechtliche Grundlagen (z.B. Artikel 10 (3) und Artikel 23d-23f B-VG), das österreichische Länderbeteiligungsverfahren, die Rolle des Bundesrats und der Landeshauptleutekonferenz. Direkte Methoden beinhalten die Ländervertretung im Ausschuss der Regionen, in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU und in Brüssel, sowie die Einflussnahme über das Europäische Parlament.
Welche Institutionen spielen eine Rolle bei der Einflussnahme der Bundesländer?
Verschiedene Institutionen spielen eine entscheidende Rolle: der Bundesrat, die Landeshauptleutekonferenz, die Integrationskonferenz der Länder, der Ständige Integrationsausschuß der Länder, der Nationale Sicherheitsrat, der Ausschuss der Regionen, die Versammlung der Regionen Europas und die Ländervertretungen in Brüssel und der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU. Die Arbeit analysiert die Rolle jeder Institution im Detail.
Wie wird die Effektivität der Einflussnahme-Methoden bewertet?
Die Arbeit bewertet kritisch sowohl die Stärken als auch die Schwächen der indirekten und direkten Einflussnahme-Methoden. Sie identifiziert Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale und bietet Schlussfolgerungen sowie Zukunftsaussichten für die Beteiligung der Bundesländer an der europäischen Integration.
Welche verfassungsrechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt relevante Artikel der Bundesverfassung (B-VG), insbesondere Artikel 10 (3), Artikel 23d bis 23f und Artikel 15a, die die Mitwirkungsrechte der Länder in Angelegenheiten der europäischen Integration regeln. Die Analyse dieser Artikel bildet die Grundlage für das Verständnis der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die frühere Versuche der Länderbeteiligung, die indirekten und direkten Einflussnahme-Möglichkeiten, sowie eine abschließende Bewertung mit Schlussfolgerungen und Zukunftsaussichten. Jedes Kapitel geht detailliert auf die jeweiligen Aspekte ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Österreichische Bundesländer, Europäische Union, Länderbeteiligung, europäische Integration, indirekte Einflussnahme, direkte Einflussnahme, Bundesrat, Landeshauptleutekonferenz, Ausschuss der Regionen, Komitologie, Artikel 10 (3) B-VG, Artikel 23d-23f B-VG, Artikel 15a B-VG, institutionelle Strukturen, Willensbildung, Kritikpunkte, Zukunftsaussichten.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts prägnant zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Christian Peter Hölzel (Autor:in), 2006, Die Möglichkeiten der Länder zur Einflußnahme auf die Europäische Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136983