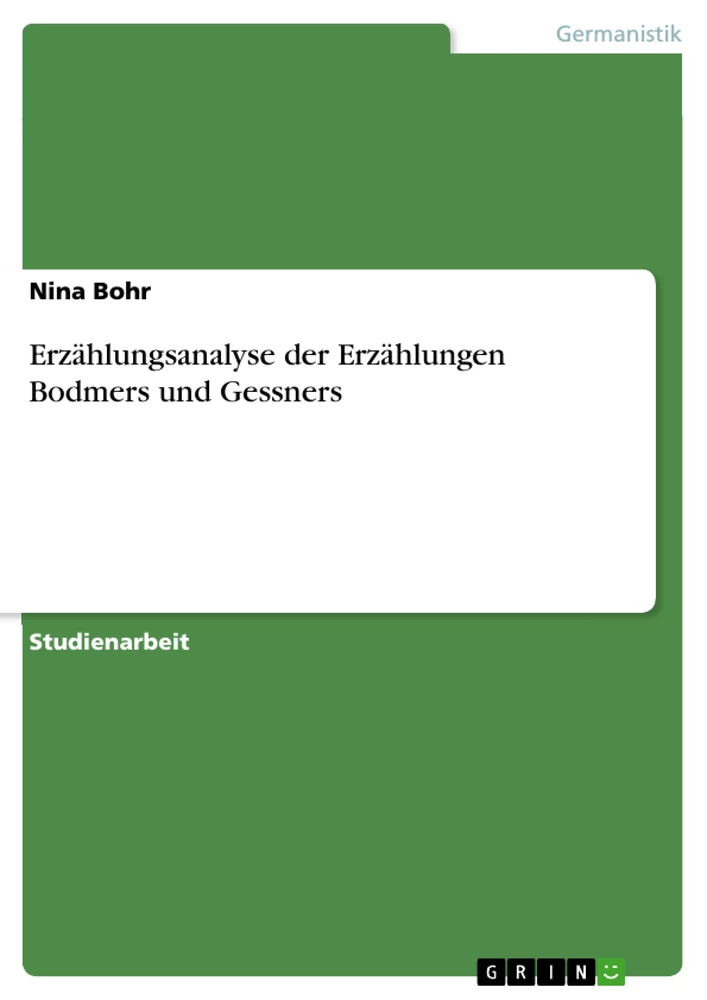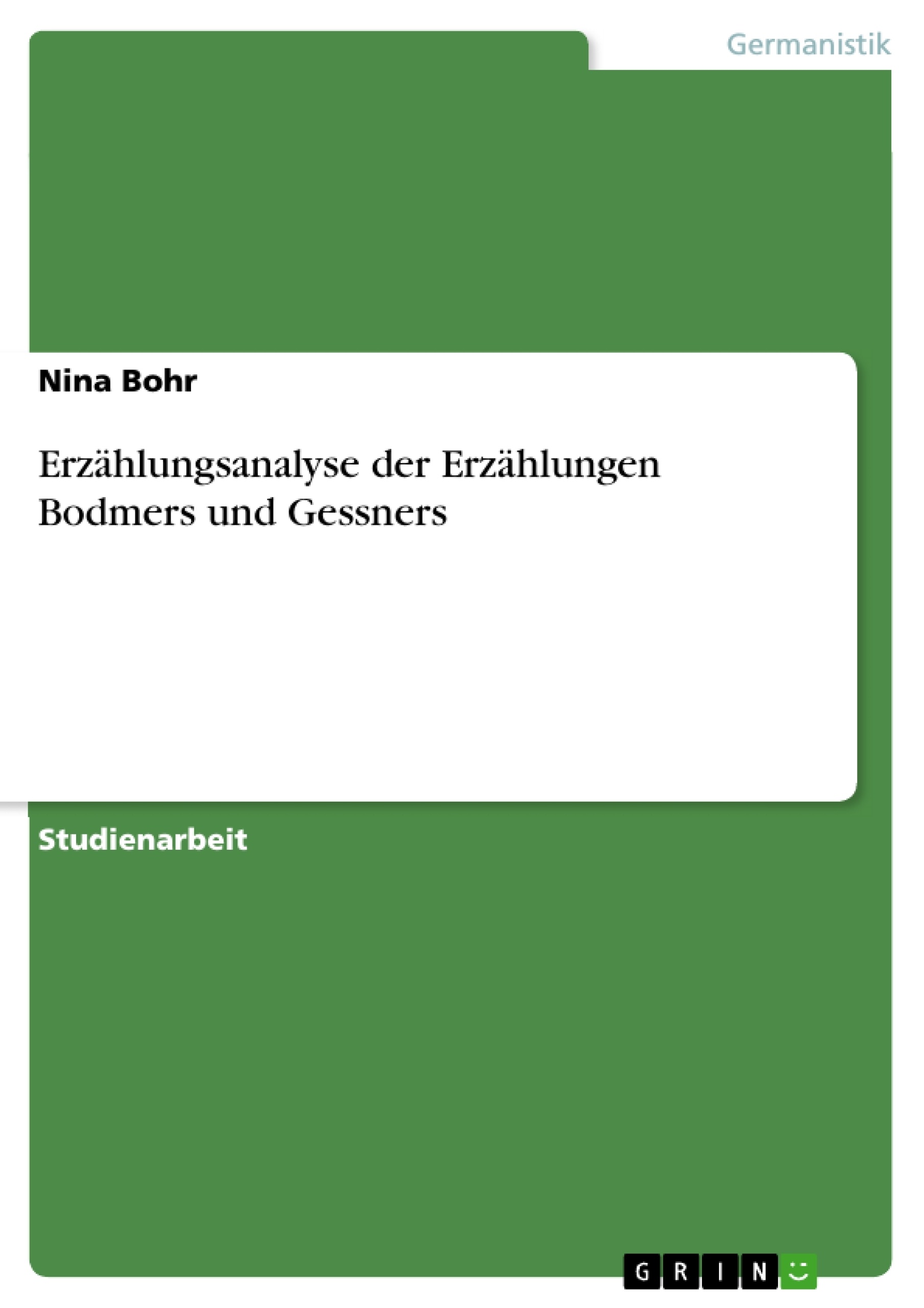Die Darstellung von dramatischen Liebesgeschichten ist scheinbar so alt wie die Menschheit selbst und kommt nie aus der Mode. Die Erzählung „Inkel und Yariko“ von Johann Jacob Bodmer aus dem Jahre 1756 erzählt eine weitere unglückliche Liebesgeschichte; und ganz dem Zeitgeist entsprechend zwischen einer Eingeborenen und einem Europäer. Das Motiv des/ der edlen Wilden ist zu dieser Zeit nicht neu und wurde schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts in der französischen und englischen Literatur verwendet.
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich aber um eine Zusammenstellung von zwei Autoren. Der zweite Teil von „Inkel und Yariko“ von Salomon Gessner aus dem gleichen Jahr scheint eine Art Fortsetzung der dramatischen Geschichte zu sein. Dabei unternimmt Gessner den Versuch, der zuerst tragischen Geschichte eine positive Wendung zu geben.
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Unterschiede zwischen diesen beiden Geschichten zu beleuchten – denn als zwei getrennte Geschichten sollten sie betrachtet werden – und die Intention der beiden Autoren aufzuzeigen. Es wird dabei weniger auf die historische Bedeutung des Begriffes des edlen Wilden noch auf die damit einhergehenden rassischen Argumentationen eingegangen, gleichwohl die damit verbundenen Vorurteile und die beabsichtigte Wirkung der Autoren Thema bleiben. Vielmehr soll der Unterschied zwischen den beiden Stücken – erster und zweiter Teil – herausgearbeitet werden.
Einen guten Überblick über die Bedeutung des vorliegenden Stoffes in der Literatur – speziell für Bühnenstücke – sowie im anthropologischen Gesamtkontext bietet die Doktorarbeit von Isabel Kunz.
1. Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Kulturkritik und Liebesgeschichte – eine Textanalyse
3.1. „Inkel und Yariko“ Zusammenfassung
3.2. Bodmers 1. Teil
3.3. Gessners 2. Teil
3.3.1. Charakteranalyse
3.3.1.1. Die „edle Wilde“ Yariko
3.3.1.2. Der „zivilisierte“ Inkel
3.3.1.3. Der „barmherzige“ Befehlshaber
4. Warum ein Happy End nicht immer sein muss
5. Literaturverzeichnis
„Die Liebe ist die wunderbare Gabe,
einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist.“
Hannelore Schroth
2. Einleitung
Die Darstellung von dramatischen Liebesgeschichten ist scheinbar so alt wie die Menschheit selbst und kommt nie aus der Mode. Die Erzählung „Inkel und Yariko“ von Johann Jacob Bodmer aus dem Jahre 1756 erzählt eine weitere unglückliche Liebesgeschichte; und ganz dem Zeitgeist entsprechend zwischen einer Eingeborenen und einem Europäer.[1] Das Motiv des/ der edlen Wilden ist zu dieser Zeit nicht neu und wurde schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts in der französischen und englischen Literatur verwendet.
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich aber um eine Zusammenstellung von zwei Autoren. Der zweite Teil von „Inkel und Yariko“ von Salomon Gessner aus dem gleichen Jahr scheint eine Art Fortsetzung der dramatischen Geschichte zu sein. Dabei unternimmt Gessner den Versuch, der zuerst tragischen Geschichte eine positive Wendung zu geben.
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Unterschiede zwischen diesen beiden Geschichten zu beleuchten – denn als zwei getrennte Geschichten sollten sie betrachtet werden – und die Intention der beiden Autoren aufzuzeigen. Es wird dabei weniger auf die historische Bedeutung des Begriffes des edlen Wilden noch auf die damit einhergehenden rassischen Argumentationen eingegangen, gleichwohl die damit verbundenen Vorurteile und die beabsichtigte Wirkung der Autoren Thema bleiben. Vielmehr soll der Unterschied zwischen den beiden Stücken – erster und zweiter Teil – herausgearbeitet werden.
Einen guten Überblick über die Bedeutung des vorliegenden Stoffes in der Literatur – speziell für Bühnenstücke – sowie im anthropologischen Gesamtkontext bietet die Doktorarbeit von Isabel Kunz.[2]
3. Kulturkritik und Liebesgeschichte – eine Textanalyse
3.1. „Inkel und Yariko“ Zusammenfassung
Erster Teil von Bodmer:
Bodmers Erzählung beginnt in dem Augenblick, als Inkel, ein europäischer Kaufmann und Schiffbrüchiger auf einer fremden Insel landet. Die Insel ist nicht unbewohnt und so wird Inkel sehr schnell von den eingeborenen Indianern verfolgt, da diese bereits – schlechte – Erfahrungen mit den Europäern gemacht haben. Die Indianerin Yariko ist Teil des Stammes und ihr fällt der Fremde sofort auf. Die Indianerin verbirgt sich vor dem Fremden in den Büschen, da sie ihn beobachten will. Yariko empfindet schnell Mitleid mit dem ausgehungerten und verletzten Inkel und hilft ihm; sie verbirgt ihn vor ihren Stamm und pflegt ihn in einer Höhle gesund und gibt ihm Nahrung. Und so verlieben sich die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und Kultur ineinander.
Doch der romantische Augenblick währt nur kurz und mit der Ankunft eines englischen Schiffes ergibt sich für Inkel die Möglichkeit wieder in die „zivilisierte“ Welt zu fliehen. Inkel beschließt seine Yariko mit sich zu nehmen und „sie in Seide, mit Gold verbrämet“ gekleidet in die europäische Gesellschaft einzuführen.[3] Das Schiff transportiert Sklaven und legt in Barbados an, wo ein Sklavenmarkt stattfindet.
Inkel, nun wieder unter seinesgleichen, wird von der Aussicht auf schnelles Geld korrumpiert und beschließt die Eingeborene Yariko zu verkaufen. Selbst ihr Flehen und der Hinweis auf die Schwangerschaft mit seinem Kind kann Inkel nicht von seiner Geldgier befreien; vielmehr verlangt er nun einen höheren Preis, jetzt da er weiß, dass er „zwei“ Sklaven verkaufen kann.[4]
Zweiter Teil Gessner:
Yariko, die vom Geliebten verkauft wurde, findet in ihrem Käufer einen barmherzigen Weißen. Der Käufer so stellt es sich heraus ist der Gouverneur der Insel. Nachdem er von der Geschichte des betrogenen Mädchens erfährt, empfindet er Mitleid mit ihr.
[...]
[1] Als Vorlage für Bodmers Erzählung diente sehr wahrscheinlich Gellert, Christian Fürchtegott: Inkel und Yariko. In: Fabeln und Erzählungen, Leipzig 1746.
[2] Kunz, Isabel: Der Edle Wilde auf den deutschsprachigen Bühnen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, Inaugural-Dissertation zu Erlangung des Doktorgrades der Philosophie, Ludwig- Maximilians- Universität, München 2007
[3] Hier muss die Seitenzahl hin
[4] Vgl. dazu: Bodmer, Johann Jacob: Inkel und Yariko in: Hollmer, Heide u.a. (Hrsg.): Deutsche Erzählungen des 18. Jahrhunderts, Von Gottsched bis Goethe, München 1988, S. 43-47.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Geschichte von Inkel und Yariko?
Um eine tragische Liebe zwischen einem schiffbrüchigen Europäer (Inkel) und einer Indianerin (Yariko), die ihn rettet und die er später als Sklavin verkauft.
Was unterscheidet die Versionen von Bodmer und Gessner?
Bodmer erzählt den tragischen ersten Teil (Verrat und Verkauf), während Gessner einen zweiten Teil mit einer barmherzigen Wendung (Happy End) verfasste.
Was bedeutet das Motiv des "edlen Wilden"?
Ein literarisches Konzept der Aufklärung, das Naturvölker als moralisch überlegen gegenüber der korrupten europäischen Zivilisation darstellt.
Warum verkauft Inkel seine Retterin Yariko?
Inkel wird durch die Aussicht auf schnelles Geld korrumpiert und stellt seine Gier über seine Gefühle und die Dankbarkeit gegenüber Yariko.
Welche Intention verfolgte Salomon Gessner mit dem zweiten Teil?
Gessner wollte der Grausamkeit Inkels ein Beispiel für Menschlichkeit entgegensetzen und der Geschichte einen moralisch versöhnlichen Abschluss geben.
- Citar trabajo
- Nina Bohr (Autor), 2009, Erzählungsanalyse der Erzählungen Bodmers und Gessners, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137023