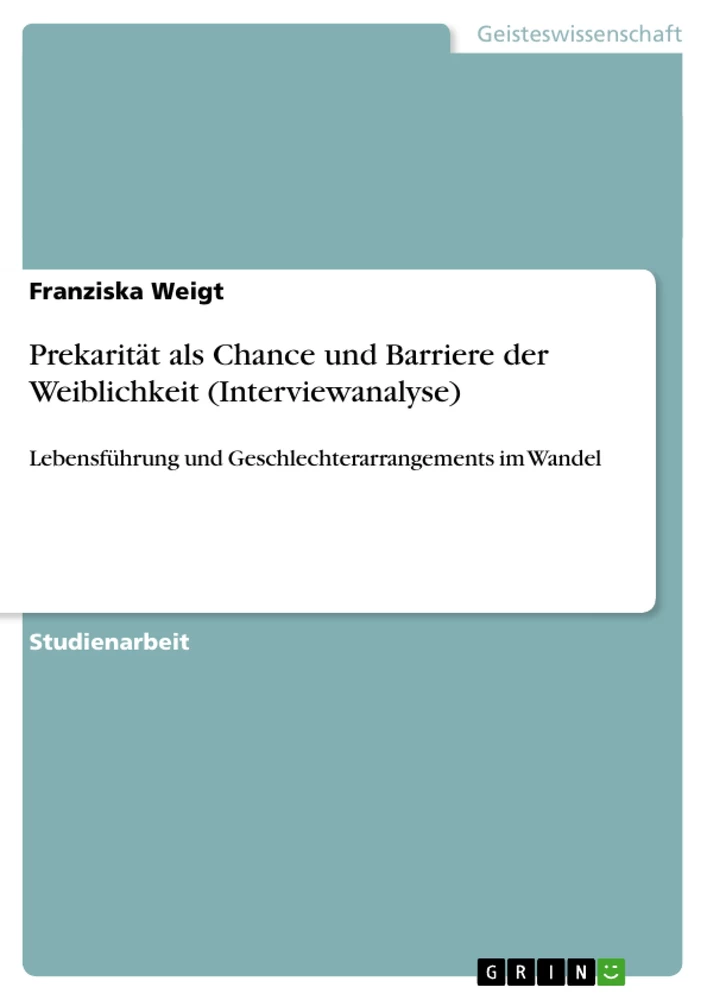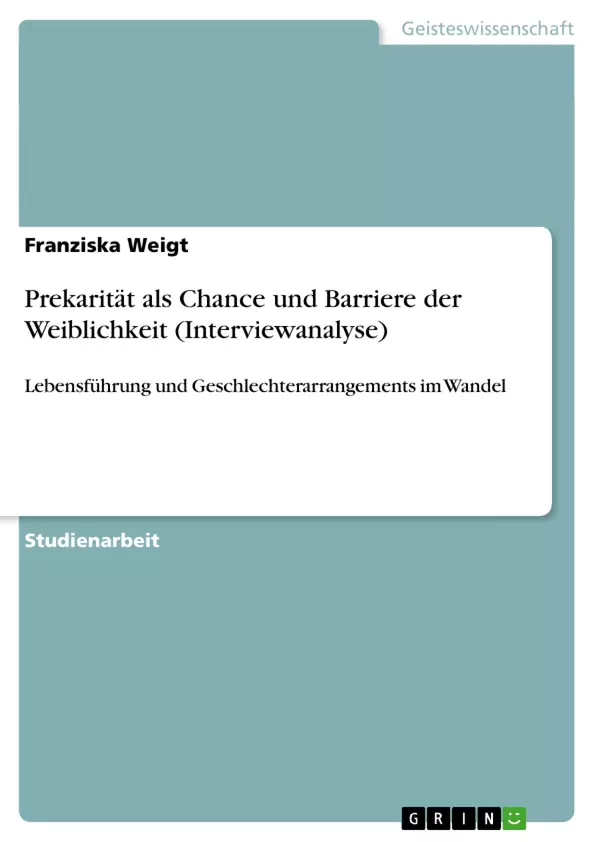Der Arbeitsmarkt ist unsicher geworden. Von den einen als These häufig formuliert, ist sie für Andere Realität. Frauen sind stärker von der Prekarität betroffen, als es bei den Männern der Fall ist. Die Frauen sind in der Schule erfolgreicher, aber in der Berufswelt gegenüber der männlichen Bevölkerung benachteiligt, somit laufen nach Rainer Geißler die guten Bildungschancen nicht analog mit den Berufschancen einer Frau. „In der Arbeitswelt- dem Kernbereich der geschlechtstypischen Ungleichheiten- sind die Männerprivilegien erheblich resistenter als im Bildungssystem.“ (Geißler, 2006, 306)
Die nachstehenden Interviewanalysen, welche nur einen mikrosoziologischen Ausschnitt zu diesem Thema gewährleisten, sollen die Fragen geklärt werden, ob Prekarität für die Frauen als Chance oder als Barriere verstanden wird, hierbei schließt sich die zweite Frage ein, ob eben diese Prekarität in der beruflichen Dimension Einfluss auf das weibliche Rollenverständnis nimmt.
Das methodische Vorgehen gestaltet sich folgendermaßen: Die qualitative Forschung versucht herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt sehen, welche individuelle Bedeutung er für sie hat und welche Handlungsmotive in diesem Zusammenhang auftreten. (siehe www.pze.at) Aus diesen Gründen setze ich mich in dieser Arbeit mit der Thematik der Geschlechterarrangements in prekärer Lebenssituation durch zwei Interviewanalysen auseinander. Die Arbeitsschritte und methodischen Vorgänge, angelehnt an die Grounded Theory nach Anselm L. Strauss und an die Habitus- Hermeneutik, werden sich folgendermaßen gliedern: nach der Vorstellung des Interviews (3.) durch eine Kurzbiografie (3.1.) und der Kategorienbildung anhand des offene Kodierens (3.2.), wird das Interview anhand verschiedener Arbeitsschritte analysiert und interpretiert (4.). Hierbei werden Arbeits(hypo)thesen aufgestellt (4.1.) und anschließend das axiale Kodieren durchgeführt, wobei die Schlüsselkategorien näher betrachtet werden und das Entwickeln von Habitusmustern im Vordergrund stehen soll (4.2.) Im Kapitel 5 ist der Fallvergleich mit dem zweiten Interview zentral. Der Fall wird ebenfalls kurz dargestellt (5.1.) und nach Strauss das „Theoretical Sampling“ durchgeführt (5.2.), d.h. die beiden Interviews werden in Bezug zu den aufgestellten Arbeitshypothesen gesetzt. Hier werden dann Differenzen und Parallelitäten herausgearbeitet. Im Schlussteil dieser Arbeit werden dann zusammenfassende Ergebnisse präsentiert (6.).
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methodisches Vorgehen
3. Vorstellen des Interviews
3.1. Kurzbiografie
3.2. Kategorienbildung: offenes Kodieren
4. Interviewanalyse
4.1. Arbeitshypothesen und Arbeitsthesen
4.2. Axiales Kodieren: die Schlüsselkategorien näher Betrachten und das Entwickeln von Habitusmustern
5. Fallvergleich
5.1. Fallbeschreibung des zweiten Interviews
5.2. „Theoretical Sampling": Parallelitäten und Differenzen vom ersten Interview mit dem Zweiten
6. Fazit
7. Anhang
7.1. Kurzbiografie
7.2. Kodierschema
7.3. Zusammenfassung Kodes- Kategorien-Schlüsselkategorien
8. Literaturangaben
Die in dieser Arbeit verwendeten Interviews sind aus dem Projekt „Lebensführungen und Geschlechterarrangements im Wandel, bezogen auf die Aneignungspraktiken gesellschaftlicher Umbrüche am Beispiel von Beschäftigten im (ostdeutschen) Einzelhandel". Das zentrale Interview ist das Interview 8 und das Kontrastierende Interview 6. Bei den Interviewzitaten k6nnen Rechtschreibfehler auftauchen, weil diese im Transkript so angegeben waren. Ich habe sie so übernommen.
1. Einleitung
Das in dieser Arbeit vorgestellte Interview, sowie das fallvergleichende Interview, entstand im Rahmen eines Projekts zum Thema Lebensführungen und Geschlechterarrangements im Wandel, bezogen auf die Aneignungspraktiken gesellschaftlicher Umbrüche am Beispiel von Beschäftigten im (ostdeutschen) Einzelhandel. Der Gegenstand dieses Projekts waren die alltäglichen Deutungen und Praktiken von Beschäftigten, welche in einem niedrig qualifizierten, eher weiblichen konnotierten Arbeitsmarktbereich, den Veränderungen innerhalb der Erwerbstätigkeit gegenüberstanden. Die Veränderung des Arbeitsmarktes ist eine gesamtgesellschaftliche Problematik, aber der Umgang dessen ist auf der Mirkoebene subjektiv. Demnach arrangieren sich Menschen mit dem Arbeitsmarktwandel, in dem sie geringfügige, nicht zukunftssichernde Beschäftigungsverhältnisse eingehen, auch ein hohes Mall an Arbeitszeitflexibilität in Kauf nehmen, um ihre Existenz zu sichern. Die prekäre, d.h. unsichere Lebenslage beeinflusst auf erster Ebene die Einstellung zum Beruf bzw. die Arbeitsmoral, sie verändert das Bewusstsein von Familie und deren Vereinbarkeit mit dem Beruf und nicht zuletzt auf dritter Ebene vollzieht sich eine Umorientierung des Geschlechterarrangements.
Der Untersuchungsgegenstand bezieht sich demnach auf milieuspezifische Lebensführungen und Geschlechterarrangements. Das Untersuchungsfeld konzentriert sich auf den ostdeutschen Einzelhandel und die Perspektive ist dabei subjektorientiert. Die durchgeführte Studie ( 2004 und 2005/06) umfasste 25 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters mit einer überwiegend ostdeutschen Biografie. Dabei wichen die Familien- und Lebensformen voneinander ab.
Der Arbeitsmarkt ist unsicher geworden. Von den einen als These häufig formuliert, ist sie für Andere Realität. Vor allem für die ältere Bevölkerung und hauptsächlich für die Frauen. Heutzutage tragen eine geringe Bildung, sprich keinen Schul- beziehungsweise Ausbildungsabschluss, die Unterbrechung des Berufes wegen der Familienplanung und nicht zuletzt die mangelnde Bereitschaft für Flexibilität in der Arbeitswelt dazu bei, dass der Arbeitsmarkt eher als Barriere in der individuellen Lebensführung angesehen wird. Hierbei werden die Frauen noch heute stärker benachteiligt als die Männer. Bei dieser Problematik ist es zweitrangig, ob ein arbeitsmarktrelevanter Abschluss vorhanden ist oder nicht. Frauen sind stärker von der Prekarität betroffen, als es bei den Männern der Fall ist. Die Frauen sind in der Schule erfolgreicher, aber in der Berufswelt gegenüber der männlichen Bevölkerung benachteiligt, somit laufen nach Rainer Geilller die guten Bildungschancen nicht analog mit den Berufschancen einer Frau. „In der Arbeitswelt- dem Kernbereich der geschlechtstypischen Ungleichheiten- sind die Männerprivilegien erheblich resistenter als im Bildungssystem."[1]
Die nachstehenden Interviewanalysen, welche nur einen mikrosoziologischen Ausschnitt zu diesem Thema gewährleisten, sollen die Fragen geklärt werden, ob Prekarität f a r die Frauen als Chance oder als Barriere verstanden wird, hierbei schliellt sich die zweite Frage ein, ob eben diese Prekarität in der beruflichen Dimension Einfluss auf das weibliche Ro l enverständnis nimmt.
2. Methodisches Vorgehen
Die qualitative Forschung versucht herauszufinden, wie Menschen einen Sachverhalt sehen, welche individuelle Bedeutung er fiir sie hat und welche Handlungsmotive in diesem Zusammenhang auftreten. [2] Aus diesen Griinden setze ich mich in dieser Arbeit mit der Thematik der Geschlechterarrangements in prekärer Lebenssituation durch zwei Interviewanalysen auseinander. Die Arbeitsschritte und methodischen Vorgänge, angelehnt an die Grounded Theory nach Anselm L. Strauss und an die Habitus- Hermeneutik, werden sich folgendermallen gliedern: nach der Vorstellung des Interviews (3.) durch eine Kurzbiografie (3.1.) und der Kategorienbildung anhand des offene Kodierens (3. 2.), wird das Interview anhand verschiedener Arbeitsschritte analysiert und interpretiert (4.). Hierbei werden Arbeits(hypo)thesen aufgestellt (4.1.) und anschliellend das axiale Kodieren durchgefiihrt, wobei die Schliisselkategorien näher betrachtet werden und das Entwickeln von Habitusmustern im Vordergrund stehen soll (4. 2.) Im Kapitel 5 ist der Fallvergleich mit dem zweiten Interview zentral. Der Fall wird ebenfalls kurz dargestellt (5.1.) und nach Strauss das „Theoretical Sampling" durchgefiihrt (5. 2.), d.h. die beiden Interviews werden in Bezug zu den aufgestellten Arbeitshypothesen gesetzt. Hier werden dann Differenzen und Parallelitäten herausgearbeitet. Im Schlussteil dieser Arbeit werden dann zusammenfassende Ergebnisse präsentiert (6.).
3. Vorstellen des Interviews
3.1. Kurzbiografie
Die private Lebenssituation der mir vorliegenden Interviewperson schildert sich folgendermallen. Sie ist weiblich und 195 2 geboren und somit zum Interviewzeitpunkt 5 2 Jahre alt. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Sie hat einen Sohn, der 1977 geboren wurde. Erst danach lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie 15 Jahre verheiratet war, bevor sie sich scheiden liell. Seit 1998 hat sie einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite. Er ist Heizungsinstallateur mit Meisterausbildung, aber aufgrund der schlechten Auftragslage des Betriebes momentan arbeitslos. Sie ist zufrieden mit ihrer Berufstätigkeit und auch mit ihrem Privatleben. Sie hat zur Zeit der Befragung erst seit vier Jahren ihren Fiihrerschein, um selbstständiger zu sein.
Sie hat die Schule nach der neunten Klasse verlassen, da sie aufgrund eines Wiederholungsjahres ihre zehn Jahre Schulpflicht absolviert hatte. Sie begann nach der Schule 1969 eine Ausbildung zur Schneiderin und schloss diese erfolgreich ab und war acht Jahre in diesem Beruf tätig. Als ihr Sohn zur Welt kam, beendete sie ihre Tätigkeit als Schneiderin, um in der Buchhaltung tätig zu werden. Im Jahr 1989 kündigte sie die Stelle in der Buchhaltung, um erneut privat ihrem gelernten Beruf nachzukommen, doch aufgrund der schlechten Auftragslage in dieser Branche, da die innerdeutschen Grenzen geöffnet wurden, entschied sie sich wiederum für eine Umschulung zur Buchhalterin und bekam, durch eine Freundin vermittelt, eine Arbeitsstelle in einem Steuerbüro in Westberlin, wo sie wieder acht Jahre tätig war. Durch die geringer gewordene Arbeitslage wurde sie gekündigt. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Konstitution nahm sie eine Rehabilitationsmallnahme (Kur) in Anspruch. Anschliellend bewarb sie sich auf die Stelle im Stoffgrollhandel und bekam diese. Demgemäll ist sie seit dem Jahr 2000 in diesem Unternehmen tätig. Sie arbeitet Teilzeit, sprich 30 Stunden in der Woche, wobei sie von Montag bis Mittwoch Vollzeit arbeitet, im Ausgleich dazu aber Donnerstag und Freitag frei hat. Sie führt gern ihre Tätigkeit aus, d.h. ihre Aufgabenfelder machen ihr Spall und in ihrem Kollegium, was eher von Männern dominiert ist, fühlt sie sich akzeptiert und wohl .
3.2. Kategorienbildung: offenes Kodieren
Zunächst einmal wird das offene Kodieren praktiziert, da es der erste Schritt ist, sich dem Interview zu nähern. Dabei wird das Interview auf zentrale Kodes hin ergründet, um aus diesen Kodes Kategorien zu bilden, welche ein Netzwerk bilden und mit denen Schlüsselkategorien erschlossen werden können, die dann wiederum in Beziehung zueinander gesetzt und in andere Zusammenhänge integriert und analysiert werden können.
Zum Beginn des Interviews, d.h. in der Eingangssequenz, wird die Interviewte hinsichtlich ihres Betriebes befragt, d.h. mit welchen Gütern und Waren der Betrieb handelt und warum ihr die Arbeit gefällt. Sie ist in einem Grollhandel für Textilstoffe tätig. Sie gibt einerseits Angaben zur ihren Arbeitszeiten und auf der anderen Seite über ihren Aufgabenfeldern. Eine Beschreibung des Arbeitsumfeldes, sprich wer in diesem Betrieb tätig ist, und Aussagen über Zufriedenheit mit dieser Arbeit, schliellt sich an. Die zusammengetragenen Kodes aus dem Interview lassen sich demgemäll als Kategorie zusammenfassen: „ Beschreibung der gegenw a rtigen beruflichen Situ a tion".
Weiter offenbart die Interviewte ihre geringe Lernbereitschaft, in dem sie zwar Fehler einsieht und sich auch entschuldigt, diese aber auf ihr Alter zurückführt. Sie meint aber auch: „Peanuts! Sag ick mir. Jibt schlimmere Sachen, find icke jedenfa l s, So se ick dit, und ick bin so'n Leck-misch-am- Arsch, so (Fauchen), so...(Lachen). Naja, wat so l ick denn dazu sagen? Wenn ick'n Fehler mache, mehr als entschuldigen kann man sich nicht." (14/458-461) Daraus entsteht ein Gerechtigkeitsprinzip, welches auf individuelle Erfahrungen und Lebenssituation der interviewten Person zurück zu schliellen ist. Einerseits geht sie gern arbeiten, ist zufrieden mit ihrer Arbeit, doch als sie arbeitslos war, wollte sie „(...) eigentlich 2000 mal so richtig een uff faul machen, mal so uff arbeitslos, arbei... mal so"n bisschen wat zuverdienen, ne? Weil- ick dachte, naja, jetzt haste "n paar Jahre eingezahlt, jetzt kannste och mal"n Jahr zuhause bleiben, aber dit war leider nicht so." (5/ß4-ß8) Hier zeigt sich keine Schamgrenze. Diese Kodes können als Kategorie „Arbeitseinstellung" zusammengefasst werden. Die berufliche Neuorientierung als Verkäuferin in einem Grollhandel konnte sie nach gesundheitlicher Rehabilitation (Gesundheit) im Jahr 2000 umsetzen. Des Weiteren berichtet sie, dass sie nach ihrer Geburt des Sohnes 1977, den Schneiderberuf, den sie nach einem neunten Klasse Abschluss, als Ausbildung im Bereich Damenoberbekleidung erfolgreich erlernte und acht Jahre lang in diesem Beruf tätig war, aufgab, um in der Buchhaltung zu arbeiten. Die Dualität zwischen den Berufen der Schneiderin und der Buchhalterin, vollzieht sich im gesamten Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn. Sie wechselt mehrmals beruflich zwischen B üro und Handwerk, und versucht sich vor der Wende wieder mit dem erlernten Beruf. Die schlechte Auftragslage nach der innerdeutschen Grenzöffnung lässt sie arbeitslos werden und sie entscheidet sich für eine Umschulung zur Buchhalterin. Sie bekam eine Stelle in Westberlin, vermittelt durch eine Freundin. Diese Kodes fasse ich zu der Kategorie „schulischer und beruflicher Werdegang" zusammen. Die Kategorie „Fähigkeiten im Arbeitsleben" gliedert sich in Flexibilität und monotone Arbeitsweisen, aber auch in Lernschwierigkeiten und persönliche Arbeitsansprüche. Sie berichtet, dass sie viel Zeit benötige, um Neues zu erlernen, sie hat regelrecht Horror (vgl. 23f./754-764) davor: In diesem Zusammenhang erzählt die Interviewte, dass ihr nach der Wende persönliche A ngste plagten, aus diesem Grund trug sie ein „Spray" zur Selbstverteidigung mit sich. Die Angst legte sich, aber die Existenzangst aufgrund des wenig zu Verfügung stehenden Geldes, manifestierte sich über einen längeren Zeitraum.
Sie blickt zurück auf die Zeiten in der DDR und berichtet über die unsicheren Lebensverhältnisse während des sozialistischen Systems. Die Zufriedenheit innerhalb dieses Systems bezog sich besonders auf die Kindheit und Jugend, denn sie bejahte auch eine Nonkonformität zum DDR- System. Sie zeigt eine Risikobereitschaft, da sie gern in den Westen geflohen wäre. Sie vergleicht auch die Arbeitsverhältnisse im Osten und Westen und thematisiert die Unko l egialität im Westen. Diese Kodes können als Kategorie „Systembruch" verstanden werden.
Die Interviewfragen bezogen auf Arbeitswelt gingen voran, bevor Fragen zum Privaten kamen. Die Interviewte vermischt Arbeit und Privates häufig miteinander, sodass hier eine Kodierung und Kategorisierung hilfreich ist. Sie hat ein uneheliches Kind, denn vom Vater des Kindes trennte sie sich zwei Jahre nach der Geburt dessen, danach lernte sie ihren Mann kennen, der vier Jahre jünger war als sie. Sie heirateten und liellen sich 15 Jahre später wieder scheiden. Die interviewte Person zeigt eine kontrastierende Haltung zu dieser Ehe: „(...) [ li ck muss sagen, ick hab eigentlich keene schlechte Ehe jeführt, also wenn ick nun...- ick sag mir immer, ne schlechte Ehe is wenn man verprügelt wird, wenn man sich gegenseitig die Köppe einschlägt und so, sowat war... gab's bei uns einfach, nich, ja?" ( 20f./659-66 2) Sie spricht den Wohnraummangel an, und welche Probleme sich daraus ergaben. Nach der Scheidung wandelte sich ihre persönliche Lebenseinste l ung. Dies äullerte sich in Existenzängste. Aber sie war zufrieden nach der Scheidung und die Einste l ung zum Exehemann war/ist seitdem keine Gute. „(...) [M il t Geld konnte mein Mann nie umgehene, überhaupt nicht- und-- ich hätte dit schon eher machen so l en, aber dit- is halt so, dit hat eben halt so lange jedauert. Dit is ja... und jetz is och n üscht aus ihm jeworden, der hat keene Arbeit, der hockt bei seine Mama, keene Frau, der hat n üscht mehr, wa? Der is total mitte l os. Dit is ne richtje arme Sau, aber saufen kann er trotzdem." (28/919-9 23) Diese Kodes werden zusammengefasst zur Kategorie „Partnerschaftsgeschichte". Anschliellend an den Reflektionen ihrer Vergangenheit mit ihrem Exehemann und deren involvierten Erfahrungen und Erkenntnissen, nimmt sie Bezug auf ihren neuen Partner und erzählt Ober die spezifische Ro l enverteilung innerhalb dieser Partnerschaft und meint: „(...) [ li ck muss sagen, seitem ick den den kenne, koch ick jerne, back ick jerne, mach ick jerne sauber, nähe, mach a l et möglich, schlafe mit ihm jerne ähm, wir machen fast a l et jemeinsam, ick mach och mein eignet Ding (...)." (17/546-549) Sie bezeichnet sich als zufrieden, auch mit der Arbeitsteilung und der Ro l enverteilung in ihrer neuen Beziehung. Diese Kodes wohnen der Kategorie „ Vorstellungen und gegenwärtige Praxis der Partnerschaft" bei. Dieser Kategorie schliellt sich die Frage an, welche „ Vorstellung und Praxis zur Elternschaft, d.h. zu Mutter- und Vaterschaft" die Interviewte hat. Sie berichtet Ober den beruflichen Einfluss auf die Kindererziehung und dass es schwierig ist, wenn beide Elternteile arbeiten gehen und eine erhöhte Schwierigkeit aufkommt, wenn ein Elternteil in Schichtdienst tätig ist. Es treten daher Probleme und Koordinierungsschwierigkeiten bezogen auf die Kindergartenöffnungszeiten auf: wer bringt das Kind weg, wer holt es. In ihrer Ehe war sie die Alleinige, die das Kind hingebracht und abgeholt hatte. Sie spricht ein zweites Kind an, „wat [nach ihren Worten] denn nachher nichts mehr war." ( 20/640) Ebenso erläutert sie den Vater- Sohn- Konflikt zwischen ihren Ehemann, der der Stiefvater ihres Sohnes war. Die Interviewte kritisiert den Befehlston gegenOber ihrem Sohn. Sie hat eine klare Vorste l ung von der Erziehung, wobei sie Wert auf das Geregelte innerhalb der Erziehung legt. Diese drei zuletzt erläuterten Kategorien, werden als Kategorie „Lebensformen" zusammengefasst.
Im Interview wird gefragt, wie sich das Private zur Arbeit verhält. Die Interviewte macht einerseits Angaben dazu, als das Kind noch im Haushalt lebte, wobei sie eine Trennung zwischen Arbeit und Privates trifft. Die persönliche Zeit fOr sich oder ihren Partner stellt sie hinten an, denn sie sagt, dass das Private sehr kindzentriert gewesen war. Seit ihr Sohn nicht mehr zuhause wohnt, hat sie die Hausarbeit allein Obernommen, obwohl sie angibt, dass weniger zu tun ist, wenn kein Kind im Haushalt lebt. Diese Kodes lassen sich zur Kategorie „ Verkniipfung und Arrangements von Arbeit und Leben" zusammenschliellen. Die interviewte Person lebt nicht nach traditionellen Ro l enverteilung zwischen Mann und Frau. Sie sagt aber, dass sie mehr im Haushalt erledigt als ihr Lebensgefährte, meint aber zudem, dass sie viel gemeinsam (Partnerbezogenheit) erledigen. Ihre Selbstständigkeit macht sich dennoch bemerkbar. Diese Kodes lassen sich zuriickzufiihren auf die Kategorie „Lebensfiihrung".
Ihre Selbstständigkeit und der innewohnende Ehrgeiz werden ersichtlich, wenn man den Fiihrerschein anspricht, den sie vor einigen Jahren erst erworben hat. Sie will nicht abhängig sein. Sie hat keine Heiratsabsichten mit ihrem neuen Partner, aber Urlaubswiinsche, wobei sie hier einerseits sagt, sie will in den Urlaub mit ihrem Lebensgefährten und andererseits meint sie, sie bräuchte kein Urlaub. Sie spricht oft iiber ihre Einste l ung zur Bevölkerungsentwicklung, zu Geld und Verdienste und die inharänten Unterschiede im Gehalt von ost- und westdeutschen Arbeitnehmern. Hier wird ein Gerechtigkeitsgefiihl von ihr ersichtlich, wo sie meint, dass im Osten die Einkommensverteilung gleich war, nur „Stasileute" mehr Geld als andere hatten. Seit der Grenzöffnung ist die Einkommensverteilung unterschiedlich und eine grolle Differenz zwischen arm und reich erkennbar. Als Kategorie dieser Kodes lässt sich das „ Verhältnis zur Zukunft" benennen. Die Interviewte sagt, dass sie keine Existenzangst hat, denn der Umsatz im Betrieb ist im positiven, aufstrebenden Bereich. Nur das Verhältnis zum Chef gegen iiber den Arbeitnehmer i nnen muss ständig aufrechterhalten werden, wo sie ihre eigene Strategie entwickelt: „Und wenn man sich bereitwi l ig erklärt... man muss och"n bisschen so den Chef "n bisschen so umgarnen und so, wa?" (13/411f.) Hier fullt die Kategorie „Prekariat im Sinne von Entsicherung bzw. Entstrukturierung ".
Abschliellend wird im Interview auf ihr Einstellung zu „ Frauen in Ostdeutschland und die Doppelbelastung von Beruf und Familie" eingegangen. Anfangs versteht sie die Frage nicht und meint nach einer Erklärung, dass sie kaum eine Frau mit Kind(er) kennt, auller ihrer Schwägerin. Ihre Meinung ist, dass eine Varianz innerhalb der Kindererziehung von berufstätigen und nicht berufstätigen Miittern existiert, d.h. sie ist der Meinung, dass man trotz Kind arbeiten kann und wenn es nur ein Zuverdienst ist. Die Vereinbarkeit von Familie (insbesondere mit Kindern) und Beruf, sieht sie zwar als schwierig, aber machbar, an. Ihre Arbeitsmoral lehnt sich an Erfahrungen als Mutter und ihre Vergangenheit in der DDR an.
Sie fand ihre Kindheit und Jugend im Osten schön, sie war nur unzufrieden mir ihrer Ehe und bereut es, dass sie sich nicht hat friiher scheiden lassen. Die Dualität von Vergangenheit und Zukunft wird ersichtlich, indem sie äullert, dass ihre Ehe nicht gut war und trotzdem mit dem Lebensverlauf, so wie er war und ist, gut war und sie es nicht anders wollte. Hier zeigt sich erneut eine Ambivalenz ihrer Aussagen bez iiglich ihres Lebenslaufes. Sie ist jetzt zufrieden und muss nichts mehr erreichen. Als Kategorie kann hier ihre „normativen Einstellungen" benannt werden.
[...]
[1] Geilller, 2006, 306)
[2] siehe www.pze.at
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Prekarität im Kontext dieser Arbeit?
Prekarität bezeichnet unsichere, nicht zukunftssichernde Beschäftigungsverhältnisse, die oft mit hoher Flexibilität und geringem Einkommen einhergehen.
Warum sind Frauen stärker von Prekarität betroffen?
Trotz oft besserer Bildungschancen sind Frauen im Beruf benachteiligt, unter anderem durch Familienplanung und die Resistenz männlicher Privilegien am Arbeitsmarkt.
Welche methodischen Ansätze werden zur Analyse genutzt?
Die Arbeit nutzt die Grounded Theory nach Strauss sowie die Habitus-Hermeneutik zur Interpretation von Interviewtranskripten.
Wird Prekarität eher als Chance oder als Barriere gesehen?
Die Interviewanalysen untersuchen subjektiv, ob Frauen die Unsicherheit als Möglichkeit zur Neuorientierung oder als Hindernis in ihrer Lebensführung wahrnehmen.
Was ist "Theoretical Sampling" in dieser Studie?
Es ist der Fallvergleich zwischen zwei unterschiedlichen Interviews, um Differenzen und Parallelitäten in den Geschlechterarrangements herauszuarbeiten.
- Arbeit zitieren
- Franziska Weigt (Autor:in), 2008, Prekarität als Chance und Barriere der Weiblichkeit (Interviewanalyse), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137070