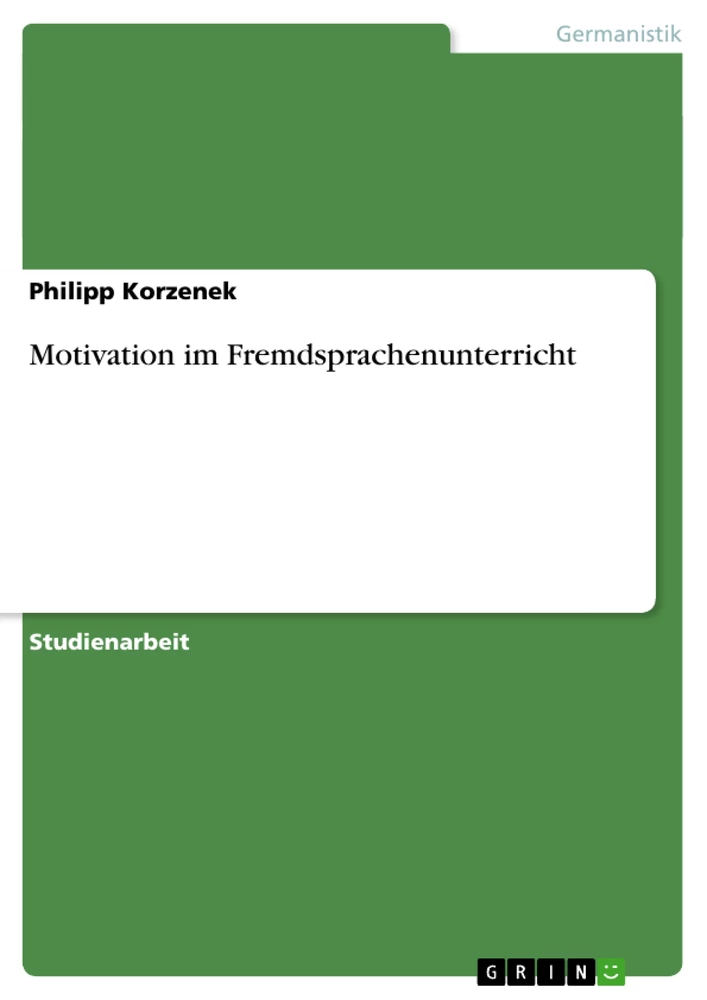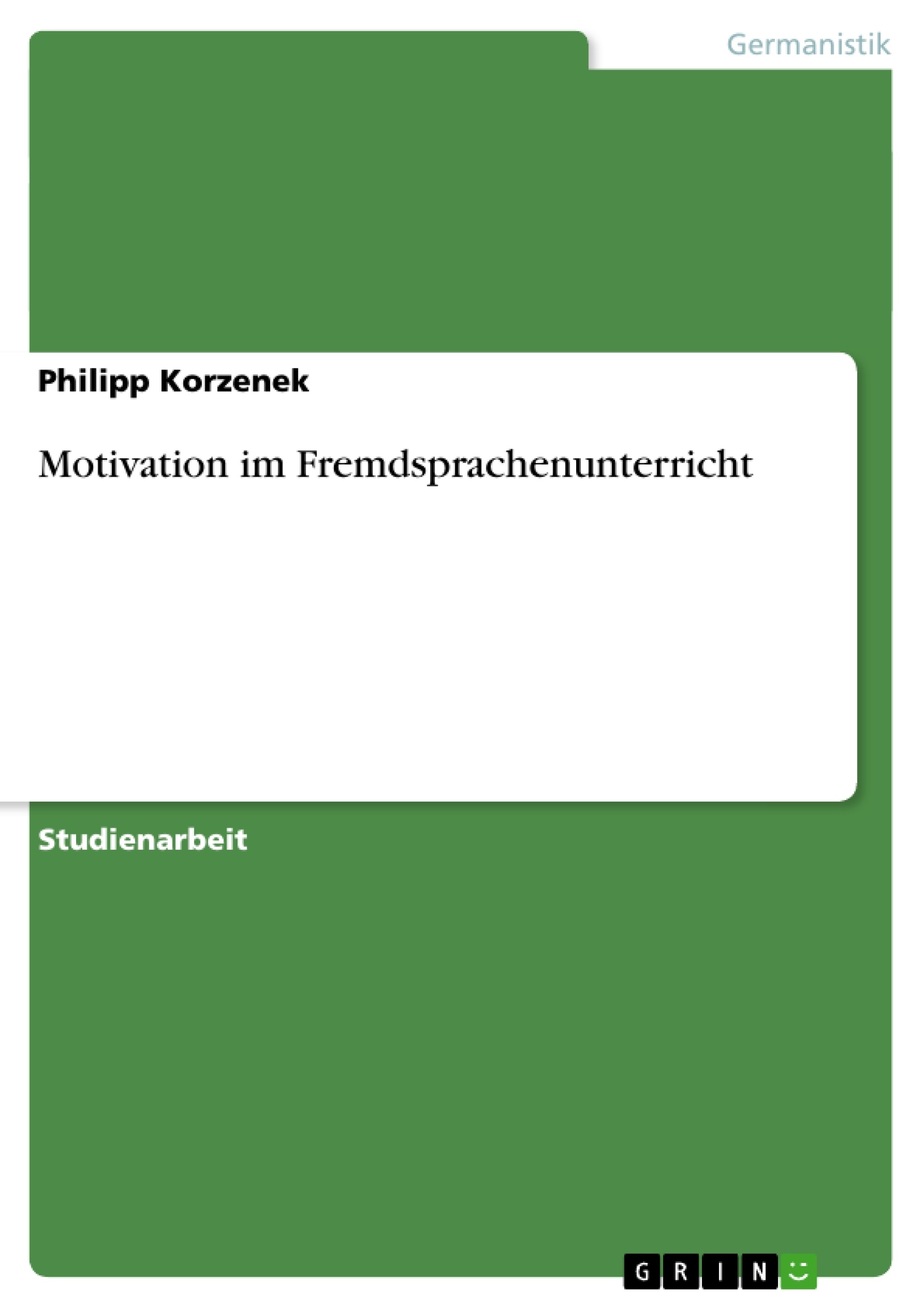In Zeiten von immer wiederkehrenden Bildungsreformen und Protesten gegen die Schulgesetze der jeweiligen Bundesländer und kritischen Medienberichten über die materiellen und personellen Zustände der deutschen Bildungseinrichtungen gerät auch der Unterricht selbst immer mehr ins Visier der Kritiker. Die Unterrichtsbedingungen seien katastrophal, die Lehrkräfte oft unzureichend ausgebildet und die Situation im Unterricht weder für Lehrer noch für Schüler förderlich. Vor allem der Begriff „Motivation“ wird in diesem Zusammenhang stetig erwähnt. „Das die Motivierung des Lernenden gerade auch im Fremdsprachenunterricht ein besonderes und auch besonders schwieriges Problem darstellt, ist unumstritten . Beleg hierfür sind nicht nur die an Zahl und Qualität zunehmenden empirischen Untersuchungen, sondern ist auch die Tatsache, dass es kaum noch eine Diskussion über die Praxis der Fremdsprachenvermittlung gibt, in der der Begriff „Motivation“ nicht auftaucht.“ (Solmecke, 1983, S. 7). Nun stellt sich jedoch die Frage, ob Motivation allein das fehlende Stück ist, welches das Lernen einer Fremdsprache oft so schwierig macht? Um diese Frage zu beantworten zu können, müssen entscheidende Faktoren der Motivation erörtert werden. In der vorliegenden Arbeit soll eine Betrachtung der Einflussfaktoren der Motivation vorgenommen und mögliche fremdsprachendidaktische Konsequenzen dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Faktoren der Motivation im Fremdsprachenunterricht
2.1 Definition
2.2 Lernerinterne Faktoren
2.3 Lernerexterne Faktoren
3. Fremdsprachendidaktische Konsequenzen
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In Zeiten von immer wiederkehrenden Bildungsreformen und Protesten gegen die Schulgeset-ze der jeweiligen Bundesländer und kritischen Medienberichten fiber die materiellen und per-sonellen Zustände der deutschen Bildungseinrichtungen gerät auch der Unterricht selbst im-mer mehr ins Visier der Kritiker. Die Unterrichtsbedingungen seien katastrophal, die Lehr-kräfte oft unzureichend ausgebildet und die Situation im Unterricht weder fir Lehrer noch fir Schiller förderlich. Vor allem der Begriff „Motivation" wird in diesem Zusammenhang stetig erwähnt. „Das die Motivierung des Lernenden gerade auch im Fremdsprachenunterricht ein besonderes und auch besonders schwieriges Problem darstellt, ist unumstritten . Beleg hierf>r sind nicht nur die an Zahl und Qualität zunehmenden empirischen Untersuchungen, sondern ist auch die Tatsache, dass es kaum noch eine Diskussion über die Praxis der Fremdsprachen-vermittlung gibt, in der der Begriff „Motivation" nicht auftaucht." (Solmecke, 1983, S. 7). Nun stellt sich jedoch die Frage, ob Motivation allein das fehlende Stück ist, welches das Ler-nen einer Fremdsprache oft so schwierig macht? Um diese Frage zu beantworten zu können, müssen entscheidende Faktoren der Motivation erörtert werden. In der vorliegenden Arbeit soll eine Betrachtung der Einflussfaktoren der Motivation vorgenommen und mögliche fremdsprachendidaktische Konsequenzen dargelegt werden.
Zunächst soll in Kapitel 2 der Terminus Motivation definiert und kurz erklärt werden, was darunter zu verstehen ist. Des Weiteren sollen aus fremdsprachendidaktischer Perspektive ent-scheidende Faktoren der Motivation vorgestellt und näher erläutert werden. Hierbei handelt es sich um die lernerinternen und lernerexternen Faktoren, welche in separaten Abschnitten un-tersucht werden.
Das Aufzeigen von möglichen fremdsprachendidaktischen Konsequenzen soll in Kapitel 3 er-folgen. Hierfiir werden Schlussfolgerungen aus den zuvor ermittelten Problemfeldern der Mo-tivationsfaktoren gezogen und kurz dargelegt .
In Kapitel 4 soll ein Fazit formuliert werden, inwieweit und ob Motivation fir das Gelingen des Fremdsprachenunterrichts verantwortlich sein könnte.
2. Faktoren der Motivation im Fremdsprachenunterricht
2.1 Definition
Laut Duden ist „Motivation" die Gesamtheit der Beweggriinde, Einfliisse, die eine Entschei-dung, Handlung o.A. beeinflussen oder dazu anregen (vgl. Duden, 2001, S. 1102). Wie diese Definition bereits erahnen lasst, kann dieser Begriff sehr vielfaltig angewendet werden. Auch Zoltan Dörnyei ist der Meinung, dass „Motivation" ein groBer Uberbegriff sei, der eine Viel-zahl von Bedeutungen abdecke (vgl. Dörnyei, 2001a, S.1). Folglich macht ebendiese mannig-faltige Anwendung dieses Ausdrucks eine klare und deutliche Eingrenzung schier unmöglich. Diese Komplexitat ist demzufolge auch im Bereich des Fremdsprachenunterrichts zu finden. Ob der Lernende der Zielkultur gegeniiber Vorurteile hegt, ob er sich vom Fremdsprachenler-nen Nutzen verspricht, ob die Personen seines sozialen Umfeldes den Fremdsprachenerwerb als wichtig erachten, ob er fiir den Lehrer Sympathie empfindet oder ob diverse grammatische Phanomene stundenlang erklart werden. Letztlich sind all jene Dinge in einer bestimmten Weise mit dem Begriff „Motivation" verbunden (vgl. Solmecke, 1983, S. 7). Daraus er-schlieSt sich, dass Motivation von vielen Faktoren abhangig ist. Im Folgenden wird versucht jene Faktoren zu kategorisieren und zu erlautern.
2.2 Lernerinterne Faktoren
Unter dem Begriff der lerninternen Faktoren sind samtliche Haltungen, Neigungen, Einstel- lungen etc. zu verstehen, die im Lerner selbst entstehen und von ihm ausgehen.
Motive
Das Lernen einen Fremdsprache (L2) geschieht bei den Lernern aus unterschiedlichen Griin-den. Demzufolge liegen auch unterschiedliche Motive vor. Wahrscheinlich ist ein Lerner, der beabsichtigt spater die jeweilige Sprache im Studium zu wahlen oder gar im Land der Ziel-sprache zu leben, starker motiviert die Sprache zu lernen als jemand, dessen alleiniger Beriih-rungspunkt mit der Fremdsprache stets deren Unterricht bleiben wird und bleiben soll. Des-wegen ist es nicht von geringem Interesse sich mit den Wertdispositionen der Schiiler zu be-fassen (vgl. Kafourou, 2005, S. 23). Hierbei ist zu betrachten, ob die Lerner kurzfristig oder langfristig motiviert sind und inwieweit es sich um eigene Motive handelt oder jene von au-Ben induziert wurden. Wie lassen sie sich solche Motive diagnostizieren? Ist die Motivation vom Alter und Geschlecht der Lernenden abhangig? Wie verandern sich die Motive im Ver-lauf des Lernprozesses und inwiefern sind sie beeinflussbar durch die Lehrkraft (vgl. Kleppin, 2002, S. 26)? All dies sind Fragen mit denen sich der Lehrer befassen sollte, um den Unter- richt nach Möglichkeit zu verbessern.
Selbstkonzepte
Mit Selbstkonzepten wird die Gesamtheit des Wissens, das eine Person iiber sich selber be-sitzt, bezeichnet. Allerdings wurde der Aspekt, inwieweit sich Selbstkonzepte auf die Motiva-tion beim Fremdsprachenlernen auswirken, bisher minimal untersucht. Jedoch wird der Selbstwirksamkeit dabei eine signifikante Rolle zugeschrieben. Hiermit wird die Einschät-zung bezeichnet, dass der Fremdsprachenlerner mittels des eigenen Könnens, Kreativität und Anstrengung das Ziel erreichen kann die gewiinschte Zielsprache zu erlernen. Er erfährt, dass der Lernprozess nicht ausschlieBlich von äuBeren Einfliissen abhängig ist und entwickelt so-mit möglicherweise ein positiveres Selbstkonzept (vgl. Kleppin, 2002, S. 26). Dies kann dazu fiihren, dass auch dem traditionellen Lehrerfeedback eine geringere Bedeutung beigemessen wird. Der Lernende ist sich bewusst, dass Erfolg, aber auch Misserfolg der eigenen Anstren-gung sowie den selbst gewählten Arbeits- und Lernstrategien zuzuschreiben sind, statt den äu-Beren Einfliissen. Dadurch, dass der Lerner selbst die Verantwortung fiir sein Lernen iiber-nimmt, erreicht er einen gewissen Grad an Autonomie und nach Ema Ushioda (1996) sind au-tonome Lerner auch motivierte Lerner (vgl. Kleppin, 2002, S. 26f).
Einstellung
Die Einstellung gegeniiber dem Fremdsprachenunterricht ist oftmals ein wesentlicher Faktor fiir den Lernprozess. Einstellungen sind affektiv, d.h. durch GefiihlsäuBerungen gekennzeich-net, und folglich von Lerner zu Lerner äuBerst unterschiedlich. Wie steht der Lerner der Kul-tur der Zielsprache gegeniiber, wie ist die Einstellung gegeniiber der Lehrkraft, der Lerngrup-pe oder zum Fremdsprachenlernen allgemein? Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen zu diesem Themenfeld. Nach Kleppin ist Robert C. Gardner der Meinung, dass die Einstellung gegeniiber der Sprache selbst und das generelle Interesse am Fremdsprachenlernen die gröBte Auswirkung auf den Lernerfolg habe (vgl. Kleppin, 2002, S. 27).
Lernerziele und Lernererwartungen
Ob man die Reputation in Familie oder der Lerngruppe durch gute Noten im Fremdsprachun-terricht erhöhen oder sich in der Zielsprache mit Muttersprachlern unterhalten möchte, zeigt, dass die Ziele von Fremdsprachenlernern individuell unterschiedlich sind. Allerdings wird auch deutlich, dass es hier Beriihrungspunkte mit dem Terminus „Motiv" gibt und beide Be-griffe äuBerst schwer eindeutig voneinander abzugrenzen sind. Das langfristige Aufrechterhal-ten der Motivation fiir Fernziele stellt die L2-Lerner oft vor eine diffizile Aufgabe. In diesem Zusammenhang gilt es weithin als anerkannt, dass das Setzen von Nahzielen, welche für den L2-Lerner eine persönliche Bedeutung haben und einen sichtbaren Erfolg nach sich ziehen, ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Motivation ist. Ebendiese vom Lernenden akzeptierten Zielvorstellungen unterstützen den Aufbau realistischer Erwartungen über die Ergebnisse der eigenen Tätigkeit (vgl. Kleppin, 2002, S. 28).
Emotionen
Ein weiterer affektiver Faktor sind die Emotionen. Sie können den Lernprozess positiv, aber vor allem auch negativ beeinflussen. Hierbei ist vorrangig Angst zu nennen. Zum einen kann Angst durchaus als lernfördernd und motivierend empfunden werden allerdings auch lähmend und somit zur Unterbrechung der Motivation führen. Inwieweit ein Lerner von einer Angst positiv angetrieben wird, differiert selbstverständlich von Person zu Person. So führt bspw. die Angst einen gewissen Zeitplan nicht zu erfüllen bei einigen dazu, dass sie mehr oder min-der OOüber sich hinauswachsenOO. Bei anderen führen diese Angstgefühle jedoch zur OOVerkramp-fungOO. Daraus erschlieSt sich die Tatsache, dass die OOlähmende AngstOO ein nicht wünschens-werter Faktor beim Sprachlernprozess ist. Des weiteren kann die Angst vor Misserfolgen, wie schlechten Noten oder negativen Reaktionen der Lehrkraft oder der Lerngruppe, bei vielen L2-Lernern die sog. Sprechangst zur Folge haben. Die gravierendste Auswirkung von Emotio-nen, speziell der Angst wäre die Einstellung jeglicher Interaktion im Fremdsprachenunter-richt.
Attributionen
Ursachenerklärung und Attribuierung, d.h. wie Menschen sich diverse Sachverhalte erklären, sind Teil des Motivationsbegriffs und haben demzufolge einen bedeutenden Einfluss auf das eigene Handeln. Ob die Attribuierungen aus wissenschaftlicher Perspektive laienhaft, unvoll-ständig oder sogar falsch sein mögen, ist hierbei zu vernachlässigen. Die im Fremdsprachen-unterricht auftretenden Attribuierungen sind auf Seiten der Lehrer und Schüler durchaus un-terschiedlich. Der Misserfolg beim Sprachenlernen wird von Lehrerseite den unmotivierten Schülern angelastet. Die Schüler machen diesbezüglich die nicht motivierenden Lehrer ver-antwortlich (vgl. Kleppin, 2002, S. 27).
Anstrengung und Beharrlichkeit
Anstrengung und Beharrlichkeit sind deutlich sichtbare Verhaltenskomponenten eines L2-Lerners. Demzufolge könnten jene als beobachtbare Zeichen der Motivation betrachtet wer-den.
[...]
- Arbeit zitieren
- Philipp Korzenek (Autor:in), 2009, Motivation im Fremdsprachenunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137086