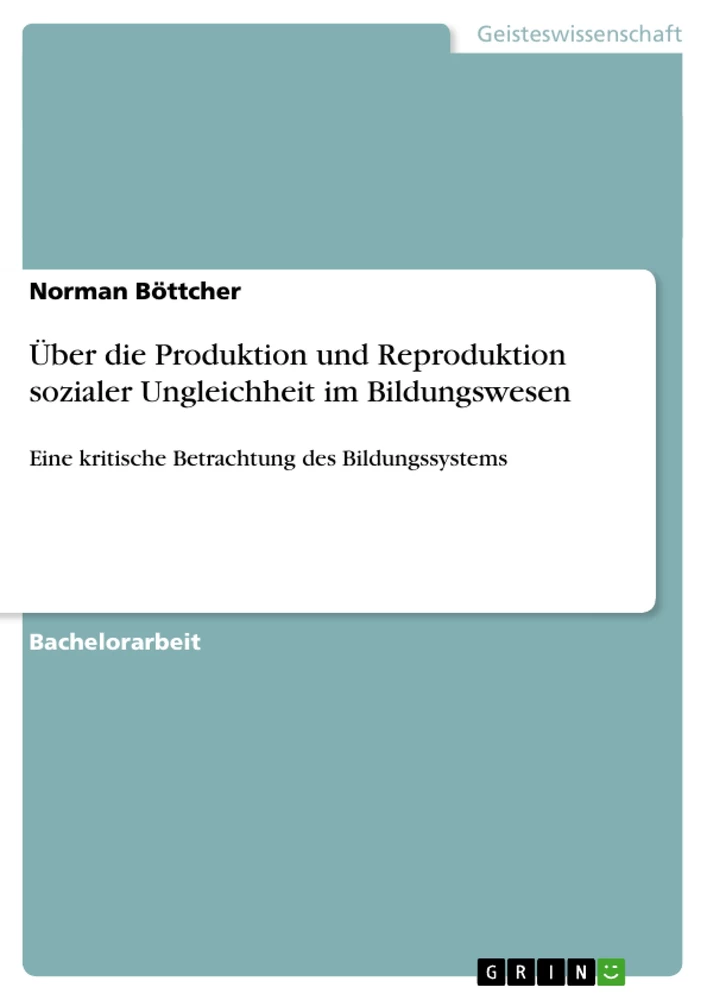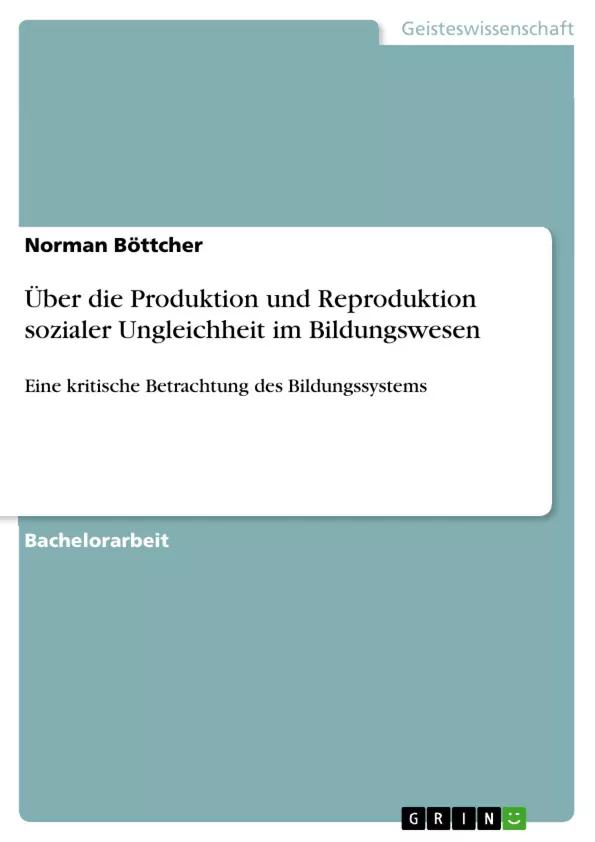Unter Berücksichtigung aktueller, teils demagogisch popularisierter Phänomene, die als generelle Strukturprobleme moderner Gesellschaften auftreten, ist es Ziel dieser Arbeit, Zusammenhänge zwischen diesen als Armut, Segregation und Exklusion bezeichneten Erscheinungen und der Struktur bildender Verhältnisse in der Bundesrepublik zu erkunden und zu beschreiben. Die zunehmende neoliberalistische Politik, welche eine postindustrielle und finanzkapitalistische Ökonomisierung fast aller Lebens- und Arbeitsbereiche herausfordert, führt neben den neu entstehenden Freiheiten, die Beck (1986) nicht unbedacht „Riskante Freiheiten“ nannte, auch zu strukturellen Zwängen, die wiederum diese Freiheiten relativieren. „Der sich durchsetzende Industriekapitalismus schafft Proletarisierung und Verelendung, er provoziert neue politische, kämpferische und solidarische Auslegungen und Praxen gegen Verelendung und Entfremdung.“ (Thiersch, 2008: 30). Diese Gegebenheiten konstituieren das „neue Primat ökonomischer, wirtschaftsbedingter Interessen, das Bildung unter das Postulat der Ausbildung zum Humankapital stellt, einhergehend mit einer Dethematisierung sozialer Probleme, einer Privatisierung der Lebens- und Lernschwierigkeiten, die die neuen Verhältnisse erzeugen und […] einer Moralisierung derer, die in ihnen Verlierer sind.“ (Thiersch, 2008: 30). Eine zentrale Frage stellt sich nach der Position der Sozialpädagogik in den Grenzen dieser Gegebenheiten mit exkludierenden Tendenzen. Wenn Bildung in den bestehenden politischen und ökonomischen Verhältnissen dazu dient, mittels Produktion von „Humankapital“ genau diese Gegebenheiten wieder zu reproduzieren, auch wenn sie selbst der Ursprung für die gesellschaftliche Entgrenzung darstellen, dann nimmt die Sozialpädagogik ihren genuinen Auftrag derart wahr, dass sie die Gegenposition bezieht. Gerade dann, wenn Sozialpädagogik als „Hilfe zur Selbsthilfe“ in prekären Lebensverhältnissen oder als Inklusions- bzw. Integrationshilfe für selektierte bzw. segregierte oder für die von dieser Gefährdung betroffenen Personenkreise agiert.
Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, soziale Ungleichheiten aufzuzeigen, die auf Bildungsangelegenheiten zurückzuführen sind sowie Theorieansätze zu präsentieren, welche die Genese und die Reproduktion dieser Tatsache unter dem Fokus des sozioökonomischen Status der Betroffenen zu erklären versuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Terminologie und Begriffsabgrenzung
- 2.1 Zur Erziehung
- 2.1.1 Das generalisierte gesellschaftsbezogene Erziehungsverständnis
- 2.1.2 Das humanistische Telos als konträre Auffassung von Erziehung
- 2.1.3 Kritik am generalisierten pädagogischen Erziehungsverständnis
- 2.2 Zur Bildung
- 2.2.1 Bildungshistorischer Abriss
- 2.2.2 Bildungstheorie nach Humboldt
- 2.2.3 Zur kontextbezogenen Bildungsbestimmung
- 2.3 Zur definitorischen Bestimmung sozialer Ungleichheit
- 2.3.1 Rousseaus Verständnis von Ungleichheit
- 2.3.2 Zum Phänomen sozialer Ungleichheit in der Gegenwart (nach Hradil)
- 2.3.4 Primäre und sekundäre soziale Ungleichheit nach Tillmann (2008)
- 2.4 Zwischenfazit: Terminologie und Begriffsabgrenzung
- 3 Intelligenz und Begabung: Psychologische Betrachtung von Begabungsunterschieden
- 3.1 Neurobiologische Hirnforschung
- 3.2 Pädagogische Folgerung
- 3.3 Sozialpädagogische Herausforderung
- 3.4 Zwischenfazit: Intelligenz und Begabung
- 4 Zur Theorie Pierre Bourdieus
- 4.1 Praxeologische Erkenntnis
- 4.2 „Geschmack“ und Klassenhabitus - Die Habitustheorie
- 4.3 Ökonomie der Felder - Die Feldtheorie
- 4.4 Bourdieus Kapitalverständnis
- 4.4.1 Ökonomisches Kapital
- 4.4.2 Kulturelles Kapital und dessen Varianten
- 4.4.2.1 Inkorporiertes Kulturkapital
- 4.4.2.2 Objektiviertes Kulturkapital
- 4.4.2.3 Institutionelles Kulturkapital
- 4.4.2.4 Anwendung kulturellen Kapitals auf den Forschungsgegenstand
- 4.4.3 Soziales Kapital
- 4.4.4 Symbolisches Kapital
- 4.5 Zwischen Konflikttheorie und Rational-Choice-Ansatz
- 4.6 Empirische Fundierung
- 4.7 Zwischenfazit: Zur Theorie Pierre Bourdieus
- 5 Ausmaß und Folgen derzeitiger Bildungspraxis - Empirische Forschungsgegenstände
- 5.1 Studentische Erhebung
- 5.1.1 Elterlicher Bildungsgrad und Schulform der Kinder
- 5.1.2 Ergebnisse der studentischen Erhebung
- 5.2 Schülerleistungen im internationalen Vergleich - PISA-Ergebnisse
- 5.2.1 PISA 2000
- 5.2.2 PISA 2003
- 5.2.3 PISA 2006
- 5.3 Barrieren im Schulwesen
- 5.3.1 Einschulungszurückstellungen, Sitzenbleiben und Sonderschulüberweisung
- 5.3.2 Schulformgliederung und Übergangsauslese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Ziel ist es, die Mechanismen aufzuzeigen, die dazu beitragen, dass soziale Unterschiede im Bildungserfolg bestehen bleiben. Die Arbeit beleuchtet dabei verschiedene theoretische Perspektiven und stützt sich auf empirische Daten.
- Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem
- Der Einfluss von kulturellem und sozialem Kapital auf den Bildungserfolg
- Analyse der PISA-Studien und deren Ergebnisse
- Die Rolle von Intelligenz und Begabung im Kontext sozialer Ungleichheit
- Kritische Betrachtung gängiger Erziehungs- und Bildungsverständnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie benennt die zentrale Fragestellung und umreißt den Aufbau der Arbeit. Der einleitende Abschnitt verweist auf die gesellschaftliche Relevanz des Themas und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den bestehenden Strukturen.
2 Terminologie und Begriffsabgrenzung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Erziehung, Bildung und soziale Ungleichheit. Es werden unterschiedliche Definitionen und Perspektiven auf diese Konzepte vorgestellt und kritisch diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Argumentation zu schaffen. Hierbei werden sowohl klassische Ansätze als auch aktuelle soziologische Theorien berücksichtigt, um den Begrifflichkeiten einen wissenschaftlich fundierten Rahmen zu geben.
3 Intelligenz und Begabung: Psychologische Betrachtung von Begabungsunterschieden: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von Intelligenz und Begabung auf den Bildungserfolg. Es werden neurobiologische Erkenntnisse vorgestellt und deren Relevanz für die pädagogische Praxis diskutiert. Die sozialpädagogischen Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Begabungen ergeben, werden ebenfalls thematisiert. Der Fokus liegt darauf, die Komplexität der Thematik zu verdeutlichen und die Grenzen von Intelligenztests zu hinterfragen.
4 Zur Theorie Pierre Bourdieus: Dieses Kapitel widmet sich der soziologischen Theorie Pierre Bourdieus und deren Anwendung auf den Forschungsgegenstand. Die Konzepte des Habitus, des Feldes und der verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) werden detailliert erläutert und auf das Bildungssystem angewendet. Die Arbeit zeigt auf, wie Bourdieus Theorie die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem erklären kann.
5 Ausmaß und Folgen derzeitiger Bildungspraxis - Empirische Forschungsgegenstände: In diesem Kapitel werden empirische Befunde vorgestellt, die das Ausmaß und die Folgen der bestehenden Bildungspraxis belegen. Die Ergebnisse einer studentischen Erhebung werden präsentiert und mit den Daten der PISA-Studien verglichen. Die Kapitel analysieren verschiedene Barrieren im Schulwesen, die zu sozialer Ungleichheit beitragen, wie beispielsweise Einschulungszurückstellungen und die Schulformgliederung.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Reproduktion, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, PISA-Studie, Bildungserfolg, Erziehung, Bildung, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die Mechanismen, die dazu beitragen, dass soziale Unterschiede im Bildungserfolg bestehen bleiben, und betrachtet dabei verschiedene theoretische Perspektiven und empirische Daten.
Welche zentralen Begriffe werden geklärt?
Das zweite Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Erziehung“, „Bildung“ und „soziale Ungleichheit“. Es werden unterschiedliche Definitionen und Perspektiven vorgestellt und kritisch diskutiert, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Argumentation zu schaffen. Dabei werden sowohl klassische Ansätze als auch aktuelle soziologische Theorien berücksichtigt.
Welche Rolle spielen Intelligenz und Begabung?
Kapitel 3 beleuchtet den Einfluss von Intelligenz und Begabung auf den Bildungserfolg. Es werden neurobiologische Erkenntnisse vorgestellt und deren Relevanz für die pädagogische Praxis diskutiert. Die sozialpädagogischen Herausforderungen durch unterschiedliche Begabungen werden ebenfalls thematisiert. Der Fokus liegt auf der Komplexität der Thematik und der kritischen Hinterfragung von Intelligenztests.
Wie wird die Theorie Pierre Bourdieus angewendet?
Kapitel 4 widmet sich der soziologischen Theorie Pierre Bourdieus. Die Konzepte des Habitus, des Feldes und der verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) werden detailliert erläutert und auf das Bildungssystem angewendet. Es wird gezeigt, wie Bourdieus Theorie die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem erklären kann.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Kapitel 5 präsentiert empirische Befunde zum Ausmaß und den Folgen der bestehenden Bildungspraxis. Es werden Ergebnisse einer studentischen Erhebung vorgestellt und mit Daten der PISA-Studien (PISA 2000, 2003, 2006) verglichen. Verschiedene Barrieren im Schulwesen, wie Einschulungszurückstellungen und die Schulformgliederung, werden analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem, den Einfluss von kulturellem und sozialem Kapital auf den Bildungserfolg, die Analyse der PISA-Studien, die Rolle von Intelligenz und Begabung im Kontext sozialer Ungleichheit und eine kritische Betrachtung gängiger Erziehungs- und Bildungsverständnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Reproduktion, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, PISA-Studie, Bildungserfolg, Erziehung, Bildung, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital, Empirische Forschung.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet detaillierte Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Terminologie und Begriffsabgrenzung, Intelligenz und Begabung, Bourdieus Theorie und empirische Forschungsgegenstände), welche die Kernaussagen und den Aufbau der Arbeit verdeutlichen.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit einer übersichtlichen Gliederung der einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Bildungssystem aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen. Sie möchte die bestehenden Strukturen analysieren und ein fundiertes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg schaffen.
- Quote paper
- Norman Böttcher (Author), 2009, Über die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137121