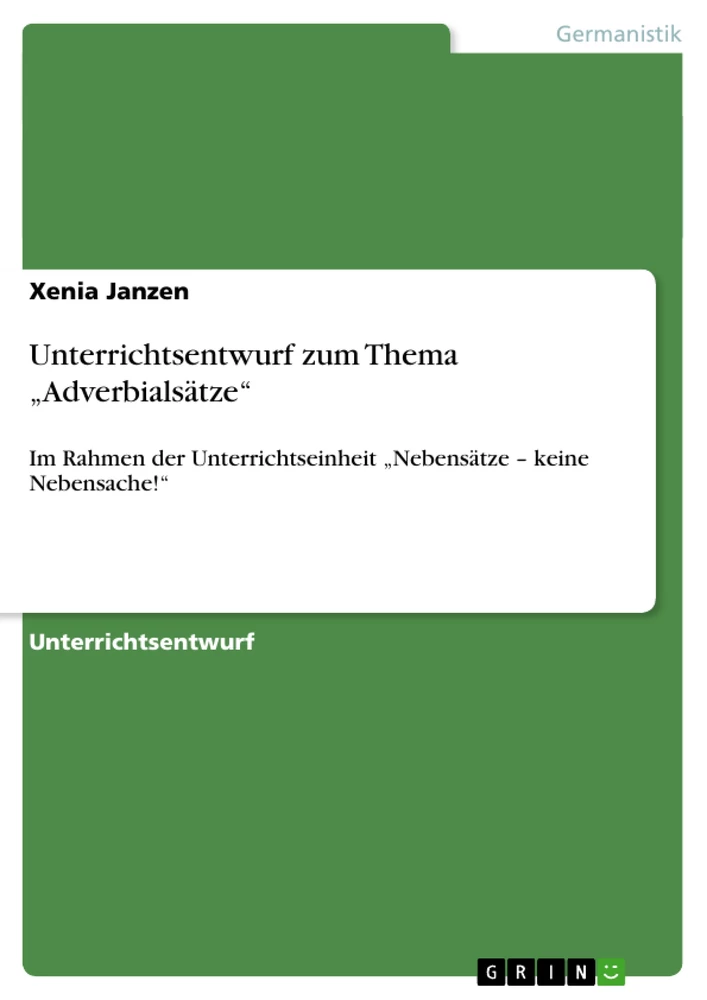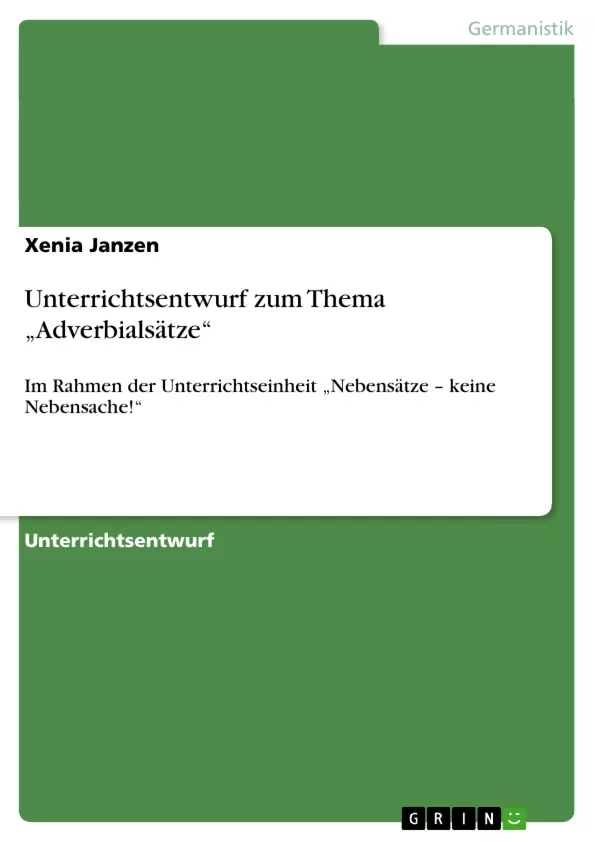Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 2
2. Zur Unterrichtseinheit „Nebensätze – keine Nebensache!“ 2
3. Darstellung der Einzelstunde zum Thema „Adverbialsätze“ 4
3.1. Eingliederung in die Unterrichtsreihe 4
3.2. Bedingungsanalyse 4
3.2.1. Organisatorische Bedingungen 4
3.2.2. Lerngruppenbeschreibung 4
3.2.3. Räumliche Bedingungen 5
3.3. Sachanalyse 5
3.3.1. Der Satz 5
3.3.2. Die Hypotaxe (= Satzgefüge) 5
3.3.3. Der Nebensatz 6
3.4. Didaktische Überlegungen 14
3.5. Methodische Überlegungen 15
3.6. Darstellung des geplanten Unterrichtsverlaufs 17
Literaturverzeichnis 19
Anhang
1. Einleitung
Der folgende Unterrichtsentwurf beschäftigt sich mit einem Teilgebiet der Grammatik, den Nebensätzen, und dient der Auseinandersetzung mit den didaktisch-methodischen Überlegungen im Hinblick auf den Grammatikunterricht in der Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums. Von dieser Perspektive ausgehend, wird sowohl didaktisch als auch methodisch viel Wert darauf gelegt, die Schüler die grammatischen Besonderheiten des „Satzgefüges“ nicht nur deduktiv erlernen zu lassen, sondern ihnen auch die Gelegenheit zu bieten, sich bestimmte Phänomene in diesem Bereich der Grammatik induktiv anzueignen.
[...]
Als sinnvoll erscheint es im Folgenden, zunächst die Unterrichtseinheit kurz einzuleiten. Im nächsten Schritt soll der Entwurf der Einzelstunde präsentiert werden, indem zunächst eine Eingliederung der Stunde in die Unterrichtsreihe zum Thema „Nebensätze – keine Nebensache!“ erfolgt. In einer Bedingungsanalyse sollen dann die organisatorischen und räumlichen Bedingungen dargestellt sowie die Lerngruppe beschrieben werden. Eine detailierte Sachanalyse in Bezug auf die Nebensätze soll dann verdeutlichen, wie vielfältig doch ihre Bedeutung für den schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch ist. In der didaktischen Analyse werden dann die Lehr- und Lernziele des Unterrichtsentwurfs formuliert. Die methodischen Überlegungen sollen sich schließlich mit den Umsetzungsmöglichkeiten des gestellten Vorhabens beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Unterrichtseinheit „Nebensiitze — keine Nebensache!"
3. Darstellung der Einzelstunde zum Thema „Adverbialsiitze"
3.1. Eingliederung in die Unterrichtsreihe
3.2. Bedingungsanalyse
3.2.1. Organisatorische Bedingungen
3.2.2. Lerngruppenbeschreibung
3.2.3. Mumfiche Bedingungen
3.3. Sachanalyse
3.3.1. Der Satz
3.3.2. Die Hypotaxe (= Satzgefiige)
3.3.3. Der Nebensatz
3.4. Didaktische Uberlegungen
3.5. Methodische Uberlegungen
3.6. Darstellung des geplanten Unterrichtsverlaufs
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Der folgende Unterrichtsentwurf beschaftigt sich mit einem Teilgebiet dcr Grammatik, den Nebensat-zen„ und client der Auseinandersetzung mit den didaktisch-methodischen Uberlegungen im Hinblick auf den Grammatikunterricht in der Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums. Von dieser Pcrspektivc ausge-hend, wird sowohl didaktisch als auch methodiseh viel Wert darauf gelegt, die Schiller[1] die grammati-schen Besonderheiten des „Satzgefiiges" nicht nur deduktiv erlernen zu lassen, sondern ihnen auch die Gelegenheit zu bieten, sich bestimmte Phanomene in diesem Bereich der Grammatik induktiv an-zucignen. Als Anrcgung dafiir dientc das Seminar „Grammatikunterricht in den Sekundarstufen I und 11", welches im Wintersemester 2008/2009 unter der Leitung von Herrn Dr. Stefan Schallenberger an der Universitat Bremen stattfand.
Sehr oft wurde im Seminar das Thema angesprochen, dass der Grammatikunterrieht in dcr Schulc langweilig und unbeliebt sei. Auch diskutierte man mehrmals fiber seinen Nutzen oder Sinn. So fragt man sich an dieser Steil°, warum eigcntlich die Nebensatze in unsercm Sprachgebrauch, sowohl im mundlichen als auch schriftlichen„ so wichtig sind. Die folgende Arbeit ist das Ergebnis der Suche nach der Antwort auf diese Frage.
Als sinnvoll erscheint es 1111 Folgenden, zunachst die Unterrichtseinheit kurz cinzuleiten. Inl nachsten Schritt soil der Entwurf der Einzelstunde priisentiert werden, indem zunachst eine Eingliedemng der Stunde in die Untcrrichtsreihe zum Thema „Nebensatze — keine Nebensache!" erfolgt. In einer Bedin-gungsanalyse sollen dann die organisatorisehen und raumlichen Bedingungcn dargestellt sowie die Lerngruppe beschrieben werden. Eine detailierte Sachanalyse in Bezug auf die Nebensatze soil dann verdeutlichen, \Vie vielfaltig doch ihre Bedeutung fiir den schriftlichcn und miindlichen Sprachgc-brauch ist. In der didaktischcn Analyse wcrden dam die Lehr- und Lemzicle des Unterrichtsentwurfs fonnuliert. Die methodischen Uberlegungen sollen sich schliel3lich mit den UmsetzungsmOglichkeiten des gcstellten Vorhabens beschaftigen.
2. Zur Unterrichtseinheit „Nebensatze — keine Nebensache!"
Die Palette der Schwierigkeiten, mit denen der Gebrauch von Nebensatzen bei Schillern zusammen-hangt, ist Breit. Otto Ludwig und Wolfgang Menzel weisen darauf hin, dass die weitaus auffalligsten Probleme, die Schiller dabei haben, mit der Zeichensetzung verbunden sind. Die Nebensatze werden schr oft von den Hauptsatzen nicht mit einem Komma gctrennt. Schwierigkeiten dieser Art bestehen, so Ludwig/Metzel, bis in die Sekundarstufe II hinein. (vgl. Ludwig/Menzel 1988: 16) Der Bremische Bildungsplan Deutsch fiir das Gymnasium in den Jahrgangsstufen 5-10 fordert u.a. in Bezug auf die grammatischcn Fertigkeiten und Fertigkeiten, dass die Schiller am Ende der 9. Klasse die Zeichenset-zung in Satzreihcn und Satzgefilgen beherrschen (vgl. Bildungsplan Deutsch 2007: 16). Daher ist eine sorglaltige ()bung der Schiller in Zeichensetzung in den Nebensatzen wichtig.
Auch das Lesen von langeren, aus mehrcrcn Teilsatzen bestehenden Satzgeftigen fchlt den Schiilern nicht leicht. Satzgeftige sind Spannungseinheiten, die beim Vorlesen an den Leser babe Anforderun-gen an Intonation, Akzentuierung und Pauseneinhaltung stollen. Schou in der Kinder- und Jugendlite-ratur fmden sich heute langere Siitze mit komplizicrtem Aufbau und Inhalt. In solchen Fallen ist cs daher die Aufgabe des Deutschunterrichts. diese Schwierigkeiten zu beheben. Dabei sind Obungen hilfreich, mit derenlfe gezielt die Lesefahigkeit vcrbessert werden kann. Hier sind die Aufgaben zum sinngestaltenden Lescn notig, die den Schiller helfen werdcn, die Pauscn im Satz zu gestalten, eingeschobene Nebensatze zu iTherbnicken, die Stichworter zu betonen und die Stimme nicht friihzei-tig absinken zu lassen (vgl. Ludwig/Menzel 1988: 16). AuBcrdem sollenlfen zur Erweiterung des Sprachbewusstseins geboten werden, die es den Schillem erlauben, beim Lesen schwicriger Konstruk-tionen Umformungen vorzunehmen, urn sie richtig interpretieren zu konnen (Voigt 1988: 51).
Die miindliche und schriftliche Sprache der Schiller ist anfangs recht unkompliziert. Diese zeichnet sich durch Hauptsatzreihungen und eine sehr seltene Verwendung von Satzgefugen aus. Oft sind diesc Reihungen und Geftigen durch erstarrte Muster bestimmt: die zeitlichen Verhaltnisse werden haupt-sachlich durch vorangestelltc Konjunktionalsatze mit ais und Satzvcrbindungen mit dann und und ausgedriickt. Hier ware es die Aufgabc des Deutschunterrichts, auf die Vielfaltigkeit der Muster sowic auf die Abwechslung im Gebrauch der Konjunktionen und Temporaladverbien hinzuweisen. dem sullen dabei die sprachlichen Muster im Hinblick auf die semantisch-syntaktischen Funktionen enveitert werden (vgl. Ludwig/Menzel 1988: 17). Da cs sich bei dicsem Unterrichtsentwurf um die Schiller der Jahrgangsstufe 8 handelt, kOnnen hier nicht alle bestehenden Nebensatzarten durchge-nommen werden. Um den Schillem jedoch verschiedene AktionsmOglichketen, die mithilfc der Ne-bensatze im schriftlichen und mundlichen Sprachgebrauch formuliert werden konnen, aufzuzeigen, werden lediglich die Nebensatze mit der Form und Funktion eines Subjekt- und Objcktsatzes, eines Advcrbialsatzes mit kausaler, modalcr, konsekutiver, konditionaler und konzessivcr Bezichung sowic eines Attributsatzes (als Beispiel hierfar Relativsatze) behandelt.
Nach der erfolgten Darstellung dilrfte die Antwort auf die Frage danach, warum das Satzgeflige und hauptsachlich die Funktion der Nebensatze darin fur den Deutschunterricht von wichtiger Bedeutung sind. naheliegen: Es ist ihre Eigenschaft, „Verhaltnisse (logische, psychologische und semantische) and Beziehungen (svntaktische und textuelle) so viol besser explizit" zu machen, .,als Hauptsatze das konnen dean die Anzahl der Nebensatzkonjunktionen, die diesc Beziehungen ausdriicken, ist reich-haltiger als die der Hauptsatzkonjunktionen." (Ludwig/Menzel 1988: 16) Zudem wird „mit den Haupt-Nebensatz-Geftigen ein auBerst gcdankliches sprachlichcs Mittel geschaffen, solchc Beziige iTherhaupt herzustellen und sic in Spannung zu einander zu sctzen." (ebd.) Daher di rfen die Nebensatze im Deutschunterricht keine Nebensache sein und es muss ein „moglichst praziselrl und differenziertel ri und wirksameirl Gebrauch von Satzgefligen" ertblgen. (ebd.)
Lehr- und Lernziele der Unterrichtseinheit:
Die Schuler sollen ihre Kompetenzen im Bereich des Sprachbewusstseins ausbauen. Dabei sollen sie Sicherheit im Gebrauch von Nebensatzen gewinnen. Aufdiesem Weg sollen sic sich dcn syntaktischcn Aufbau eines Satzgefuges ancignen und dabei die besonderen Kennzeichen eines Nebensatzes, wie die Stellung des Verbs und seine Trcnnung vom Hauptsatz durch das Komma kennenlernen; unterschicdliche Nebensatzarten im Hinblick auf ihrc Form und semantisch-syntaktischen Leistungen in einem Satzgefiige benennen und einschatzen konnen; sich dabei mit verschiedenen AktionsmOglichketen, die mithilfc der Nebensatze im scluiftlichen und mundlichen Sprachgebrauch fonuulicrt werdcn kOnnen, vcrtraut ma-chen; sich im Lesen und Vcrstchen lingerer Satzgefugen mit kompliziertem Aufbau und In-halt iiben.
3. Darstellung der Einzelstunde zum Thema „AdverbialsMze"
3.1. Eingliederung in die Unterrichtsreihe
Bei der Durchfithrung dieser Doppelstunde handelt es sich um die 5. und 6. Stunde der fiktiven Unter-richtsreihe „Nebensatze — keine Nebensache!". In den ersten beiden Stundcn wurden die Definition und die Merkmale des Satzgefliges crarbeitet. Auch die Unterschcidung der Nebensdtze nach ihrer Form land statt. Ab der 3. Stunde erfolgte ein Obergang zum Thema „Nebensatze und ihre Funktion". Dabci setzte man sich schon mit solchen Nebensatzen auseinander, die in den Satzgefugen die Funkti-on eines Subjekt- oder Objektsatzes einnehmen. In dieser Doppelstunde soil es nun um die Adverbial-stitze gehen. Hochstwahrscheinlich wird sich dieses umfangreiche 'Thema auch auf die folgenden zwei Stunden erstreckcn. Die Bchandlung der Relativsatze soil dann die Unterrich]tsrcihc abschlieBen.
3.2. Bedingungsanalyse
3.2.1. Organisatorische Bedingungen
Der Deutschunterricht in der gymnasialen Klasse 8 „V" findet immer vierstundig pro Woche start. (tine Doppelstunde und zwei Einzelstunden) In der Doppelstundc lassen sich immer komplexere Theisen abarbeiten. In den Einzelstunden kOnnen sic dann nachgearbcitet wcrden und die Ergebnissc prasentiert werden.
3.2.2. Lerngruppenbeschreibung
Die Klasse besteht aus 15 Madden und 13 Jungen. Die Schiller verstehen sich untereinander und in-sgcsamt hcrrscht in der Klasse eine freundlichc und produktivc Atmosphare. Die Schiller sind in ver-schiedencn Arbcits- und Sozialfonuen getibt, insbesondere in der Partner- und Gruppenarbeit.
Ein grundsatzliches lnteresse am Deutschunterricht ist gegcben. Aiierdings nehmen in den Unter-richtsgesprachen die Jungen der Gruppe, die grundsatzlich doch leistungsbereit sind, eine eher passive Haltung ein. Die meistcn Madchen, weiche die leistungsstarkere Halite der Gruppe darstellen, betcili-gen sich deutlich aktivcr am Unterrichtsgeschehen. Jedoch gibt cs auch unter den Madchen cinige wenige Personen, die ftir den Deutschunterricht wenig lnteresse zeigen.
Die Zusammensctzung der Gruppc bedeutet fur die Planung des Unterrichts, zum cinen Wegc zu fin-den, die Jungen dcr Klasse in das Unterrichtsgesprach mit einzubcziehen. Zum anderen bedeutet cs eine grtindliche Vorbereitung bei der Durchtlibrung der Arbeits- und Sozialformen, wie z.B. der Gruppenarbeit. Hier soli die Verteilung der Schiller auf die Gruppen sehr genau iiberlegt werden, da-mit alle Gruppen durchschnittlich leistungsgleich sind und die Produktivitat der Arbeit sichergcstellt ist.
3.2.3. Raumliche Bedingungen
Der Unterricht findet immer im gleichen Raum staff, sodass die von den Schiilern im Unterricht ers-tellten Materialien immcr zur Verfligung stchen. AuBerdem befindct sich im Klassenraum immcr cin Overheadprojektor, was das Benutzen von Folien im Unterricht moglich macht.
3.3. Sachanalyse
3.3.1. Der Satz
Der Satz ist eine nach spezifischen Regeln aus kleineren Einheiten konstruierte Redeeinheit, die hin-sichtlich Inhalt, grammatischer Struktur und Intonation relativ vollsandig und unabhangig ist. Dic Satze lassen sich unter den folgenden Aspekten klassifizieren: (a) Unter formalem Aspekt ist die un-tcrschiedliche Position der finiten Vcrbform von Bedeutung: Kern-, Stirn- oder Spannsatz: (b) Hin-sichtlich der pragmatisch-kommunikativen Funktionen des Satzmodus wcrden unter Berucksichtigung von Verbstellungstypen, Modusgebrauch und Intonation mindestens vier Formtypen unterschieden: Aufforderungs-. Aussage-; Frage- und Wunschsatz: (c) Hinsichtlich der unterschicdlichen Komplcxi-tat der syntaktischen Struktur ergibt sich die Differenzierung in einfache, erweiterte und komplexc Satze; (d) Aufgrund der unterschiedlichen Abhangigkeitsbeziehungen ergibt sich — im Zusammenhang mit den aufgefuhrten Strukturtypcn — die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebcnsatz und nach der Art ihrer Zusammensetzung unterseheidet man (c) bei Satzverbindungen zwischen koordinierten (gleichgeordneten) und subordinierten (untergeordneten) Satzen, wobei letztere sowohl eingeleitet — durch konjunktionalc oder relative Elemente — als auch uneingeleitct realisicrt werden konnen (vgl. BuBmatm 2002: 5781).
3.3.2. Die Hypotaxe (= Satzgefiige)
Wie bcrcits angedcutet, untcrscheidcn sich die einzcinen Satze nach Art ihrer Abhangigkcitsbezichun- gen in Haupt- und Nebcnsatze und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung in koordinierte und subordi- nierte Satze. lm Rahmen dieser Arbcit soil die Koordination, untcr der eine Verbindung aneinanderge-reihter Satzteile zu verstehen ist. aul3en vor gelassen werden. Es ist die Subordination — auch Hypotaxe genannt auf die bier das Hauptaugenmerk gelegt wird. In der Schulgrammatik wird die Hypotaxe als „Satzgefuge" bezeichnet.
Unter Hypotaxe versteht man eine semantische Relation der Unterordnung, die zwischen den einzel-nen Teilsatzen — dem Haupt- und dem Ncbensatz — bcstcht. Die strukturcllc Abhangigkeit wird im Deutschen formal durch Konjunktionen (well. obwohl), Relativpronomen (der. welcher), Wortstellung und/oder Konjunktiv sowie Infinitkonstruktionen gekennzeichnet, wobei der untergeordnete Satz dem Hauptsatz vorausgchen, ihm folgen oder in ihn cingebettet scin kann (vgl. BuBmann 2002: 287).
3.3.3. Der Nebensatz
Der Ncbensatz ist im Untcrschied zum strukturcll selbststandigen Hauptsatz formal ein untergcordne-ter Teilsatz. d.h. Nebensatze sind in Bezug auf ihre Wortstellung, Tempus- und Moduswahl sowie Illokution (= Sprcchhandlung mit kommunikativer Funktion) vom ubergeordneten Hauptsatz abhangig (vgl. BuBmann 2002: 460). Der Ncbensatz wird von dem Hauptsatz stets durch ein Komma getrennt. Das gesamte Pradikat — alle Teile des Verbs also — rucken im Nebensatz an die letzte Stelle.
3.3.3.1. Traditionelle Einleitungskriterien bei den Nebensatzen
Nebensatze wcrden nach den folgenden Kriterien bcstimmt und eingestellt:
1. Nach dem Strukturtvp: als Spannsatz (= cingeleiteter Ncbensatz), als Kern- oder als Stirnsatz (= uneingeleiteter Nebensatz)
2. Nach der Stellung inncrhalb des Satzgefiiges im Verhaltnis zum unmittelbar iibergeordneten Teilsatz (Vorder-, Nach- oder Zwischcnsatz)
3. Nach dem Grad der Abhangigkeit: Unmittelbar vom Hauptsatz abhangige Teilsatze sind
Ne-bensatze erstcn Grades: von Nebensatzen abhangigc Teilsatze sind Nebensatze zwciten, drit-ten und vierten usw. Grades, je nach dem Abhangigkeitsgrad des Tragersatzes (= dem Ne-bensatz unmittelbar iibergeordneter Teilsatz) 4. Nach dem Vorhandenscin der EinleitewOrter in eingcicitete und uncingcleitete Nebensatze. Bei der Klassifizicrung cingeleiteter Nebensatze ist nach folgenden Medullalen zu cntschei-den:
a. Konjunktionalsatz: Das Einleitewort tritt erst nach Einbcttung des Nebensatzcs auf und hat keinen Satzgliedwert,
b. Rclativsatz: Das Einleitewort vertritt cin Bezugswort des iibergeordneten Satzcs oder den ganzen iThergeordneten Satz, client cbenfalls der Einbcttung des Nebensatzes, hat aber immer Satzgliedwert. Man unterscheidet nach dem Anlaut d-Relativa (der, die. das) und w-Relativa (Pronomcn, Adverbien. Pronominaladverbien, z.B. was. wer, welcher: tiro. wie; wodurch. womit. wozzt),
c. Intcrrogativ- oder Fragewortsatze: Das Einlcitcwort ist cin Interrogativpronomcn oder interrogatives Adverb und kennzcichnet tine Lcerstellc, cine Unbekanntc in der Sachverhaltsdarstellung. Es steht deshalb schon im selbststandigen Fragesatz, also vor der Einbcttung in chi Satzgcfugc und hat Satzgliedwert,
d. Nach dens syntaktischcn Strukturwert als Gliedsatz (Subjckt,- Objckt,- Adverbial.-oder Pradikativsatz), Gliedteilsatz (Attributsatz) oder weiterfiihrender Nebensatz.
(Sommerfeldt/Starke 1998: 234)
In den Schulgrammatiken fur die Jahrgansstufen 7. und 8. spricht man zunitchst bei der Untcrschei-dung der Nebensatze von ihrer Form. Es linden sich an dieser Stelle unterschiedliche Varianten einer solchcn Klassilizierung. Moistens werden unter dieser Gruppe die Punktc 4.a. 4.b. und 4.c. der effolg-ten Darstellung zusammengefasst.[2] Der Punkt 4.d. wird entwedcr unter der Kategoric „Erganzungssat-ze" aufgefUhrt oder findet sich im Kapitel zu den .,Funktionen der Nebensatze`' (vgl. Duden: Rechts-schrcibung und Grammatik lcicht gcmacht 2007: 190 und Schillerduden: Grammatik 2006: 397).[3]
Da der Sinn der zu cntwerfenden Unterrichtssequenz sich in einer ffir die Schuler cinlcuchtenden Dar-stellung und Erklarung der Satzglieder verbirgt, erfolgt die Unterscheidung der Form im Unterricht nach folgendem Schaubild:
Schaubildl : Unterscheidung der Nebensatze nach ihrer Form
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(vgl. Schwengler 2003: 13)
3.3.3.2. Types syntaktisch-semantischer Beziehungen der NebensAtze
Sommerfeld/Starke unterscheiden nach drei Haupttypen von Nebensiitzen in einfachen Satzgefiigen in Bczug auf ihrc syntaktisch-semantischen Bezichungen: Komplcmcnt- oder Inhaltssatze, Vcrhaltnissat-ze und Relativsdtze (Sommerfeldt/Starke 1998: 236-241).
[...]
[1] In] Vcrlauf dieser Hausarbcit %verde icli Schiilerinnen und Schiller tinter dcm BcgrilT Schiller zusanuncnfassen, sofcrn nicht explizit von Schtilcrinnen die Rcde ist.
[2] In den Dudengramniatiken far die Schule linden sich tatter dieser Untergruppe auch die sogenannten ..satziNcr-tigen Filgungen", tie Infinitiv- mid Partizipialgruppe, diesc beiden Gruppen sollcn aufgrund dcr Jahrgangsstule (8. Klassc) in dicscr Arbeit unberucksichtigt bleiben. (Vgl. Duden: Deutsche Rechtsschreibung and Grammatik lcicht gcmacht 2()()7: 190)
[3] Zu den Funktioncn des Ncbensatzes in cincm zusammcngcsctzten Satz wird int folgcndcn Kapitel inj Einzelnen cingegangen.
Häufig gestellte Fragen
Für welche Zielgruppe ist dieser Unterrichtsentwurf gedacht?
Der Entwurf ist für den Grammatikunterricht in der Jahrgangsstufe 8 eines Gymnasiums konzipiert.
Was ist das Hauptthema der beschriebenen Einzelstunde?
Das zentrale Thema der Einzelstunde sind „Adverbialsätze“ als Teilgebiet der Nebensätze.
Welche didaktischen Ansätze werden verfolgt?
Es wird Wert darauf gelegt, grammatische Phänomene nicht nur deduktiv (vorgegeben), sondern auch induktiv (selbst erschließend) zu erlernen.
Welche Schwierigkeiten haben Schüler oft mit Nebensätzen?
Häufige Probleme liegen in der korrekten Zeichensetzung (Kommasetzung) sowie in der Intonation beim Lesen komplexer Satzgefüge.
Welche Arten von Adverbialsätzen werden thematisiert?
Behandelt werden Adverbialsätze mit kausaler, modaler, konsekutiver, konditionaler und konzessiver Beziehung.
- Quote paper
- Xenia Janzen (Author), 2009, Unterrichtsentwurf zum Thema „Adverbialsätze“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137145