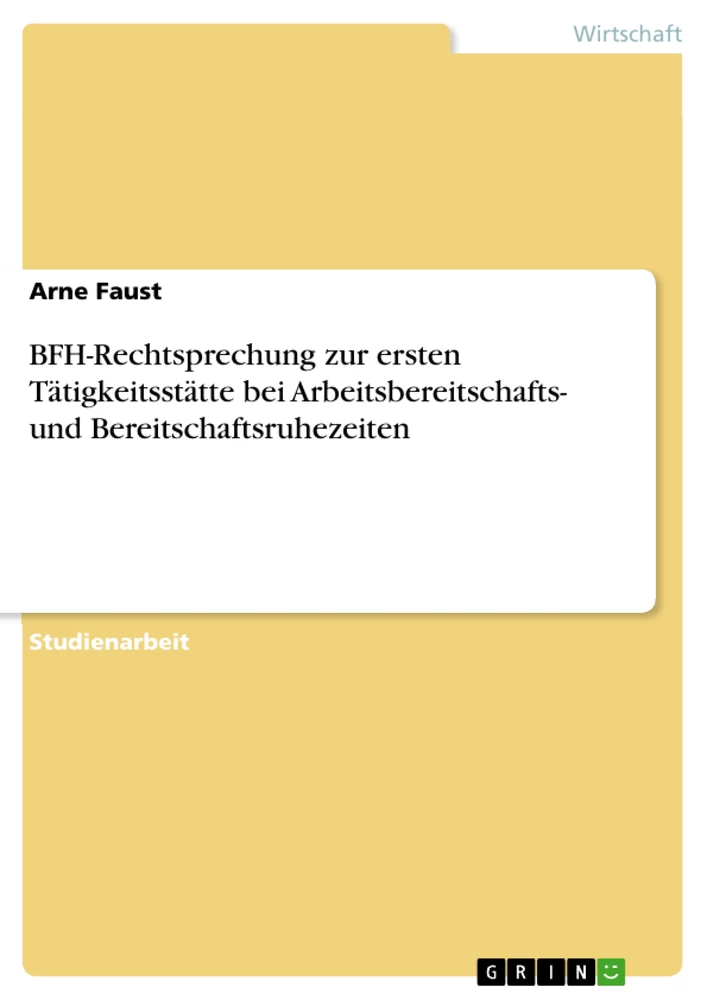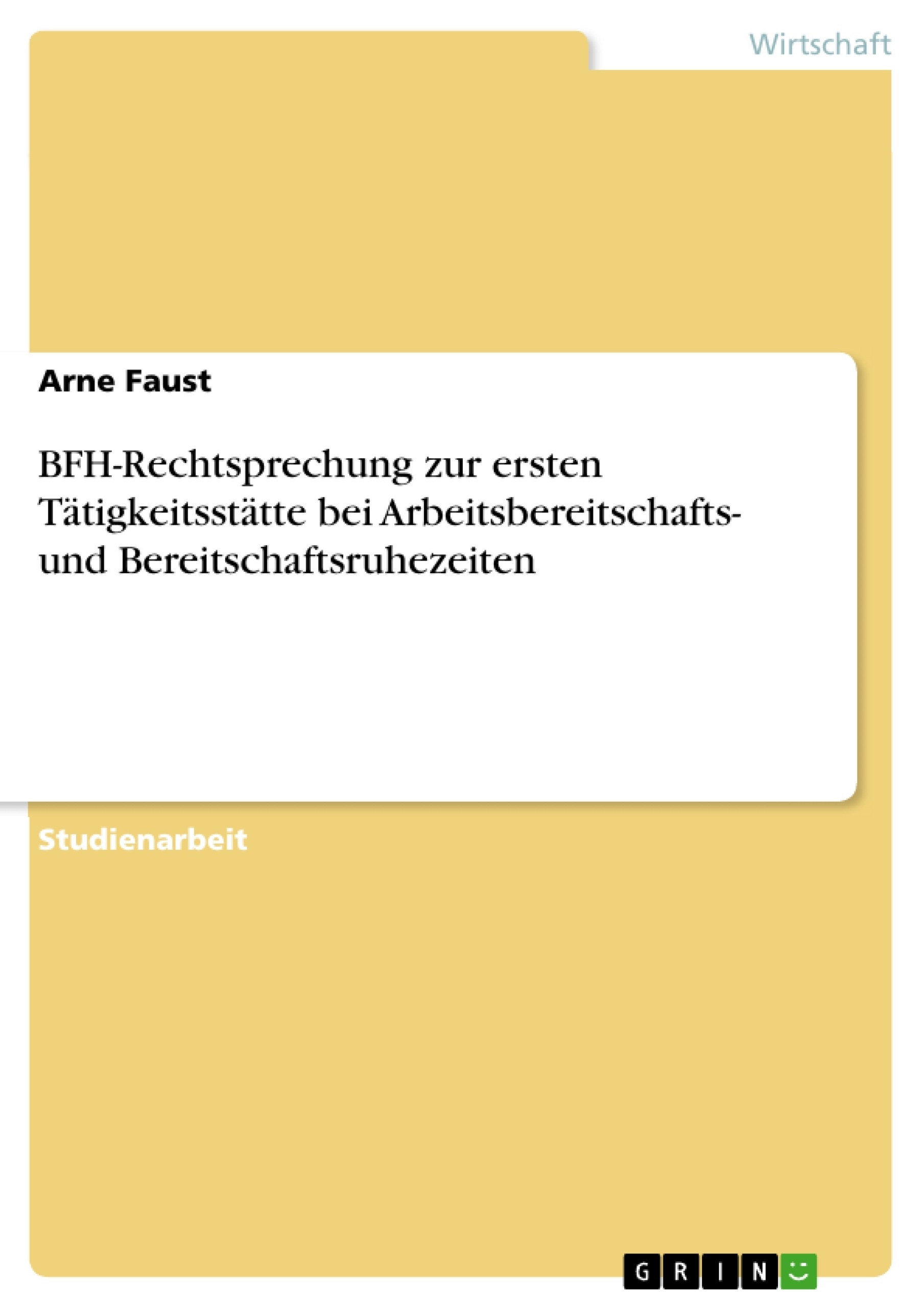Eine unzureichende Abgrenzung des Begriffs der ersten Tätigkeitsstätte kann enorme finanzielle Auswirkungen für Steuerpflichtige und Staat haben. Entsprechend ist eben diese Abgrenzung regelmäßig Gegenstand von Gerichtsverfahren. Eines dieser Verfahren wird im Rahmen dieser Abhandlung beleuchtet, sowie auch aus ökonomischer und steuerrechtlicher Sicht einsortiert.
"Deutschland, Land der Pendler" titelte die WirtschaftsWoche vor einigen Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass deutsche Pendlerinnen und Pendler auf dem Weg zur Arbeit im Schnitt zuletzt knapp 17 km zurücklegten, während knapp 20 % aller Erwerbstätigen einen Arbeitsweg von über 25 km auf sich nehmen - Tendenz steigend. Mehr als zwei von drei Erwerbstätigen nutzen dabei einen Pkw. Betrachtet man allein die über 34.000.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, werden in Deutschland, auch unter Berücksichtigung einer gewissen Teilzeitquote, arbeitstäglich ca. 400.000.000-500.000.000 km auf dem Weg zur Arbeit zurückgelegt. Durch die zuletzt stark angestiegenen Kraftstoffpreise wird also, mehr noch als zuvor, deutlich, dass Berufstätige in Deutschland jeden Tag einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand auf sich nehmen müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.
Da der Gesetzgeber Aufwendungen, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Erzielung ihres Einkommens entstehen (sog. Werbungskosten), begünstigen möchte, hat er Steuerpflichtigen im Einkommensteuergesetz die Möglichkeit eingeräumt, Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG in Form der Entfernungspauschale steuerlich geltend machen zu können.
Handelt es sich bei den Fahrten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hingegen um Reisekosten, kann beim Benutzen des privaten Pkw die tatsächlich zurückgelegte Distanz abgesetzt werden. Darüber hinaus können Steuerpflichtige an solchen Tagen, sofern ihre Auswärtstätigkeit länger als acht Stunden dauert, Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe von bis zu 28 € pro Tag geltend machen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 „Deutschland, Land der Pendler”
- 2 Die erste Tätigkeitsstätte im Einkommensteuergesetz
- 2.1 Steuerliche Implikationen aus dem (Nicht-)Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte
- 2.2 Definition der ersten Tätigkeitsstätte
- 2.2.1 Ortsfeste betriebliche Einrichtung
- 2.2.2 Dauerhafte Zuordnung des Arbeitnehmers
- 3 BFH-Rechtsprechung zur ersten Tätigkeitsstätte
- 3.1 Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen bei einem Feuerwehrmann
- 3.1.1 Sachverhalt
- 3.1.2 Ausführungen des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz
- 3.2 Entscheidung des Bundesfinanzhofs
- 3.3 Reaktionen auf die Entscheidung des BFH
- 3.4 Implikationen für weitere Berufsgruppen
- 3.5 Gestaltungsmöglichkeiten
- 4 Wird es in Zukunft mehr Rechtssicherheit geben?
- Literaturverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zur ersten Tätigkeitsstätte im Einkommensteuergesetz. Sie analysiert die steuerlichen Implikationen, die sich aus dem Vorliegen oder Nicht-Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte ergeben, und untersucht die Definition der ersten Tätigkeitsstätte im Detail. Insbesondere wird ein aktuelles BFH-Urteil zu den Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen eines Feuerwehrmanns beleuchtet. Die Arbeit zeigt die Relevanz der Abgrenzung des Begriffs der ersten Tätigkeitsstätte für Steuerpflichtige und Staat auf und diskutiert die Gestaltungsmöglichkeiten für Steuerpflichtige in diesem Zusammenhang.
- Definition der ersten Tätigkeitsstätte im Einkommensteuergesetz
- Steuerliche Implikationen aus dem (Nicht-)Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte
- Aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
- Gestaltungsmöglichkeiten für Steuerpflichtige
- Rechtssicherheit in der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung der ersten Tätigkeitsstätte für die steuerliche Behandlung von Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen. Kapitel 2 widmet sich der Definition der ersten Tätigkeitsstätte im Einkommensteuergesetz und erläutert die steuerlichen Implikationen, die sich aus deren Vorliegen oder Nicht-Vorliegen ergeben. Kapitel 3 analysiert die aktuelle BFH-Rechtsprechung zur ersten Tätigkeitsstätte anhand eines konkreten Fallbeispiels. Es beleuchtet die Entscheidung des BFH, die Reaktionen darauf sowie die Implikationen für weitere Berufsgruppen. Zudem werden Gestaltungsmöglichkeiten für Steuerpflichtige im Zusammenhang mit der ersten Tätigkeitsstätte aufgezeigt. Kapitel 4 diskutiert die Frage, ob in Zukunft mehr Rechtssicherheit in diesem Bereich zu erwarten ist.
Schlüsselwörter
Erste Tätigkeitsstätte, Einkommensteuergesetz, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, BFH-Rechtsprechung, Steuerliche Implikationen, Gestaltungsmöglichkeiten, Rechtssicherheit
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „erste Tätigkeitsstätte“?
Es ist eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.
Welche steuerlichen Folgen hat die erste Tätigkeitsstätte?
Fahrten dorthin können nur mit der Entfernungspauschale abgesetzt werden. Liegt keine erste Tätigkeitsstätte vor, können oft höhere Reisekosten geltend gemacht werden.
Was entschied der BFH im Fall des Feuerwehrmanns?
Der BFH befasste sich mit der Frage, ob eine Feuerwache trotz Bereitschaftszeiten als erste Tätigkeitsstätte gilt, was Einfluss auf Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwand hat.
Können Verpflegungsmehraufwendungen immer abgesetzt werden?
Nein, dies ist meist nur bei einer Auswärtstätigkeit (ohne erste Tätigkeitsstätte) von mehr als acht Stunden möglich.
Warum ist die Abgrenzung für Pendler so wichtig?
Angesichts hoher Kraftstoffpreise macht es einen erheblichen finanziellen Unterschied, ob man die tatsächlichen Kilometer (Reisekosten) oder nur die einfache Entfernung absetzen kann.
- Quote paper
- Arne Faust (Author), 2023, BFH-Rechtsprechung zur ersten Tätigkeitsstätte bei Arbeitsbereitschafts- und Bereitschaftsruhezeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1372056