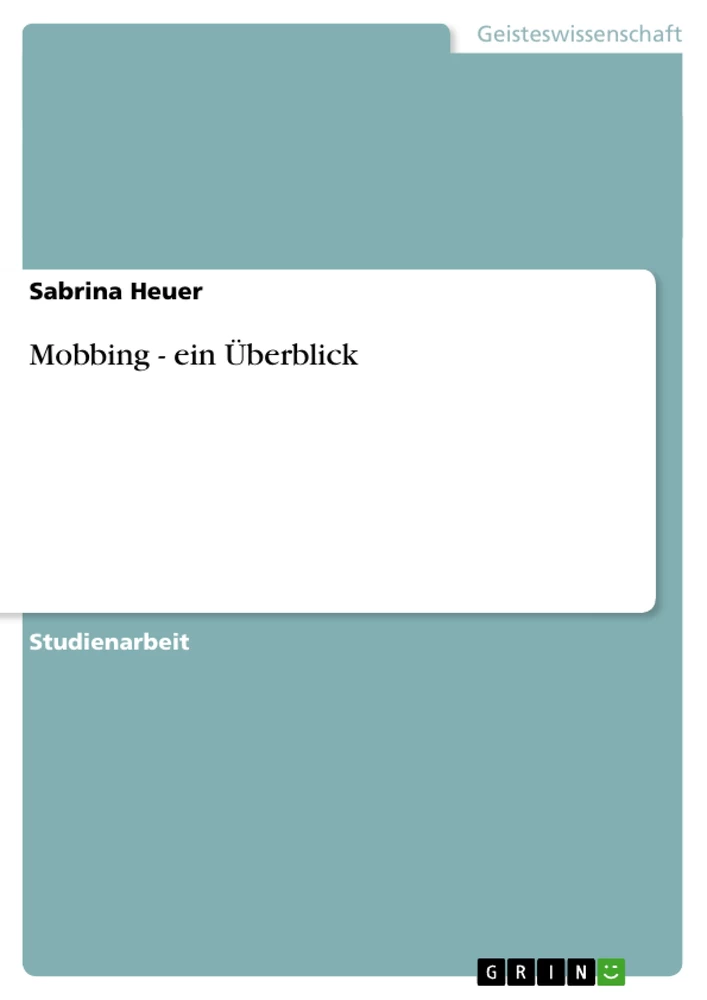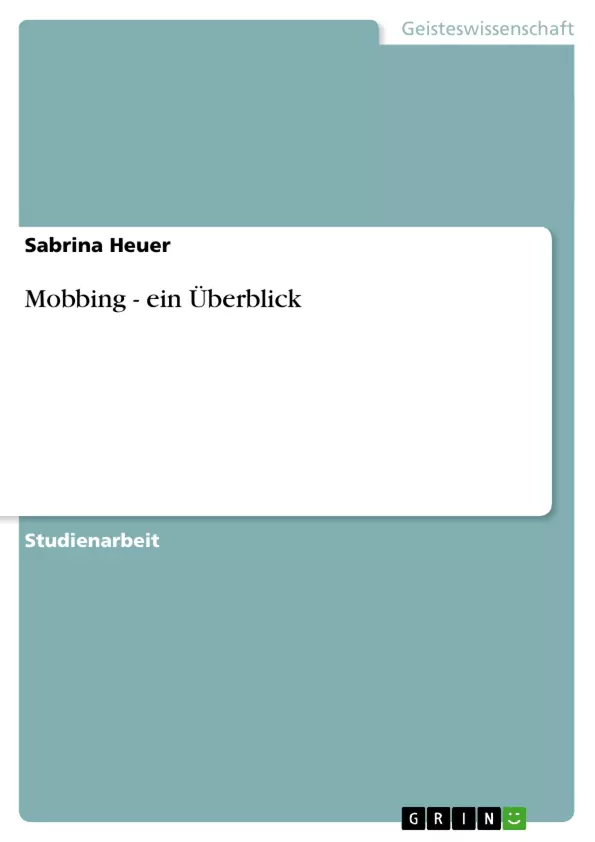Mobbing ist keine Randerscheinung, sondern ein gravierendes soziales Problem, das in nahezu jedem Unternehmen anzutreffen ist. Die Ausfallkosten, die deutschen Unternehmen durch Mobbing entstehen, werden auf über 15 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es rund 1,27 Millionen Mobbingopfer in Deutschland gibt. Leymann stellte die These auf, dass statistisch gese-hen bei einer Arbeitslebenszeit von dreißig Jahren jeder vierte Erwerbstätige im Laufe seines Berufslebens einmal zum Opfer von Mobbing wird. Mobbing ist ein Modewort für ein gesellschaftliches Phänomen, das so alt ist wie das gemeinsame Arbeiten der Menschen. Es stammt aus dem Englischen und wurde von den skandinavischen Ländern in die Diskussion eingeführt. Die Sensibilität gegenüber der Problematik ist in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit kontinuierlich gestiegen. Arbeits- und Sozialwissenschaftler, Mediziner und Vertreter anderer Disziplinen so-wie Medien, Gewerkschaften und Krankenkassen haben sich gleichermaßen der Mobbingthematik zugewandt. In ihren Berichterstattungen erweist sich das Thema als aktuelle und relevante Problematik für Wirtschaft und Gesellschaft, da Mobbing nicht nur massive gesundheitliche Schäden bei den Betroffenen verursacht, sondern auch betriebs- und volkswirtschaftliche Folgen nach sich zieht. Folglich ist Mobbing ein unternehmens- und gesellschaftsrelevantes Thema.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Forschungsstand
1.3 Vorgehensweise und Zielsetzung
2 Definition von Mobbing
3 Mobbinghandlungen
4 Mobbingarten
4.1 Übergriffe von Kollegen
4.2 Übergriffe von Untergebenen gegen einen Vorgesetzten
4.3 Übergriffe eines Vorgesetzten gegen Untergebene
5 Mobbingverläufe
6 Ausmaß von Mobbing
7 Ursachen von Mobbing
8 Folgen von Mobbing
8.1 Folgen für das Mobbingopfer
8.2 Folgen für die Organisation
8.3 Folgen für die Gesellschaft
9 Handlungsstrategien gegen Mobbing
9.1 Handlungsstrategien der Prävention
9.1.1 Arbeitsorganisatorische Maßnahmen
9.1.2 Sensibilisierung und Aufklärung über die Thematik Mobbing
9.1.3 Institutioneller Umgang mit Mobbing
9.1.4 Betriebs- oder Dienstvereinbarung
9.1.5 Unternehmensphilosophie
9.2 Handlungsstrategien der Intervention
9.2.1 Verhandlungs- und Schlichtungsverfahren
9.2.2 Konfliktbearbeitung durch externe Experten
9.2.3 Supervision
9.2.4 Mediation
9.2.5 Machteingriff durch den Arbeitgeber
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Mobbing ist keine Randerscheinung, sondern ein gravierendes soziales Problem, das in nahezu jedem Unternehmen anzutreffen ist. Die Ausfallkosten, die deutschen Unternehmen durch Mobbing entstehen, werden auf über 15 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es rund 1,27 Millionen Mobbingopfer in Deutschland gibt.[1] Leymann stellte die These auf, dass statistisch gesehen bei einer Arbeitslebenszeit von dreißig Jahren jeder vierte Erwerbstätige im Laufe seines Berufslebens einmal zum Opfer von Mobbing wird.[2]
Mobbing ist ein Modewort für ein gesellschaftliches Phänomen, das so alt ist wie das gemeinsame Arbeiten der Menschen. Es stammt aus dem Englischen und wurde von den skandinavischen Ländern in die Diskussion eingeführt. Die Sensibilität gegenüber der Problematik ist in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit kontinuierlich gestiegen.
Arbeits- und Sozialwissenschaftler, Mediziner und Vertreter anderer Disziplinen sowie Medien, Gewerkschaften und Krankenkassen haben sich gleichermaßen der Mobbingthematik zugewandt. In ihren Berichterstattungen erweist sich das Thema als aktuelle und relevante Problematik für Wirtschaft und Gesellschaft, da Mobbing nicht nur massive gesundheitliche Schäden bei den Betroffenen verursacht, sondern auch betriebs- und volkswirtschaftliche Folgen nach sich zieht. Folglich ist Mobbing ein unternehmens- und gesellschaftsrelevantes Thema.
1.2 Forschungsstand
Den Ausgangspunkt der Mobbingforschung bildeten arbeitsmedizinische Beobachtungen: Arbeitnehmer schieden aus dem Arbeitsleben aus, da sie psychisch und physisch so schwer angeschlagen waren, dass eine Wiedereingliederung in das Berufsleben oder sogar die Rückkehr in den normalen Lebensalltag unwahrscheinlich bis aussichtslos erschien. Keine der üblichen arbeitsmedizinischen Ursachen, wie z. B. Vergiftung, Verstrahlung, Arbeitsunfälle oder körperlicher Verschleiß, war dafür verantwortlich. Bei genauem Hinsehen entpuppten sich etliche dieser Fälle als langjährige berufliche Leidensgeschichten, bei denen Menschen jahrelang durch Arbeitskollegen oder Vorgesetzte ausgegrenzt und schikaniert wurden. Neben körperlichen und arbeitsplatzbedingten Ursachen tauchte nun ein Feld zwischenmenschlicher Feindschaft als mögliche Ursache von Arbeitsunfähigkeit auf.[3]
Betriebliche Probleme und Konflikte gab es zwar schon immer, aber erst der in Schweden lebende deutsche Betriebswirt und Psychologe Heinz Leymann hat den eingängigen Begriff dafür geprägt und theoretische Überlegungen zu Mobbing entwickelt. Die meisten bisher vorliegenden Untersuchungen stammen aus dem skandinavischen Raum. In Schweden wurde das Phänomen Mobbing zu Beginn der 90er Jahre von Wissenschaftlern um den wohl bekanntesten Mobbingforscher Heinz Leymann untersucht und beschrieben. In Deutschland existierten bisher keine abgesicherten wissenschaftlichen Daten explizit zu Mobbing. In Ermangelung empirisch fundierter Daten konnte deshalb in der Öffentlichkeit über das Ausmaß von Mobbing in der Bundesrepublik Deutschland und die Folgen nur gemutmaßt werden.
Eine der ersten Mobbinguntersuchungen im deutschsprachigen Raum wurde von Klaus Niedl in Österreich durchgeführt. Mitte bis gegen Ende der 90er Jahre wurden in der BRD mehrere Studien über Mobbing veröffentlicht, jedoch handelt es sich hierbei um fast ausschließlich nicht bundesweit repräsentative Erhebungen. Die empirische Untersuchung von Bärbel Meschkutat, Martina Stackelbeck und Georg Langenhoff im Jahr 2000 mittels Befragungen stellt erstmalig für die BRD repräsentative Daten zur Verfügung.
1.3 Vorgehensweise und Zielsetzung
Die folgende Hausarbeit zu dem Thema „Handlungsstrategien der Prävention und Intervention gegen Mobbing in sozialen Einrichtungen und Diensten“ ist eine Literaturstudie, deren methodischer Ansatz darstellend, beschreibend und bewertend ist.
Mein erkenntnisleitendes Interesse, welches der Arbeit zu Grunde liegt, beruht in der Frage: Welche Handlungsstrategien eignen sich seitens des Managements zur Vorbeugung und Auflösung von Mobbing in sozialen Einrichtungen und Diensten? Ziel der Arbeit ist die Darstellung präventiver und intervenierender Handlungsstrategien des Sozialmanagements gegen Mobbing sowie eine kritische Bewertung der dargestellten Handlungsstrategien gegen Mobbing in sozialen Einrichtungen und Diensten hinsichtlich der Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit.
In ihrer empirischen Repräsentativstudie kommen Bärbel Meschkutat, Martina Stackelbeck und Georg Langenhoff zu dem Ergebnis, dass das Mobbingrisiko je nach Berufsgruppe und Branche unterschiedlich verteilt ist: Ein überdurchschnittlich hohes Risiko, von Mobbing betroffen zu werden, liegt im sozialen Sektor, da dort Mobbing mehr verbreitet ist als in anderen Branchen und Berufsgruppen. Folglich ist die Auseinandersetzung mit der Thematik Mobbing für Sozialmanager relevant und bedeutenswert.
(vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 29 ff.; Pillardy 2001, S. 23)
Zu Beginn meiner Hausarbeit gehe ich der Frage nach, was Mobbing ist, indem ich die Wortherkunft und -bedeutung dieses Begriffs erläutere, Mobbing definiere, Mobbinghandlungen und Mobbingarten sowie Verläufe eines Mobbingprozesses vorstelle und das Ausmaß von Mobbing bezogen auf Branchen, Berufsgruppen, Organisationsgröße und Geschlechterzugehörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland darlege.
Im zweiten Kapitel setze ich mich mit Ursachen und Erklärungsansätzen zur Entstehung von Mobbing auseinander.
Im dritten Kapitel stelle ich mögliche Folgen von Mobbing vor. Dabei wird zwischen Folgen für das Mobbingopfer, für die Organisation und für die Gesellschaft unterschieden.
Im vierten Kapitel skizziere ich verschiedene Handlungsstrategien gegen Mobbing im Bereich der Prävention und Intervention. Die präventiven Handlungsstrategien gliedern sich in arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Sensibilisierung und Aufklärung über die Thematik Mobbing und in den institutionellen Umgang mit Mobbing auf. Die Handlungsstrategien der Intervention umfassen das Verhandlungs- und Schlichtungsverfahren, Konfliktbearbeitung durch externe Experten sowie den Machteingriff durch den Arbeitgeber.
Im letzten Kapitel bewerte ich die Anwendbarkeit der zuvor dargestellten Handlungsstrategien in sozialen Einrichtungen und Diensten nach den Kriterien Höhe der Kosten der Handlungsstrategien, Ergebniserfolg der Handlungsstrategien, Relation der Kostenhöhe zu dem erzielten Erfolg durch die Handlungsstrategien sowie Umsetzbarkeit in sozialen Einrichtungen und Diensten.
Abschließend im Fazit fasse ich die Ergebnisse meiner Hausarbeit zusammen und gebe einen Ausblick auf ungelöste Fragestellungen und weitergehenden Forschungsbedarf im Bereich der Mobbingthematik.
Der Fokus meiner Arbeit liegt auf den Handlungsstrategien der Prävention und Interven-tion gegen Mobbing seitens des Managements. Aus diesem Grund klammere ich bewusst die Handlungsstrategien und Möglichkeiten der persönlichen Gegenwehr seitens der Mobbingopfer aus, ebenso wie juristische Schritte und rechtliche Maßnahmen gegen Mobbing oder außerbetriebliche Unterstützungsangebote durch Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Ärzte, Psychologen und Juristen. Obwohl der Schwerpunkt meiner Arbeit auf den Handlungsstrategien gegen Mobbing liegt, erachte ich es als notwendig, zu Beginn einen kurzen Überblick über Mobbinghandlungen, -arten und -verläufe ebenso wie über die Ursachen und Folgen von Mobbing zu geben, um auf dieser Grundlage über wirkungsvolle und zielgerichtete Handlungsstrategien der Prävention und Intervention diskutieren zu können.
Obgleich ich Mobbing als einen Prozess zwischen Mitarbeitern verstehe, bei dem es zwar Verursacher gibt, Mobbing jedoch häufig nicht aus Vorsatz betrieben wird, spreche ich im Folgenden trotzdem von Mobbingopfern und Mobbingtätern, um die beiden Positionen zu verdeutlichen.
Der Einfachheit und der besseren Lesbarkeit halber gebrauche ich überwiegend nur die maskuline Form anstelle der maskulinen und femininen Form nebeneinander, es sei denn, das Gesagte bezieht sich ausdrücklich auf eine Frau.
2 Definition von Mobbing
Das Kunstwort „Mobbing“ ist dem englische Verb „(to) mob“ entlehnt. Der Ursprung dafür liegt in der lateinischen Bezeichnung „mobile vulgus“, was so viel bedeutet wie „wankelmütige Masse“. Das englische Substantiv „mob“ wird als „Pöbel“, „Mob“ , „Gesindel“ oder „(Ver-brecher-) Bande“ übersetzt. Als Verb hat das Wort die Bedeutung „ anpöbeln“, „sich stürzen auf“, „herfallen über“, „angreifen“, „attackieren“ oder „bedrängen“.
Verwandte englische Begriffe sind „bullying“ und „bossing“. „Bullying“ hat die Bedeutung „tyrannisieren“, „schikanieren“, „einschüchtern“ und wird in der wissenschaftlichen Literatur synonym zu „Mobbing“ verwendet. Für die systematische Schikane von Mitarbeitern durch Vorgesetzte kristallisiert sich der Begriff „bossing“ heraus.
Für Attacken, die von Mitarbeitern gegen Vorgesetzte gerichtet sind, wurde der Begriff „staffing“ geprägt.[4]
Der österreichische Verhaltensforscher Konrad Lorenz benutzte den Begriff „Mobbing“ erstmals in den 50er Jahren im wissenschaftlichen Kontext und charakterisierte damit ein Angriffsverhalten einer Gruppe unterlegener Tiere gegen ein stärkeres Tier, um den Gegner zu verscheuchen.
Der schwedische Arzt Peter-Paul Heinemann übertrug diese Bezeichnung 1969 in den Bereich der Humanbeziehungen und etikettierte damit eine bestimmte Art von Gruppengewalt unter Kindern.[5]
In der wissenschaftlichen Literatur wird Mobbing nicht einheitlich definiert. Es herrscht unter den Autoren noch weitgehend Uneinigkeit darüber, was Mobbing eigentlich ist, wo Mobbing anfängt und wo Mobbing aufhört. Alle Definitionsansätze stimmen jedoch darin überein, dass sich Mobbing durch wiederholende, über einen längeren Zeitraum andauernde negative Handlungen auszeichnet. Mobbing stellt sich damit nicht als Singulärakt dar.[6]
Die vielfach in der Fachliteratur zitierte allgemeine Definition des Pioniers in der Forschung auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz, Prof. Dr. Heinz Leymann, lautet:
„Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen.“[7]
Leymann legt diese Definition seinen empirischen Erhebungen aus umfangreichen Untersuchungen in Schweden Mitte der achtziger Jahre zugrunde. Die Merkmale von Mobbing sind laut Leymann Konfrontation, Belästigung, Nichtachtung der Persönlichkeit und Häufigkeit der Angriffe über einen längeren Zeitraum hinweg.[8]
Der Psychologe Berndt Zuschlag kritisiert an dieser allgemeinen Definition von Leymann zum einen die Beschränkung auf `kommunikative´ Handlungen und zum anderen die Feststellung, dass Mobbing jeweils nur gegen eine Person gerichtet sei.[9]
Die von Leymann mitgegründete „Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing e. V.“ entwickelte Leymanns Definition wie folgt weiter:
„Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit dem Ziel und / oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet.“[10]
[...]
[1] vgl. Esser/Wolmerath 1999, S. 17
[2] vgl. Holzbecher/Meschkutat 1999, S. 4
[3] vgl. Esser/Wolmerath 1999, S. 19
[4] vgl. Brinkmann 1995, S. 12; Brockhaus Enzyklopädie 1971, Bd. 12, S. 665 ; Haben/Harms-Böttcher 2000, S. 11; Holzbecher/Meschkutat 1999, S. 3; Langenscheidt Wörterbuch 1990, S. 382; Neuberger 1999, S. 3; Zuschlag 1997, S. 3 f.
[5] vgl. Esser/Wolmerath 1999, S. 20; Haben/Harms-Böttcher 2000, S. 11; Pillardy 2001, S.15; Schlaugat 1999, S. 4
[6] vgl. Niedl 1995, S. 20 f.; Prosch 1995, S. 12; Schlaugat 1999, S. 12
[7] Leymann 1997, S. 21
[8] vgl. Leymann 1997, S. 22
[9] vgl. Zuschlag 1997, S. 4 f.; Brinkmann 1995, S. 14
[10] Leymann 1995, S. 18
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing am Arbeitsplatz definiert?
Mobbing bezeichnet systematische Schikanen, Ausgrenzung oder Benachteiligung durch Kollegen oder Vorgesetzte über einen längeren Zeitraum.
Welche wirtschaftlichen Folgen hat Mobbing in Deutschland?
Die jährlichen Ausfallkosten für deutsche Unternehmen werden auf über 15 Milliarden Euro geschätzt.
Welche Mobbingarten gibt es?
Man unterscheidet zwischen Mobbing unter Kollegen, Mobbing durch Vorgesetzte (Bossing) und Mobbing gegen Vorgesetzte (Staffing).
Was sind präventive Strategien gegen Mobbing?
Dazu gehören arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Aufklärung der Belegschaft, Betriebsvereinbarungen und eine klare Unternehmensphilosophie.
Welche Interventionsmöglichkeiten hat das Management?
Mögliche Maßnahmen sind Schlichtungsverfahren, Mediation, Supervision oder im Extremfall der Machteingriff durch den Arbeitgeber (z. B. Abmahnung).
- Arbeit zitieren
- Sabrina Heuer (Autor:in), 2008, Mobbing - ein Überblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137231