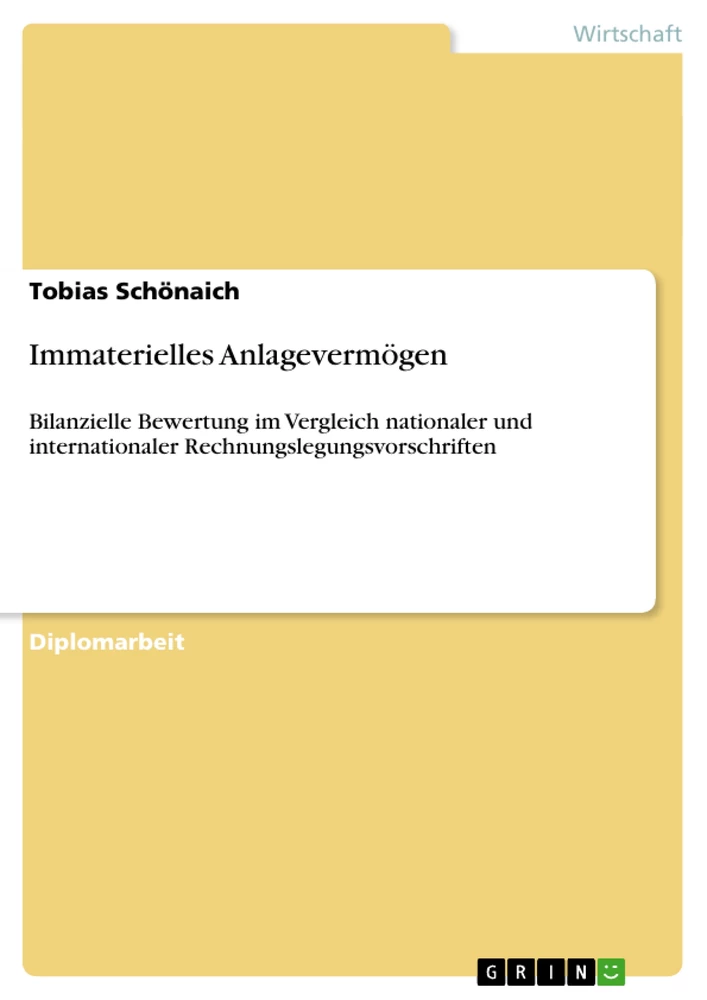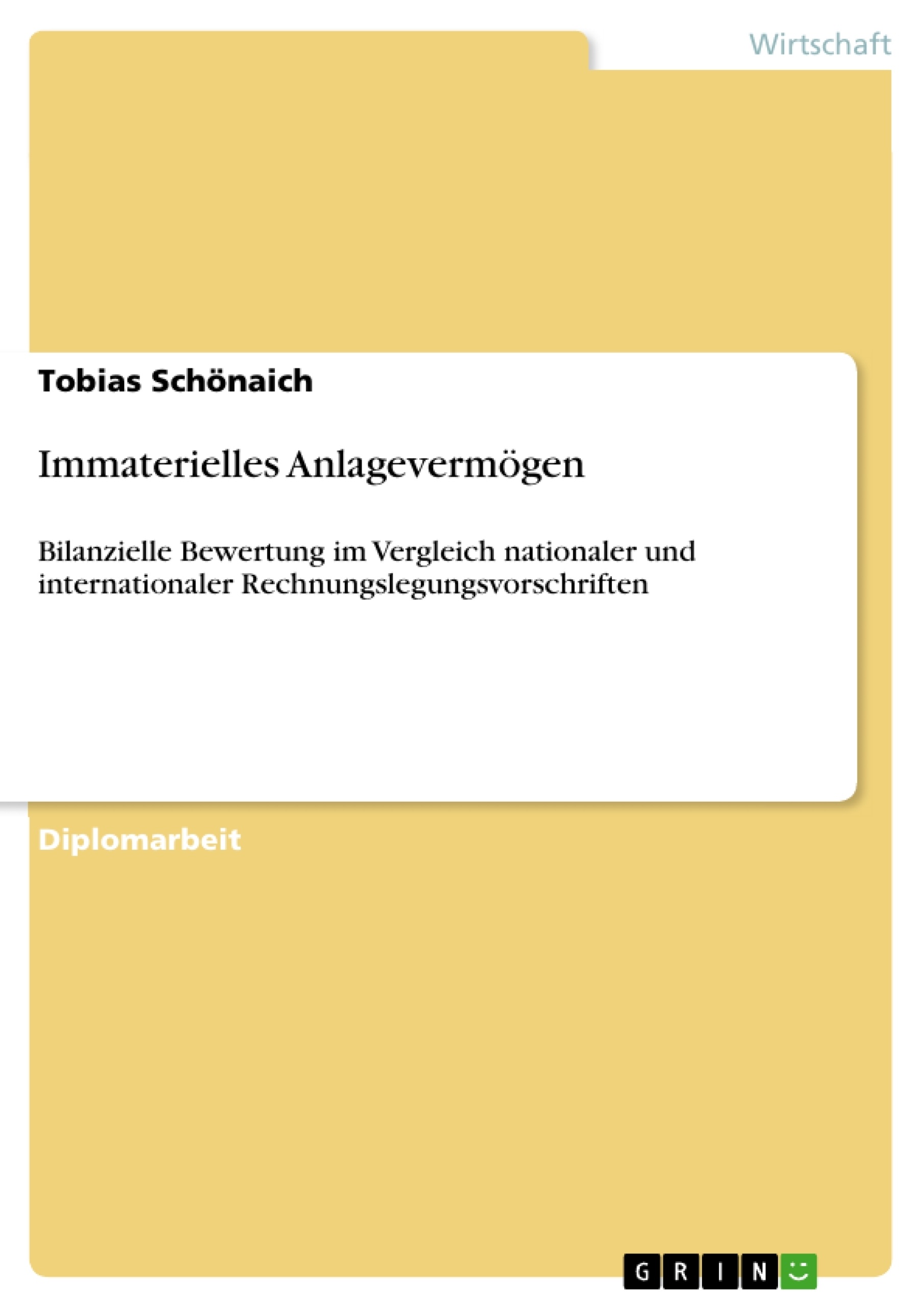Durch zunehmende Globalisierung und stetigen weltwirtschaftlichen Wandel werden hinsichtlich des Bedürfnisses nach internationaler Vergleichbarkeit der Bilanzen neue Anforderungen an inländische und ausländische Unternehmen gestellt.
Konzernabschlüsse können bzw. müssen mittlerweile anstatt nach nationalen auch nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften verfasst werden. Mittelfristig werden diese Standards wohl auch die nach deutschem Handelrecht erstellten Einzelabschlüsse ersetzen.1
Seit dem 01.01.2005 sind europäische kapitalmarktorientierte Unternehmen dazu verpflichtet, erstmalig einheitliche Rechnungslegungsstandards in Form der International Financial Reporting Standards (IFRS) anzuwenden. Für nicht börsennotierte Unternehmen können die jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten nach Verordnung 16062 erlauben, den Jahresabschluss entweder nach nationalen oder inter-nationalen Standards aufzustellen.3
Unternehmen, die auch auf dem amerikanischen Markt agieren, sind zum Teil dazu verpflichtet, ihren Abschluss nach den United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) zu erstellen. Diese sind den IFRS von Aufbau und Struktur her sehr ähnlich. Langfristig kann davon ausgegangen werden, dass diese beiden Formen der Rechnungslegung mehr und mehr verschmelzen und sich daraus einheitliche Standards der Konzernrechnungslegung ergeben.4
Im Rahmen dieser Entwicklung löst sich Deutschland zunehmend von den bisher im Handelsgesetzbuch (HGB) festgelegten Rechnungslegungsgrundsätzen und wendet sich handelsrechtlich immer stärker internationalen Bilanzierungsregeln zu.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Grundsätze und Begriffsabgrenzung
- 2.1 Grundlagen der Rechnungslegung und deren wichtigste Ausprägungen
- 2.1.2.1 Handelsgesetzbuch (HGB)
- 2.1.2.2 International Financial Reporting Standards (IFRS)
- 2.1.2.3 United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP)
- 2.1.2.4 Grundlegende Unterschiede von HGB, IFRS und US-GAAP
- 2.2 Funktion und Untergliederung des Anlagevermögens
- 2.2.1 nach HGB
- 2.2.2 nach IFRS
- 2.2.3 nach US-GAAP
- 3. Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens
- 3.1 Definition immaterieller Vermögenswerte
- 3.1.1 nach HGB
- 3.1.2 nach IFRS
- 3.1.3 nach US-GAAP
- 3.2 Bilanzierung selbst erstellter bzw. erworbener immaterieller Vermögenswerte
- 3.2.1 nach HGB
- 3.2.2 nach IFRS
- 3.2.3 nach US-GAAP
- 3.3 Der originäre bzw. derivative Geschäftswert
- 3.3.1 Definition des Geschäftswertes
- 3.3.2 Bilanzierung des Geschäftswertes
- 3.3.2.1 nach HGB
- 3.3.2.2 nach IFRS
- 3.3.2.3 nach US-GAAP
- 4. Synoptische Darstellung der Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens
- 4.1 Vergleich der Unterschiede zwischen HGB, IFRS und US-GAAP
- 4.2 Vor- bzw. Nachteile der Bilanzierung nach HGB im Überblick
- 4.3 Vor- bzw. Nachteile der Bilanzierung nach IFRS im Überblick
- 4.4 Vor- bzw. Nachteile der Bilanzierung nach US-GAAP im Überblick
- 5. Schlussbemerkung und Ausblick in die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die bilanzielle Bewertung von immateriellem Anlagevermögen unter Berücksichtigung nationaler (HGB) und internationaler Rechnungslegungsvorschriften (IFRS und US-GAAP). Ziel ist es, die Unterschiede in der Behandlung und Bilanzierung aufzuzeigen und die jeweiligen Vor- und Nachteile zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögenswerte nach HGB, IFRS und US-GAAP
- Bilanzierung selbst erstellter und erworbener immaterieller Vermögenswerte
- Bilanzierung des Geschäftswertes nach den verschiedenen Rechnungslegungsstandards
- Vergleich der Bilanzierungsmethoden und deren Auswirkungen
- Vor- und Nachteile der einzelnen Bilanzierungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt den Hintergrund und die Relevanz der Untersuchung der unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards für die Bewertung von immateriellem Anlagevermögen. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik.
2. Allgemeine Grundsätze und Begriffsabgrenzung: Kapitel 2 legt die Grundlagen für das Verständnis der unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP). Es erklärt die jeweiligen Prinzipien, deren Sinn und Zweck und beschreibt die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Systemen. Die Gliederung und Funktion des Anlagevermögens wird im Kontext der jeweiligen Standards analysiert. Dies bildet die Basis für die detaillierte Betrachtung der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte in den nachfolgenden Kapiteln.
3. Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens: Kapitel 3 widmet sich der Kernfrage der Arbeit: der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte. Es differenziert zwischen selbst erstellten und erworbenen immateriellen Vermögenswerten und erklärt deren Behandlung nach HGB, IFRS und US-GAAP. Besonders ausführlich wird die Bilanzierung des Geschäftswertes behandelt, mit detaillierten Erläuterungen zu den jeweiligen Vorschriften und deren Implikationen. Der Vergleich der verschiedenen Ansätze wird hier bereits angedeutet.
4. Synoptische Darstellung der Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Vergleich der Bilanzierung von immateriellem Anlagevermögen nach HGB, IFRS und US-GAAP. Es werden die wesentlichen Unterschiede, sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Standards in übersichtlicher Form dargestellt. Diese Zusammenfassung erleichtert den Vergleich und die Bewertung der unterschiedlichen Ansätze.
Schlüsselwörter
Immaterielles Anlagevermögen, Bilanzierung, Rechnungslegung, HGB, IFRS, US-GAAP, Geschäftswert, Vergleich, Bewertung, national, international.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Bilanzierung immateriellen Anlagevermögens nach HGB, IFRS und US-GAAP
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die bilanzielle Bewertung von immateriellem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der nationalen (HGB) und internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS und US-GAAP). Das Ziel ist der Vergleich der unterschiedlichen Behandlungen und Bilanzierungsmethoden sowie die Analyse der jeweiligen Vor- und Nachteile.
Welche Rechnungslegungsstandards werden betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens nach drei wichtigen Rechnungslegungsstandards: dem Handelsgesetzbuch (HGB), den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögenswerte nach HGB, IFRS und US-GAAP; Bilanzierung selbst erstellter und erworbener immaterieller Vermögenswerte; Bilanzierung des Geschäftswerts nach den verschiedenen Standards; Vergleich der Bilanzierungsmethoden und deren Auswirkungen; Vor- und Nachteile der einzelnen Bilanzierungsansätze.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Allgemeine Grundsätze und Begriffsabgrenzung (inkl. Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB, IFRS und US-GAAP und der Funktion des Anlagevermögens), Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens (inkl. Definition immaterieller Vermögenswerte und Bilanzierung des Geschäftswerts), Synoptische Darstellung der Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens (Vergleich der Unterschiede zwischen HGB, IFRS und US-GAAP und deren Vor- und Nachteile) und Schlussbemerkung und Ausblick.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen HGB, IFRS und US-GAAP bezüglich der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte?
Die Arbeit detailliert die Unterschiede in der Definition, Bewertung und Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte, einschließlich des Geschäftswerts, nach HGB, IFRS und US-GAAP. Ein separates Kapitel bietet einen umfassenden Vergleich.
Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Bilanzierungsansätze?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile der Bilanzierung nach HGB, IFRS und US-GAAP für immaterielle Vermögenswerte, um die jeweiligen Stärken und Schwächen aufzuzeigen und einen fundierten Vergleich zu ermöglichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Immaterielles Anlagevermögen, Bilanzierung, Rechnungslegung, HGB, IFRS, US-GAAP, Geschäftswert, Vergleich, Bewertung, national, international.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit der Rechnungslegung und der Bewertung von immateriellem Anlagevermögen befassen, insbesondere an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Finanzberichterstattung.
- Arbeit zitieren
- Tobias Schönaich (Autor:in), 2009, Immaterielles Anlagevermögen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137252