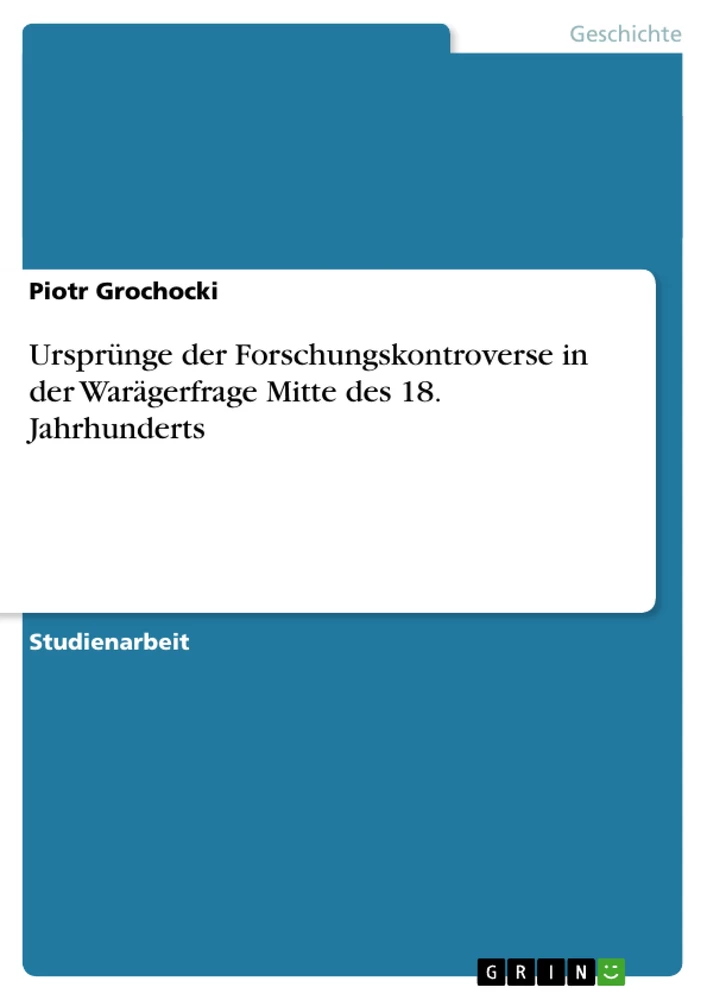Das politische Verhältnis der Russischen Föderation zum westlichen Europa ist zurzeit nicht ganz spannungsfrei. Das autoritäre Gehabe des derzeitigen russischen Präsidenten sowie die Naivität mancher westeuropäischer Regierungschefs tragen das Ihre dazu bei. Auch die historische Disziplin war in ihrer Geschichte manches Mal von politischen Erwägungen beeinflusst. Deutlich wird dies am Beispiel der Forschungskontroverse rund um die Warägerfrage, die Mitte des 18. Jahrhunderts an der Akademie von St. Petersburg entstand. Der Grund dieses Streits war die Frage, ob und inwieweit die Rus’ des 9. und 10. Jahrhunderts, die erste Herrschaftsbildung auf ostslavischem Boden, durch normannische Zuwanderer geprägt wurde. Dabei standen sich zwei feindlich gesinnte Lage gegenüber: Einerseits die Normannisten, welche die These von der nordgermanischen Herkunft der Rus’ verfochten, und andererseits die Antinormannisten, welche die These von der autochtonen slavischen Herrschaftsbildung vertraten. Der Hauptprotagonist bei den Normannisten war der deutsche Historiker Gerhard Friedrich Müller, der sich durch langjährige Forschungen zur russischen Geschichte einen hervorragenden Ruf erworben hatte, dessen Forschungsergebnisse in einer politisch schwierigen Lage jedoch nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Der Hauptvertreter der Antinormannisten war der russische Universalgelehrte Michail Vasil’evič Lomonosov, der in der Sache vielleicht kein ausgewiesener Spezialist war1, dessen Ansichten aber besser in das herrschende politische Klima passten.
Die vorliegende Arbeit versucht sich diesem Thema auf folgende Weise zu nähern: Zunächst wird die Entstehungsgeschichte der Kontroverse erläutert anhand der Werke, die dafür maßgeblich waren. Dann wird auf die beiden Lager näher eingegangen und die Hauptprotagonisten vorgestellt. Anschließend wird kurz der weitere Verlauf des Streits dargestellt, an dem sich auch andere Gelehrte verschiedenster Disziplinen beteiligt haben. Die Forschungsliteratur auf diesem Gebiet ist umfangreich, jedoch sind viele Arbeiten nur auf russisch zugänglich. Da der Autor dieser Sprache nicht mächtig ist, wird hier nur auf die in deutsch oder englisch erhältlichen Werke zurückgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Ursprünge der Forschungskontroverse in der Warägerfrage
1. Die Entstehung der Kontroverse
2. Die Hauptprotagonisten
2.1. Gerhard Friedrich Müller
2.2. Michail Vasil’evič Lomonosov
3. Der Fortgang des Forschungsstreits
III. Schlussbetrachtung
IV. Anhang
Quellen
Darstellungen
I. Einleitung
Das politische Verhältnis der Russischen Föderation zum westlichen Europa ist zurzeit nicht ganz spannungsfrei. Das autoritäre Gehabe des derzeitigen russischen Präsidenten sowie die Naivität mancher westeuropäischer Regierungschefs tragen das Ihre dazu bei. Auch die historische Disziplin war in ihrer Geschichte manches Mal von politischen Erwägungen beeinflusst. Deutlich wird dies am Beispiel der Forschungskontroverse rund um die Warägerfrage, die Mitte des 18. Jahrhunderts an der Akademie von St. Petersburg entstand. Der Grund dieses Streits war die Frage, ob und inwieweit die Rus’ des 9. und 10. Jahrhunderts, die erste Herrschaftsbildung auf ostslavischem Boden, durch normannische Zuwanderer geprägt wurde. Dabei standen sich zwei feindlich gesinnte Lage gegenüber: Einerseits die Normannisten, welche die These von der nordgermanischen Herkunft der Rus’ verfochten, und andererseits die Antinormannisten, welche die These von der autochtonen slavischen Herrschaftsbildung vertraten. Der Hauptprotagonist bei den Normannisten war der deutsche Historiker Gerhard Friedrich Müller, der sich durch langjährige Forschungen zur russischen Geschichte einen hervorragenden Ruf erworben hatte, dessen Forschungsergebnisse in einer politisch schwierigen Lage jedoch nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Der Hauptvertreter der Antinormannisten war der russische Universalgelehrte Michail Vasil’evič Lomonosov, der in der Sache vielleicht kein ausgewiesener Spezialist war[1], dessen Ansichten aber besser in das herrschende politische Klima passten.
Die vorliegende Arbeit versucht sich diesem Thema auf folgende Weise zu nähern: Zunächst wird die Entstehungsgeschichte der Kontroverse erläutert anhand der Werke, die dafür maßgeblich waren. Dann wird auf die beiden Lager näher eingegangen und die Hauptprotagonisten vorgestellt. Anschließend wird kurz der weitere Verlauf des Streits dargestellt, an dem sich auch andere Gelehrte verschiedenster Disziplinen beteiligt haben. Die Forschungsliteratur auf diesem Gebiet ist umfangreich, jedoch sind viele Arbeiten nur auf russisch zugänglich. Da der Autor dieser Sprache nicht mächtig ist, wird hier nur auf die in deutsch oder englisch erhältlichen Werke zurückgegriffen.
II. Ursprünge der Forschungskontroverse in der Warägerfrage
1. Die Entstehung der Kontroverse
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Warägerfrage im modernen Sinne begann 1724 mit der Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg durch Peter den Großen. Natürlich waren es zu dieser Zeit vor allem die Historiker, die ihre Meinung dazu abgaben. Unter ihnen ist zunächst Gottlieb Siegfried Bayer zu nennen, der aufgrund seiner Artikel De Varagis (1735) und Origines Russicae (1741) als Begründer der „wissenschaftlich fundierten Normannentheorie“[2] gilt. Sein großer Verdienst um die Wissenschaft war, dass er in seinen Arbeiten über die Waräger und die Rus’ eine Vielzahl von nicht-russischen Quellen heranzog, die seither im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Bis dahin wurde vor allem auf die Darstellung in der Povest’ vremennych let, der so genannten Nestorchronik, zurückgegriffen. Diese in den Jahren 1111 bis 1113 wahrscheinlich vom Mönch Nestor im Höhlenkloster außerhalb von Kiew herausgegebene und zum Teil verfasste Chronik ist bis heute die wichtigste historische Quelle, auf der die Diskussion basiert.[3] Daher hier ein Auszug der für die Warägerfrage wichtigen Stellen:
„Im Jahre 6367 (859). Die Varäger kamen über das Meer und erhoben Tribut von den Čuden und Slovenen, von den Meriern und Vesen und Krivičen; die Chazaren aber nahmen Tirbut von den Poljanen und Severjanen und Vjatičen: Sie nahmen je ein weißes Eichhorn von jedem Rauchfang.
[...]
Im Jahre 6370 (862). [I] Sie verjagten die Varäger über das Meer und begannen sich selbst zu regieren. Und es gab unter ihnen kein Recht, und Sippe stand auf gegen Sippe, und es waren unter ihnen Fehden, und sie begannen widereinander zu kämpfen. Und sie sprachen zueinander: „Wir wollen uns einen Fürsten suchen, der über uns herrsche und gerecht richte.“ Und gingen über das Meer zu den Varägern, zu den Russen, denn so hießen diese Varäger Russen, wie andere Schweden hießen, andere Norweger und Angeln, andere Gotländer: so auch diese. Sprachen zu den Russen die Čuden, Slovenen, Krivičen und Vesen: „Unser Land ist groß und reich, doch es ist keine Ordnung in ihm; so kommt über uns herrschen und gebieten.“
[II] Und die drei Brüder wurden erwählt samt ihren Sippen, und sie nahmen alle Russen mit sich und kamen. Rjurik, der ältere, ließ sich in Novgorod nieder, der zweite Sineus am Beloozero, der dritte Truvor in Izborsk. Und nach diesen Varägern wurde das russische Land Novgorod genannt, und die Novgoroder sind vom varägischen Geschlecht, früher nämlich waren sie Slovenen.
[III] Nach zwei Jahren starb Sineus und sein Bruder Truvor, und Rjurik bekam die Herrschaft und teilte an seine Mannen Städte aus, an den einen Polock, an den anderen Rostov, an den dritten Beloozero. Und in diesen Städten sind die Varäger Ankömmlinge; die ersten Ansiedler aber in Novgorod sind die Slovenen, in Polock die Krivičen, in Rostov die Merier, am Beloozero die Vesen, in Murom die Muromer; und über diese alle herrschte Rjurik.“[4]
Wie unschwer zu erkennen ist, besteht der offensichtlich zusammenhängende Bericht aus vier unabhängigen Elementen, von denen drei deutlich legendärer Natur sind: I. die Legende von der Berufung selbst, II. die Legende von den drei auserwählten Brüdern, III. die Legende von der Gründung des (nord-) rus’ischen Staates. Zu diesen sind als viertes Element die Erweiterungen des Chronisten über die Identität der Rus’ und der Waräger hinzugefügt.[5] Es sollte auch erwähnt werden, dass der Bericht, wie er bei anderen russischen Chronisten des Mittelalters vorliegt, verschiedene Abweichungen vom hier wiedergegebenen Text enthält. Gemäß der Hypatius-Chronik bauten die drei Brüder zunächst Staraja Ladoga, wo sich Rjurik ansiedelte. Nach dem Tod seiner Brüder gründete Rjurik Novgorod und zog dorthin um. Andere Varianten, vielleicht desselben Ursprungs, finden sich in der nicht erhaltenen Joakim-Chronik, die der Historiker Tatiščev beschreibt, und in der Nikon-Chronik. Hier wird überliefert, dass vor der Berufung eine Versammlung der Stammesältesten (oder des Volkes) in Novgorod stattfand, auf der einer der Ältesten, Gostomysl (bei Tatiščev wird er König genannt), empfahl, nach einem warägischen König zu schicken. Ein Aufstand gegen Rjurik, geführt von Vadim dem Tapferen, als Antwort auf Rjuriks Unterdrückung der Slaven, wird ebenfalls erwähnt. Rjurik setzte sich jedoch durch. Obwohl diese Varianten jüngeren Ursprungs als Nestors Darstellung sein könnten, kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie Elemente einer sehr alten Novgoroder Überlieferung enthalten. In jedem Fall mahnt ihre Existenz zur Vorsicht in der Bewertung der Nestor-Variante als Quelle.[6]
Dennoch gibt es keinen Zweifel, dass Nestors Erklärung für die Herkunft des rus’ischen Volkes die russische Überlieferung bis ins 18. Jahrhundert hinein beherrschte: demnach waren die Rus’ ein warägisches Volk, und die Waräger waren Normannen, genauer gesagt Schweden. Allerdings ist zu betonen, dass andere Erklärungen für den Ursprung des Namens Rus’ in byzantinischen, arabischen, polnischen und westeuropäischen mittelalterlichen Quellen zu finden sind, und dass einige davon schon zu einem frühen Zeitpunkt in Russland bekannt waren. Erwähnenswert ist auch eine Theorie russischer Gelehrter des 16. Jahrhundert, wonach das Volk der Rus’ laut dem griechischen Geographen Strabo mit den Roxolana identisch ist.[7]
[...]
[1] Dimitri Obolensky: The Varangian-Russian Controversy: The First Round. In: Ders.: The Byzantine Inheritance of Eastern Europe. London 1982, S. 232-242, hier S. 236.
[2] Birgit Scholz: Von der Chronistik zur modernen Geschichtswissenschaft. Die Warägerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen Historiographie. Wiesbaden 1995 (= Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Reihe Forschungen zum Ostseeraum, Band 5), S. 343.
[3] Vgl. Knud Rahbek Schmidt: The Varangian Problem. A brief history of the controversy. In: Knud Hannestad: Varangian problems. Kopenhagen 1970 (= Scando-Slavica Supplementum 1), S. 7-20.
[4] Reinhold Trautmann (Hg.): Die altrussische Nestorchronik. Povest’ vremennych let. Leipzig 1931, S. 11.
[5] Vgl. Schmidt: The varangian problem, S. 9.
[6] Vgl. ebd.
[7] Vgl. Hartmut Rüß: Das Reich von Kiev. In: Hellmann, Manfred (Hg.): Handbuch der Geschichte Russlands. Band 1: Bis 1613. Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum. Stuttgart 1981, S. 200-429, hier S. 275.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die sogenannte Warägerfrage?
Die Warägerfrage ist eine historische Kontroverse darüber, ob die Gründung der Kiever Rus' im 9. Jahrhundert maßgeblich durch normannische (skandinavische) Zuwanderer beeinflusst wurde oder autochthon slawischen Ursprungs war.
Wer waren die Hauptgegner im Forschungsstreit des 18. Jahrhunderts?
Es standen sich der deutsche Historiker Gerhard Friedrich Müller (Vertreter des Normannismus) und der russische Universalgelehrte Michail Lomonosov (Vertreter des Antinormannismus) gegenüber.
Was ist die Nestorchronik?
Die Nestorchronik (Povest’ vremennych let) ist die wichtigste schriftliche Quelle für die Frühgeschichte Russlands. Sie berichtet von der „Berufung der Waräger“ durch slawische Stämme, um Ordnung im Land zu schaffen.
Warum hatte der Streit eine politische Dimension?
Die These, dass der russische Staat von Ausländern gegründet wurde, galt im 18. Jahrhundert als politisch heikel und unpatriotisch, weshalb Lomonosovs slawische Ursprungsthese besser in das herrschende Klima passte.
Wer gilt als Begründer der wissenschaftlichen Normannentheorie?
Gottlieb Siegfried Bayer gilt aufgrund seiner methodischen Heranziehung nicht-russischer Quellen in seinen Artikeln ab 1735 als Begründer der wissenschaftlich fundierten Normannentheorie.
- Arbeit zitieren
- M.A. Piotr Grochocki (Autor:in), 2007, Ursprünge der Forschungskontroverse in der Warägerfrage Mitte des 18. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137448