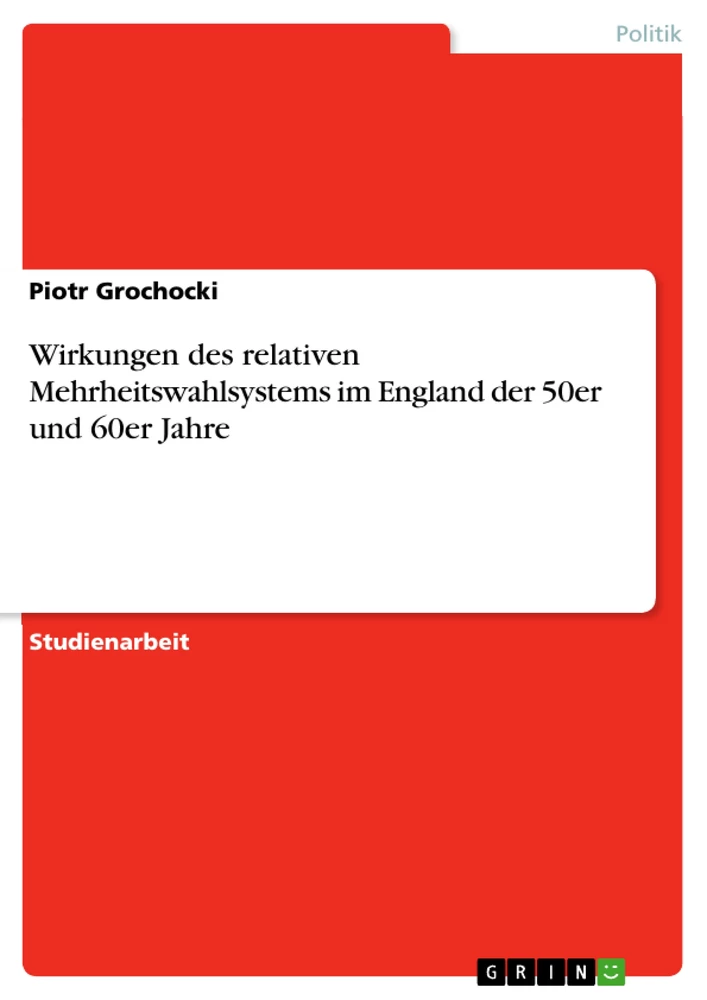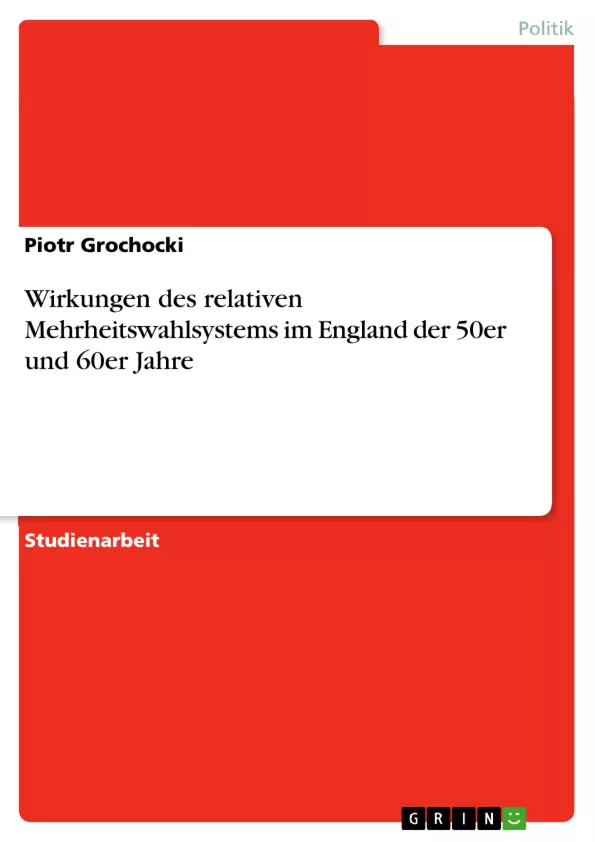Zunächst ein kleiner Einblick in die Parteienlandschaft Englands der 50er und 60er Jahre, die sich bis heute kaum verändert hat. Das dortige Parteiensystem ist durch die beiden großen Parteien gekennzeichnet: auf der einen Seite die konservativen Tories, auf der anderen die aus der Arbeiterbewegung entstandene Labour-Party. Es ist jedoch nicht immer leicht, das Zwei- vom Vielparteiensystem zu unterscheiden, da es neben den beiden großen Parteien vielfach noch kleinere Gruppen gibt. In England kann z.B. die liberale Partei auf eine lange und solide Tradition zurückblicken und entspricht auch heute noch der Einstellung eines bedeutenden Teils des britischen Volkes. Mehr als 2 600 000 Wähler schenkten ihr 1950 das Vertrauen. Aber eine größere Zahl von Wählern stand ihrer Sache zwar nahe, sah sich aber durch das Wahlsystem gezwungen, sich von ihr abzuwenden. Somit wurde in England das Prinzip des Zweiparteiensystems, auch Parteiendualismus genannt, nicht beeinträchtigt.
Gliederung
A EINLEITUNG
B HAUPTTEIL
1. Parteiendualismus und Wahlsystem
2. Die Mehrheitspartei im britischen Wahlsystem
3. Besonderheiten des britischen Wahlsystems
4. Der Kampf um die Mitte
5. Die Willensbildung in den Parteien
6. Vorteile des britischen Wahlsystems
7. Nachteile des britischen Wahlsystems
C SCHLUSS
Literaturverzeichnis
A EINLEITUNG
Zunächst ein kleiner Einblick in die Parteienlandschaft Englands der 50er und 60er Jahre, die sich bis heute kaum verändert hat. Das dortige Parteiensystem ist durch die beiden großen Parteien gekennzeichnet: auf der einen Seite die konservativen Tories, auf der anderen die aus der Arbeiterbewegung entstandene Labour-Party. Es ist jedoch nicht immer leicht, das Zwei- vom Vielparteiensystem zu unterscheiden, da es neben den beiden großen Parteien vielfach noch kleinere Gruppen gibt. In England kann z.B. die liberale Partei auf eine lange und solide Tradition zurückblicken und entspricht auch heute noch der Einstellung eines bedeutenden Teils des britischen Volkes. Mehr als 2 600 000 Wähler schenkten ihr 1950 das Vertrauen.[1] Aber eine größere Zahl von Wählern stand ihrer Sache zwar nahe, sah sich aber durch das Wahlsystem gezwungen, sich von ihr abzuwenden. Somit wurde in England das Prinzip des Zweiparteiensystems, auch Parteiendualismus genannt, nicht beeinträchtigt.
B HAUPTTEIL
1. Parteiendualismus und Wahlsystem
Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung eines Parteiendualismus ist das Wahlsystem, in diesem Fall die relative Mehrheitswahl. Es lässt sich ein fast allgemeiner Zusammenhang zwischen einfacher Mehrheitswahl und Zweiparteiensystem feststellen. Als Beispiel soll ein Wahlkreis in England dienen, in dem die Konservativen 35 000, die Arbeiterpartei 40 000 und die Liberalen 15 000 Stimmen erhalten haben.[2] Hier wird klar, dass der Erfolg der Arbeiterpartei allein dem Bestehen der liberalen Partei zu verdanken ist. Wenn diese ihren Kandidaten zurückzöge, dann würde vermutlich die Mehrheit der für ihn abgegebenen Stimmen dem Konservativen zugute kommen, während eine Minderheit teils für den Labour-Kandidaten stimmen, teils sich ihrer Stimme enthalten würde. Es gibt also zwei Möglichkeiten: Entweder verständigt sich die liberale Partei mit den Konservativen, zieht ihren Kandidaten zurück und bekommt dafür einen entsprechenden Ausgleich in anderen Wahlkreisen. In diesem Fall ist der Dualismus durch Fusion oder eine der Fusion sehr nahe kommende Abmachung hergestellt. „Oder die liberale Partei besteht auf ihrem eigenen Kandidaten – dann werden die Wähler ihn allmählich verlassen, und der Dualismus stellt sich durch seine Ausschaltung her.“[3]
Diese Ausschaltung ist wiederum das Resultat zweier zusammenwirkender Faktoren, eines mechanischen und eines psychologischen.[4] Der erstere besteht in der unverhältnismäßigen Benachteiligung der dritten Partei, deren Anteil an Abgeordnetensitzen unter ihrem Stimmenanteil bleibt. Zwar wird der Unterlegene bei der Mehrheitswahl und dem Zweiparteiensystem im Verhältnis zum Sieger immer benachteiligt, aber im Falle einer dritten Partei ist deren Benachteiligung größer als die des Unterlegenen der beiden anderen Parteien. Solange also eine neue Partei, die versucht, mit den beiden alten zu konkurrieren, zu schwach ist, arbeitet das System gegen sie und „errichtet einen Wall gegen ihr Aufkommen“[5]. Wenn es ihr aber gelingt, einen der Vorgänger zu überbieten, gerät dieser in die Lage der dritten Partei und der Prozess der Ausschaltung wirkt sich auf ihn aus.
Auch der psychologische Faktor hat zwei Seiten. Kommt es bei der relativen Mehrheitswahl zu einem Dreiparteiensystem, werden die Wähler bald begreifen, dass ihre Stimmen verloren sind, wenn sie sie weiter für die dritte Partei abgeben, und sie werden sie eher auf den weniger unangenehmen Kandidaten der beiden großen Parteien zu übertragen, um den Erfolg des noch unangenehmeren Kandidaten zu verhindern. Diese „Polarisation“[6] wirkt sich solange zuungunsten einer neuen Partei aus, wie sie noch die schwächste ist, wendet sich aber gegen den früheren Gegner, sobald dieser schwächer wird. Die Auswirkungen sind also dieselben wie bei der mechanischen Benachteiligung. Der Wechsel von dem einen auf den anderen Faktor vollzieht sich nicht immer gleichzeitig, der psychologische geht gewöhnlich dem mechanischen voraus.[7] Denn ein gewisser Abstand ist vonnöten, um sich des Rückgangs einer Partei bewusst zu werden und seine Stimme auf eine andere zu übertragen. Das hat lange Zeiträumen der Unsicherheit zu Folge, während derer die Zurückhaltung der Wähler sich mit dem Mechanismus verbindet und damit das Verhältnis der Parteikräfte verfälscht. Der Druck des Wahlverfahrens auf den Dualismus führt also nur langfristig zu einem Resultat.[8]
Das relative Mehrheitswahlsystem kann also einen bestehenden Parteiendualismus gegen Parteispaltungen und gegen die Entstehung neuer Parteien sichern. Damit eine neue Partei überhaupt Fuß fassen kann, muss sie entweder über einen starken lokalen Rückhalt verfügen oder über eine große und mächtige Landesorganisation. Im ersten Fall wird sie auf ihren Ursprungsbereich begrenzt bleiben und sich nur sehr langsam und mühsam ausdehnen. Nur im zweiten Fall kann sie auf ein schnelles Anwachsen hoffen, das sie in die Lage der zweiten Partei bringt, in der das Gesetz der Polarisation und der Benachteiligung bei der Zuteilung von Sitzen zu ihren Gunsten wirkt. Das Zweiparteiensystem wirkt sich auch auf die innere Struktur der Parteien aus, indem es die Bildung verschiedener Strömungen innerhalb solch großer Verbände fördert. „In der Labour Party läßt sich deutlich zwischen den Gemäßigten und einer radikaleren Gruppe unterscheiden, die mitunter in Konflikt mit der eigenen Regierung gerät und sich in wichtigen Fragen, insbesondere der Außenpolitik, von ihr entfernt. In der konservativen Partei sind die Unterschiede nicht weniger deutlich.“[9]
[...]
[1] Duverger, Die politischen Parteien, S. 223.
[2] Ebd., S. 237.
[3] Ebd., S. 238.
[4] Ebd.
[5] Ebd., S. 240.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
[9] Ebd., S. 243.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das relative Mehrheitswahlsystem das Parteiensystem in England?
Das relative Mehrheitswahlsystem fördert einen Parteiendualismus (Zweiparteiensystem), da es kleinere Parteien systematisch benachteiligt und Wähler dazu bringt, ihre Stimme den großen Parteien zu geben.
Was versteht man unter dem mechanischen Faktor bei der Benachteiligung dritter Parteien?
Der mechanische Faktor beschreibt die unverhältnismäßige Benachteiligung einer dritten Partei, deren Anteil an Parlamentssitzen meist deutlich unter ihrem tatsächlichen Stimmenanteil bleibt.
Welche Rolle spielt der psychologische Faktor bei Wahlen in England?
Wähler neigen zur Polarisation: Sie geben ihre Stimme eher einer der beiden großen Parteien, um den Erfolg eines noch weniger gewünschten Kandidaten zu verhindern, anstatt ihre Stimme an eine chancenlose dritte Partei zu "verlieren".
Können neue Parteien im britischen Wahlsystem überhaupt erfolgreich sein?
Neue Parteien haben es schwer, außer sie verfügen über einen extrem starken lokalen Rückhalt oder eine mächtige landesweite Organisation, die sie schnell zur zweitstärksten Kraft machen kann.
Wie wirkt sich das Zweiparteiensystem auf die innere Struktur der Parteien aus?
Da es nur zwei große Parteien gibt, bilden sich innerhalb dieser oft verschiedene Strömungen (z. B. radikale vs. gemäßigte Flügel), die interne Konflikte austragen.
Welche Parteien dominierten das England der 50er und 60er Jahre?
Das System war geprägt durch die konservativen Tories und die Labour-Party, während die Liberalen trotz beachtlicher Wählerstimmen durch das Wahlsystem an den Rand gedrängt wurden.
- Quote paper
- M.A. Piotr Grochocki (Author), 2003, Wirkungen des relativen Mehrheitswahlsystems im England der 50er und 60er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137455