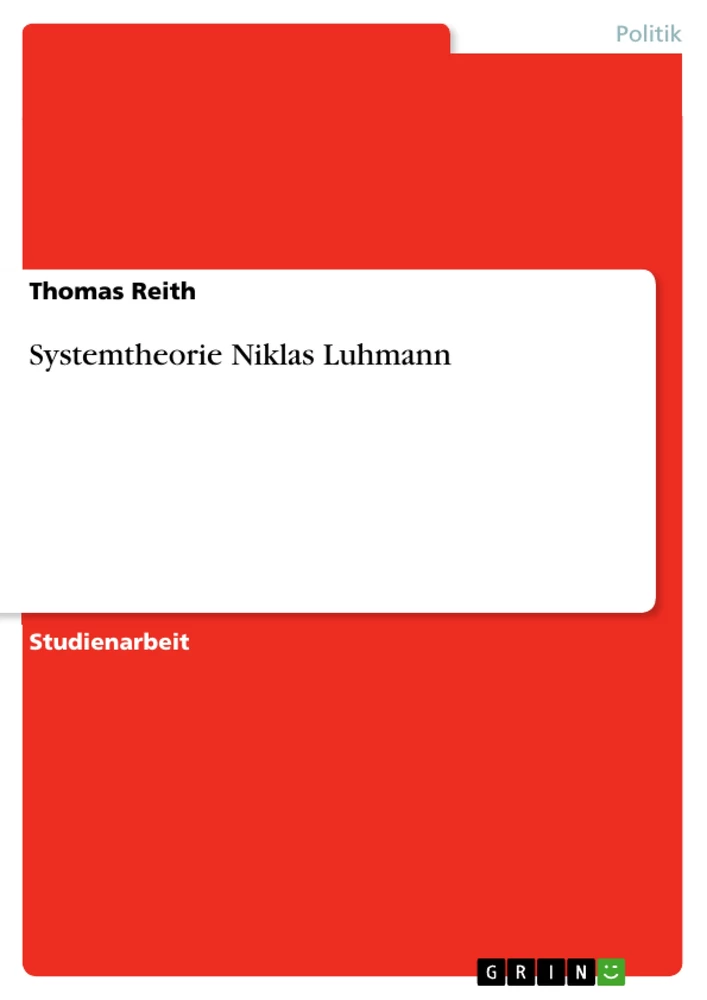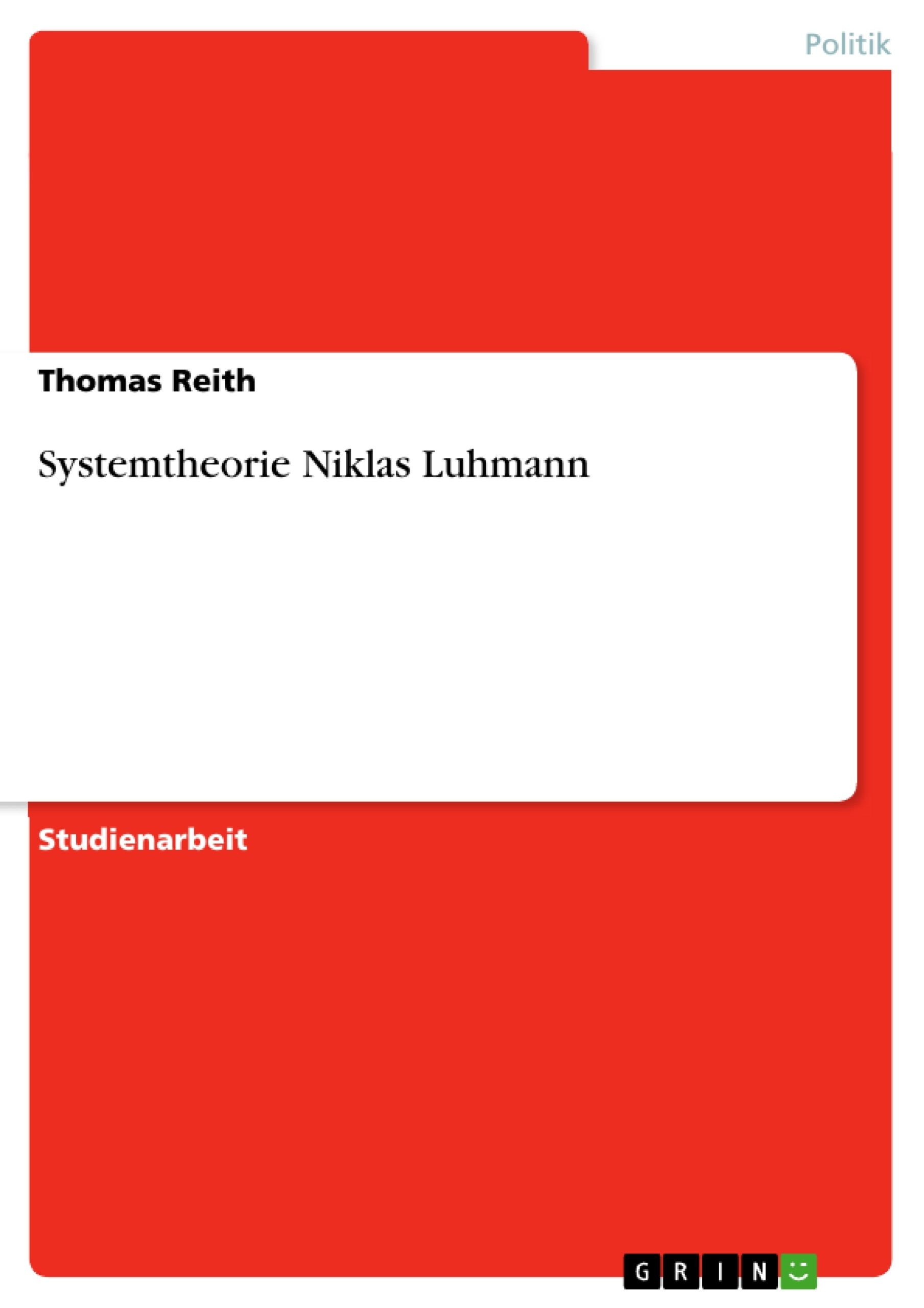Einleitung zur Systemtheorie
Neben der handlungstheoretischen und gesellschaftstheoretischen Konzeption hat sich seit den 70er Jahren vor allem die Systemtheorie in der Soziologie, ,als bedeutsam für die Analyse des Prozesses der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt erwiesen". Für Niklas Luhmann ist Systemtheorie ,,heute ein Sammelbegriff für sehr verschiedene Bedeutungen und sehr verschiedene Analyseebenen".
Der Vorläufer der Systemtheorie findet sich in der funktionalistischen Theorie, die sich am ,organismischen′ Modell der Beziehung zwischen Person und Umwelt orientiert. Gesellschaft steht hiernach in Analogie zu biologischen Organismen, soziale Prozesse werden als gleichgewichtsregulierende Wirkungszusammenhänge verstanden.
Diesen Gedanken hat TALCOTT PARSONS in eine allgemeine systemtheoretische Konzeption übertragen, in deren Mittelpunkt die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft steht. ,,Parsons hat sich vor allem darum bemüht, die Mikroperspektive der individuell-psychischen Dynamik und die Makroperspektive gesellschaftlicher Sozialstrukturen in eine Synthese zu bringen."
Nach PARSONS tritt soziales Handeln niemals vereinzelt auf, sondern immer nur in speziellen Verbindungen und Konstellationen, welche dann als Systeme bezeichnet werden. Er unterscheidet dabei zwischen drei Systemen: Einem organischen, einem psychischen und einem sozialen System.
Das organische System ist die Ausgangsbasis aller Handlungsprozesse und die Grundlage dafür, dass alle physiologischen und psychischen Grundfunktionen erfüllt werden können. Das psychische System kontrolliert diese Antriebsenergien und lenkt sie in gesellschaftlich erlaubte oder vorgeschriebene Bahnen. Das soziale System dagegen entsteht aus den Beziehungsmustern zwischen verschiedenen Handelnden, die als Träger bestimmter sozialer Rollen fungieren. Diese sozialen Rollen sind durch normative Erwartungen definiert, die von anderen Gruppenmitgliedern, aber auch Institutionen ausgehen. Der Prozess der Sozialisation ergibt sich dadurch, dass der Handelnde diese Erwartungen schrittweise aufnimmt und sie für sich verinnerlicht. Dies geschieht solange, bis sich jener aus diesen eigene Motivierungskräfte und Ziele für das eigene Handeln ableitet.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Person Niklas Luhmann
- Einleitung zur Systemtheorie
- Systemtheorie Niklas Luhmanns
- Systeme
- Sinn
- Autopoiesis
- Kritische Auseinandersetzung mit der Theorie Luhmanns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Systemtheorie Niklas Luhmanns und bietet einen Überblick über seine wichtigsten Beiträge zur Soziologie. Sie setzt sich kritisch mit Luhmanns Theorie auseinander und beleuchtet sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen.
- Das Leben und Werk von Niklas Luhmann
- Die zentralen Elemente der Systemtheorie
- Die Unterscheidung von System und Umwelt
- Die Bedeutung von Kommunikation und Selbstreferenz
- Kritik an der Systemtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Person Niklas Luhmann
Dieses Kapitel liefert einen biografischen Überblick über Niklas Luhmanns Leben und Karriere. Es beleuchtet seine frühen Einflüsse, seine wichtigsten Stationen und die Entstehung seines wissenschaftlichen Werkes. Die besondere Bedeutung seiner Kontroversen mit Jürgen Habermas wird hervorgehoben.
Einleitung zur Systemtheorie
Dieses Kapitel stellt die Systemtheorie als ein bedeutendes Denkmuster der Soziologie vor. Es zeichnet die Entwicklung der Systemtheorie von ihren Anfängen bei Talcott Parsons bis hin zu Luhmanns eigener Konzeption nach. Es werden dabei insbesondere die Begriffe System, Umwelt und Gleichgewicht in Bezug auf soziale Prozesse untersucht.
Systemtheorie Niklas Luhmanns
Dieses Kapitel behandelt die Kernpunkte von Luhmanns Systemtheorie. Es erläutert die zentralen Konzepte wie Systeme, Sinn und Autopoiesis. Es zeigt, wie Luhmann die Differenzierung der Gesellschaft in verschiedene Funktionssysteme analysiert und die Bedeutung von Kommunikation für die Aufrechterhaltung dieser Systeme hervorhebt.
Schlüsselwörter
Niklas Luhmann, Systemtheorie, Gesellschaft, Kommunikation, Selbstreferenz, Autopoiesis, Parsons, Habermas, Funktionssysteme, Differenzierung, soziale Systeme, Umwelt, Sinn,
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Systemtheorie von Niklas Luhmann?
Luhmanns Theorie betrachtet die Gesellschaft als ein komplexes Geflecht aus autonomen Funktionssystemen (wie Recht, Wirtschaft, Politik), die sich durch Kommunikation erhalten.
Was bedeutet "Autopoiesis" in sozialen Systemen?
Autopoiesis beschreibt die Fähigkeit eines Systems, sich selbst aus seinen eigenen Elementen (Kommunikationen) zu reproduzieren und sich so von der Umwelt abzugrenzen.
Wie unterscheidet sich Luhmann von Talcott Parsons?
Während Parsons Systeme noch stark über Handeln und Rollen definierte, rückte Luhmann die Kommunikation und die Selbstreferenz (Operational Closure) ins Zentrum seiner Analyse.
Welche Rolle spielt die Unterscheidung von System und Umwelt?
Ein System existiert nur durch die Differenz zu seiner Umwelt. Es verarbeitet Komplexität der Umwelt nach eigenen internen Regeln (Sinn).
Warum wird Luhmanns Theorie oft kritisiert?
Kritiker wie Habermas werfen der Systemtheorie vor, den Menschen als handelndes Subjekt aus dem Blick zu verlieren und soziale Prozesse zu technokratisch zu betrachten.
- Quote paper
- Thomas Reith (Author), 2000, Systemtheorie Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1375