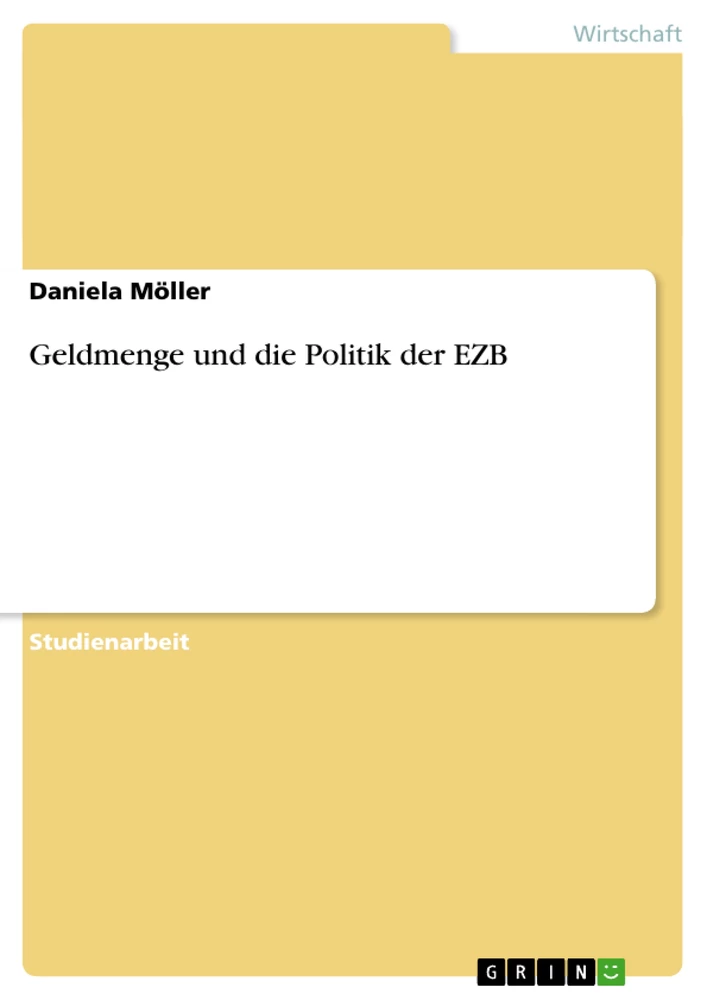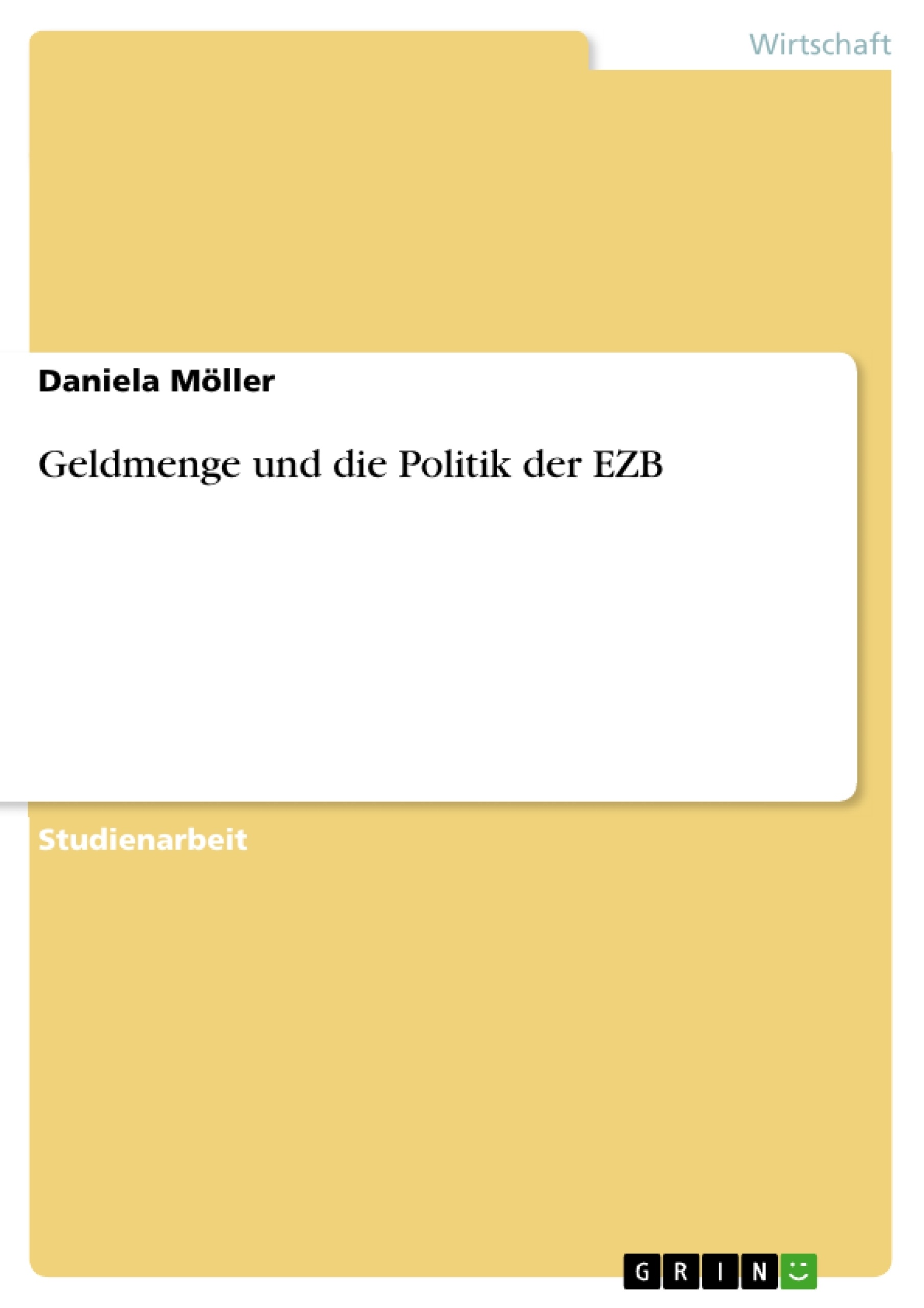Der Begriff des Geldes spielt für jedermann eine wichtige Rolle im Leben, denn ohne Geld ist
ein gesellschaftliches Dasein bekannter Weise nicht möglich. Bildlich gesprochen werden auf
den nachfolgenden Seiten die volkswirtschaftlichen Grundsteine zum Bau einer europäischen
„Geldpyramide“ gesetzt und gleichzeitig dargestellt, welche Aufgaben die „Steinträger“ zu
verrichten haben. Als Geldmenge M1 bezeichnet man die Summe des Bestandes an Banknoten, Münzen und
Sichtguthaben im Staat, privaten Haushalten und Produktionsunternehmen abzüglich der
Sichtguthaben des Staates bei der Bundesbank.1 Sichtguthaben sind Guthaben, die ohne
weiteres in Bargeld umgewandelt werden können, beispielsweise täglich fällige Einlagen.
Zusätzlich ist zu sagen, dass dies den allgemeinen Bestand an Geld in den Händen
inländischer Nichtbanken darstellt und somit verschiedene statistische Abgrenzungen der
Geldmenge wegen Unschärfe des Geldbegriffes nach sich zieht. Somit definiert man
außerdem die Geldmenge M2 (entspricht der M1 zuzüglich den Termineinlagen) und die
Geldmenge M3 (entspricht der M2 plus Spareinlagen). Betrachtet man die Geldmenge M3
summiert mit den Bankeinlagen im Ausland, so erhält man die erweiterte Geldmenge M3.
Man wählte die o.g. Definition der Geldmenge M1, um eine statistisch messbare Größe
hervorzubringen, die der Realität der derzeitigen Geld- und Finanzmärkte entspricht. Es sollte
also das geldpolitische Handeln der Zentralbank an eine feste Orientierungsgröße gebunden
werden. Daraus ergeben sich zwei Funktionen des Begriffs. Zum einen sollte die definierte
Geldmenge ein „Frühwarnsystem“ für monetäre Instabilitäten sein und diese innerhalb eines
engen, kausalen Zusammenhangs mit der gemessenen Inflationsrate eher erkennen und
entgegenwirken. Zum anderen ergab sich nun eine knapp zu haltende Größe, mit der man
Gefahren für den Geldwert ausschließen konnte.
1 Vgl. www.netschool.de, Isabel Frank, Wirtschaft und Schule – Wissen Geld
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der Geldmenge M1
- 3. Transaktionen
- 3.1 Ausweitung und Verringerung der Geldmenge
- 3.2 Der Akt der Geldschöpfung
- 4. Reservehaltung einer Bank
- 5. Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank
- 6. Politik der EZB
- 6.1 Mindestreservepolitik
- 6.1.1 Mindestreservepflichtige Institute
- 6.1.2 Festlegung der Mindestreserve
- 6.1.3 Haltung von Mindestreserven
- 6.1.4 Meldung, Überprüfung und Nichteinhaltung
- 6.2 Devisenpolitik
- 6.1 Mindestreservepolitik
- 7. Verhältnis des ESZB zu den nationalen Zentralbanken
- 7.1 Das Europäische System der Zentralbanken
- 7.2 Die Europäische Zentralbank
- 7.3 Die nationalen Zentralbanken
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Geldmenge und die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie beleuchtet die Definition der Geldmenge M1, die Mechanismen der Geldmengenausweitung und -verringerung, sowie die Rolle der Mindestreserve und der Devisenpolitik der EZB.
- Definition und Messung der Geldmenge M1
- Mechanismen der Geldmengenausweitung und -verringerung
- Die Rolle der Mindestreservepolitik der EZB
- Die Bedeutung der Devisenpolitik der EZB
- Das Verhältnis der EZB zu den nationalen Zentralbanken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Bedeutung des Geldes für das gesellschaftliche Leben. Sie verwendet das Bild einer europäischen „Geldpyramide“, um die Komplexität des Themas zu veranschaulichen und die Rolle der beteiligten Akteure zu skizzieren. Der Fokus liegt auf der Einführung des zentralen Themas und der Darlegung der grundlegenden Fragestellung.
2. Definition der Geldmenge M1: Dieses Kapitel definiert die Geldmenge M1 als die Summe von Banknoten, Münzen und Sichtguthaben abzüglich der Sichtguthaben des Staates bei der Bundesbank. Es erklärt den Begriff der Sichtguthaben und hebt die statistischen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des Geldbegriffs hervor. Die Definition von M1 wird als messbare Größe dargestellt, die für die geldpolitische Steuerung relevant ist und als „Frühwarnsystem“ für monetäre Instabilitäten fungieren soll.
3. Transaktionen: Dieses Kapitel behandelt die Ausweitung und Verringerung der Geldmenge. Die Ausweitung wird im Zusammenhang mit Geldschöpfung (aktiv und passiv) und Inflation erklärt. Die Geldmengenverringerung wird mit Geldvernichtung in Verbindung gebracht. Die verschiedenen Mechanismen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft werden detailliert beschrieben.
4. Reservehaltung einer Bank: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung der Mindestreserve für die Kreditvergabe von Banken. Es definiert die Mindestreserve und ihren aktuellen Satz. Es wird erklärt, wie die Mindestreserve die Liquidität der Kreditinstitute steuert und als Puffer auf dem Geldmarkt fungiert. Die Verbindung zwischen der Reservehaltung und der doppelten Buchführung in der Bilanz einer Geschäftsbank wird detailliert dargelegt.
5. Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel weitere Informationen über die Geldpolitik der EZB enthält und somit eine Zusammenfassung notwendig wäre. Da der Text keine Details dazu enthält, kann hier nur eine Platzhalter-Zusammenfassung gegeben werden): Dieses Kapitel behandelt die Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank, die ein zentrales Instrument zur Steuerung der Geldmenge darstellen. Es würde im Detail die Mechanismen dieser Geschäfte, ihre Auswirkungen auf die Geldmenge und die Rolle der Zentralbank bei der Umsetzung der Geldpolitik beschreiben.
6. Politik der EZB: Dieses Kapitel beschreibt die geldpolitischen Strategien der EZB, insbesondere die Mindestreservepolitik und die Devisenpolitik. Es würde die Instrumente, Ziele und Auswirkungen dieser Politiken detailliert analysieren und ihren Beitrag zur Stabilität des europäischen Finanzsystems beleuchten.
7. Verhältnis des ESZB zu den nationalen Zentralbanken: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die Rolle der EZB und der nationalen Zentralbanken. Es würde die Interaktionen und die Verteilung der Aufgaben zwischen diesen Institutionen detailliert darlegen und die Bedeutung der Zusammenarbeit für die geldpolitische Stabilität in Europa hervorheben.
Schlüsselwörter
Geldmenge, M1, EZB, Geldpolitik, Mindestreserve, Devisenpolitik, Geldschöpfung, Inflation, Banken, Kredit, Zentralbankgeld, ESZB, nationale Zentralbanken, monetäre Stabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Geldmenge und Geldpolitik der EZB
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Geldmenge und die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie behandelt die Definition der Geldmenge M1, die Mechanismen der Geldmengenausweitung und -verringerung, die Rolle der Mindestreserve und der Devisenpolitik der EZB sowie das Verhältnis der EZB zu den nationalen Zentralbanken.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Messung der Geldmenge M1, Mechanismen der Geldmengenausweitung und -verringerung, die Rolle der Mindestreservepolitik der EZB, die Bedeutung der Devisenpolitik der EZB und das Verhältnis der EZB zu den nationalen Zentralbanken. Zusätzlich werden die Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank und die Struktur des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) erläutert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Definition der Geldmenge M1, Transaktionen (inkl. Geldschöpfung und -vernichtung), Reservehaltung einer Bank, Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank, Politik der EZB (Mindestreserve- und Devisenpolitik), Verhältnis des ESZB zu den nationalen Zentralbanken und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird unter Geldmenge M1 verstanden?
Die Geldmenge M1 wird als die Summe von Banknoten, Münzen und Sichtguthaben abzüglich der Sichtguthaben des Staates bei der Bundesbank definiert. Sichtguthaben sind Guthaben, die jederzeit verfügbar sind. Die Definition von M1 ist für die geldpolitische Steuerung relevant und dient als Frühwarnsystem für monetäre Instabilitäten.
Wie funktioniert die Geldmengenausweitung und -verringerung?
Die Geldmengenausweitung hängt mit der Geldschöpfung (aktiv und passiv) zusammen und kann mit Inflation einhergehen. Die Geldmengenverringerung ist mit Geldvernichtung verbunden. Die Hausarbeit beschreibt detailliert die verschiedenen Mechanismen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Welche Rolle spielt die Mindestreserve?
Die Mindestreserve ist entscheidend für die Kreditvergabe von Banken. Sie steuert die Liquidität der Kreditinstitute und wirkt als Puffer auf dem Geldmarkt. Die Hausarbeit erläutert die Verbindung zwischen Mindestreserve und der doppelten Buchführung in der Bilanz einer Geschäftsbank.
Welche Bedeutung haben die Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Zentralbank?
Die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind ein zentrales Instrument der EZB zur Steuerung der Geldmenge. Sie beeinflussen die Geldmenge und spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Geldpolitik. Details zu den Mechanismen und Auswirkungen werden in der Hausarbeit behandelt.
Wie setzt die EZB ihre Geldpolitik um?
Die EZB nutzt verschiedene geldpolitische Instrumente, insbesondere die Mindestreservepolitik und die Devisenpolitik. Die Hausarbeit analysiert die Instrumente, Ziele und Auswirkungen dieser Politiken und deren Beitrag zur Stabilität des europäischen Finanzsystems.
Welches Verhältnis besteht zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken?
Die Hausarbeit beschreibt die Struktur und Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die Rolle der EZB und der nationalen Zentralbanken und die Interaktionen und Aufgabenverteilung zwischen diesen Institutionen. Die Bedeutung der Zusammenarbeit für die geldpolitische Stabilität in Europa wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Geldmenge, M1, EZB, Geldpolitik, Mindestreserve, Devisenpolitik, Geldschöpfung, Inflation, Banken, Kredit, Zentralbankgeld, ESZB, nationale Zentralbanken, monetäre Stabilität.
- Quote paper
- Daniela Möller (Author), 2002, Geldmenge und die Politik der EZB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13764