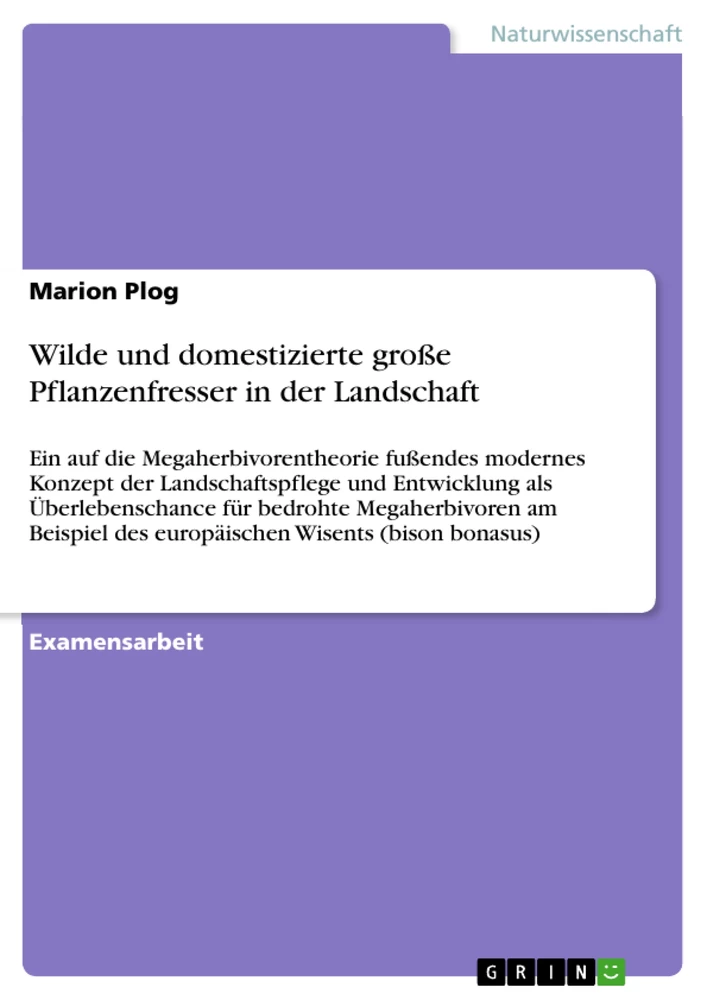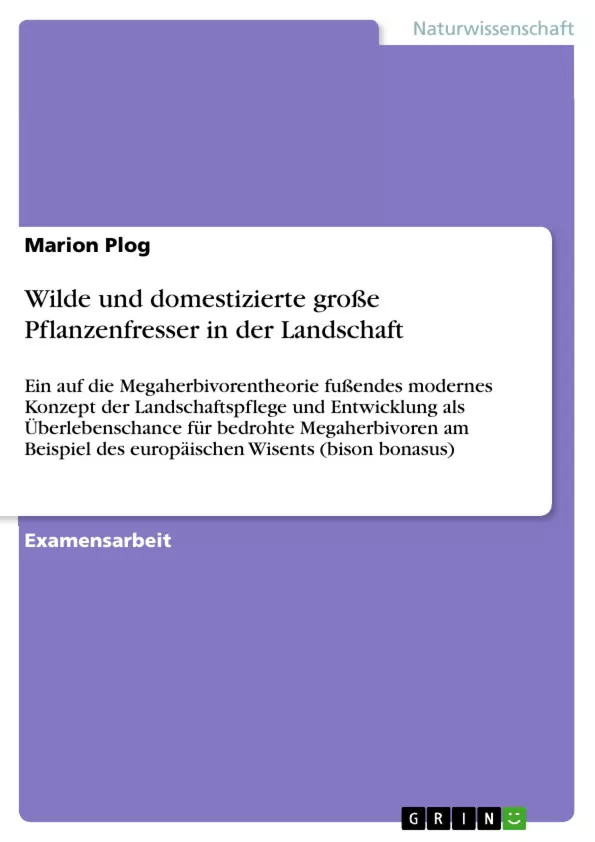Diese Examensarbeit beschäftigt sich mit den wilden und domestizierten großen Pflanzenfressern, die zu Landschaftspflegezwecken eingesetzt werden. Zu Beginn werde ich auf die natürliche Vegetation Mitteleuropas verweisen und aufzeigen, wie eine solche Landschaft ohne anthropogenen Einfluss ausgesehen hätte. Dabei soll die Mosaik-Zyklus-Theorie näher erläutert werden. Im Anschluss daran werde ich auf den Einfluss der großen Herbivoren auf die Landschaft eingehen. Hier werden die Tiere vorgestellt, die während der letzten Eiszeit und des davor liegenden Interglazials vorgekommen sind.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Ausrottung und das Aussterben der Megaherbivoren thematisiert. Neben der umstrittenen Klimahypothese soll auch auf den Einfluss des jagenden Menschen auf die Tierwelt Mitteleuropas hingewiesen und die damit zusammenhängende Overkillhypothese vorgestellt werden. Danach gehe ich auf die Megaherbivoren im Quartär ein. Hier werden die Tiere genannt, die ohne den Menschen heute noch in unserer Gegend, in Mitteleuropa, leben würden und welche ökologischen Nischen diese besetzten würden. Die Megaherbivorentheorie soll hierbei ebenfalls Erwähnung finden. Des Weiteren wird die Huteweidung vorgestellt. Auf die Aufgaben der Landschaftspflege wird hier ebenfalls verwiesen.
Um einige ausgewählte Beispiele für den Einsatz von großen domestizierten und wilden Pflanzenfressern in der Landschaftspflege aufzuzeigen, werde ich im weiteren Verlauf der Examensarbeit einige ausgewählte Pferde- und Rinderrassen vorstellen, ihre Abstammung und ihren Lebensraum definieren und ihre Eignung für die Pflege diskutieren. Einige bereits umgesetzte landschaftspflegerische Projekte mit diesen Tieren sollen ebenfalls erwähnt werden. Als Beispiel für einen wilden Megaherbivoren dient der Wisent im dann folgenden Kapitel. Neben der Biologie des Tieres, werden die ehemalige Verbreitung, die Ausrottung und die Rückkehr von Bison bonasus beschrieben. Auch mit Wisenten geplante Projekte werden näher vorgestellt. Ein Experteninterview mit dem Leiter eines dieser Projekte folgt anschließend. Den Abschluss dieser wissenschaftlichen Examensarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I stellt eine Schlussbetrachtung zum Thema dar.
Inhaltsverzeichnis
Abkurzungs- und Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
2 Landschaftsgestaltung durch Herbivoren
2.1 Die naturliche Vegetation Mitteleuropas
2.1.1 Bisheriges Bild
2.1.2 Die Mosaik-Zyklus-Theorie
2.2 Einfluss der groBen Herbivoren auf die Landschaftsstruktur
2.2.1 Tiere der letzten Eiszeit und des davor liegenden Interglazials
2.2.2 Ausrottung/Aussterben der Megaherbivoren
2.2.2.1 Die Klimahypothese
2.2.2.2 Der Einfluss des jagenden Menschen auf die Tierwelt Mitteleuropas
- die Overkillhypothese
2.3 Megaherbivoren und Landschaft im Quartar - die Megaherbivorentheorie
2.3.1 Die naturlich vorkommenden Herbivoren Mitteleuropas im Quartarohne Einfluss des Menschen
2.3.2 Okologische Nischen der Herbivoren des Interglazials
3 Huteweidung
3.1 Begriffsdefinition und Bedeutung
3.2 Aufgabe der Landschaftspflege
4 Landschaftspflege durch groBe Pflanzenfresser
4.1 Pferde in der Landschaftspflege und ihre Eignung
4.1.1 Abstammung und Lebensraum
4.1.2 Vorstellung einiger typischer Pferderassen und ihr Einsatz in der Landschaftspflege
4.1.2.1 Das Exmoor-Pony
4.1.2.2 Das Przewalski-Pferd
4.1.2.3 Konik
4.1.2.4 Tarpan
4.1.2.5 Weitere Pferderassen
4.2 Rinder in der Landschaftspflege und ihre Eignung
4.2.1 Abstammung und Lebensraum
4.2.2 Vorstellung ausgewahlter Rinderrassen und ihr Einsatz in der Landschaftspflege
4.2.2.1 Heckrind
4.2.2.2 Highland
4.2.2.3 Galloway
5 GroBe wilde Pflanzenfresser - Landschaftspflege als Uberlebens- chance fur bedrohte und einheimische Megaherbivoren am Bei- spiel des Wisents
5.1 Biologie des Wisents
5.2 Ehemalige Verbreitung und Ausrottung
5.3 Ruckkehr
5.4 Bedrohung in heutiger Zeit
5.5 Einsatz in der Landschaftspflege als Uberlebenschance
5.6 Experteninterview mit dem Diplom-Biologen Uwe Lindner
6 Resumee und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkurzungs- und Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
„Die Natur braucht sich nicht anzustrengen bedeutend zu sein. Sie ist es.“ (Robert Walser)
Landschaftsgestaltung durch groBe Pflanzenfresser1 ist eine unbewusste Schaffung ihres Lebensraumes durch ihr Einwirken auf die Landschaft.
Die in Mitteleuropa ursprunglich vorkommenden GroBtierarten, wie Wildpferd und Wisent, pragten die Landschaft durch ihre Weidewirkung in charakteristi- scher Weise. Sie hielten die Vegetation offen und schafften ein Mosaik an unterschiedlichen Landschaftsflachen mit Ubergangen vom dichten Wald zu parkartigen Offenstellen.
So wie diese Megafauna, wirkten in vergangener Zeit auch die domestizier- ten Haustiere wie Rinder und Schafe unter der Leitung des Menschen auf die damalige Waldlandschaft ein. So entstanden die Hutewalder.
In den letzten Jahren fallen aber immer mehr Flachen brach, was nicht zu- letzt durch die SchlieBung vieler landwirtschaftlicher Betriebe begrundet ist. Dem Naturschutz erwachsen dadurch vollig neue Probleme und Moglichkeiten. Die zuvor offene, mosaikartige Landschaft wuchert immer weiter zu. Dies hat die Konsequenz, dass seltene Tier- und Pflanzenarten aussterben, die an das Offenland angepasst sind.
Fur die Landschaftspflege bleibt in diesem Fall nur noch die Moglichkeit der Mahd. Da diese Methode der Offenhaltung aber sehr kostenintensiv ist und von der Mahd unter Anderem auch seltene Pflanzen betroffen waren, bedarf es eines innovativen Konzepts, das das Wirken von Megaherbivoren ein- schlieBt. Der Einsatz von groBen Pflanzenfressern ware daher eine kosten- gunstige Alternative der Landschaftspflege.
Diese Examensarbeit beschaftigt sich mit den wilden und domestizierten gro- Ben Pflanzenfressern, die zu Landschaftspflegezwecken eingesetzt werden.
Zu Beginn werde ich auf die naturliche Vegetation Mitteleuropas verweisen und aufzeigen, wie eine solche Landschaft ohne anthropogenen Einfluss ausgesehen hatte.
Dabei soll die Mosaik-Zyklus-Theorie naher erlautert werden.
Im Anschluss daran werde ich auf den Einfluss der groBen Herbivoren auf die Landschaft eingehen. Hier werden die Tiere vorgestellt, die wahrend der letzten Eiszeit und des davor liegenden Interglazials vorgekommen sind.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Ausrottung und das Aussterben der Megaherbivoren thematisiert. Neben der umstrittenen Klimahypothese soll auch auf den Einfluss des jagenden Menschen auf die Tierwelt Mitteleuropas hingewiesen und die damit zusammenhangende Overkillhypothese vorgestellt werden.
Danach gehe ich auf die Megaherbivoren im Quartar ein. Hier werden die Tiere genannt, die ohne den Menschen heute noch in unserer Gegend, in Mitteleuropa, leben wurden und welche okologischen Nischen diese besetz- ten wurden. Die Megaherbivorentheorie soll hierbei ebenfalls Erwahnung finden.
Des Weiteren wird die Huteweidung vorgestellt. Auf die Aufgaben der Land- schaftspflege wird hier ebenfalls verwiesen.
Um einige ausgewahlte Beispiele fur den Einsatz von groBen domestizierten und wilden Pflanzenfressern in der Landschaftspflege aufzuzeigen, werde ich im weiteren Verlauf der Examensarbeit einige ausgewahlte Pferde- und Rin- derrassen vorstellen, ihre Abstammung und ihren Lebensraum definieren und ihre Eignung fur die Pflege diskutieren. Einige bereits umgesetzte land- schaftspflegerische Projekte mit diesen Tieren sollen ebenfalls erwahnt wer- den.
Als Beispiel fur einen wilden Megaherbivoren dient der Wisent im dann fol- genden Kapitel. Neben der Biologie des Tieres, werden die ehemalige Verbreitung, die Ausrottung und die Ruckkehr von Bison bonasus beschrie- ben. Auch mit Wisenten geplante Projekte werden naher vorgestellt.
Ein Experteninterview mit dem Leiter eines dieser Projekte folgt anschlie- Bend.
Den Abschluss dieser wissenschaftlichen Examensarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprufung fur das Lehramt fur die Sekundarstufe I stellt eine Schlussbetrachtung zum Thema dar.
2 Landschaftsgestaltung durch Herbivoren
Wie sah die Landschaft Mitteleuropas nach der letzten Eiszeit aus?
Konnten die groBen Pflanzenfresser auf die Landschaft einwirken und wur- den sie dies heute noch tun, wenn der Mensch nicht eingegriffen und sie verdrangt hatte? Wie hatte die Landschaft Mitteleuropas ohne Homo sapiens ausgesehen?
All diese Fragen werden schon seit langer Zeit in Wissenschaft sowie For- schung diskutiert und sind bis heute nicht mit Sicherheit zu beantworten.
Um die Biologie rezenter Pflanzen und Tiere zu verstehen und sinnvolle Schutzkonzepte fur diese zu entwickeln, ist es wichtig diese Fragen zu disku- tieren, um die Bedingungen unter denen Arten entstanden sind und sich dif- ferenziert haben, zu verstehen.
Bei der in den letzten Jahren immer haufiger werdenden Beweidung mit Me- gaherbivoren wird daruber debattiert, ob dies ein naturlicher Prozess ist oder ob man nicht besser der Natur ihren freien Lauf lasst, statt immer wieder ein- zugreifen.
Die Befurworter der LandschaftspflegemaBnahmen fuhren dazu an, dass durch das Beenden von Beweidung seltene Pflanzen wie Fransenenzian, Ziegenmelker und Uferschnepfe nicht uberleben konnten, da sich eine Wald- gesellschaft einstellen wurde. Daraufhin versuchen Kritiker mit dem Argument „Mitteleuropa ware ohne den Menschen ein geschlossener Wald“ zu argumentieren. Tiere und Pflanzen offener Landschaften, die erst durch den Menschen eingewandert seien, gehoren ihrer Ansicht nach nicht hierher und sind somit nicht schutzbedurftig.2
Die Diskussion ist also weiterhin im Gange und ein Ergebnis noch nicht ab- sehbar.
Vgl. Bunzel-Druke/ M., J. Druke & H. Vierhaus: Quaternary Park. Uberlegungen zu Wald, Mensch und Megafauna.[i. f. z.: Quaternary Park] - ABUinfo Nr.17/18 (4/93 u. 1/94), Bad Sassendorf, 1994, S. 4.
An dieser Stelle soil der Stand der Diskussion erortert werden, um die Aktua- litat und Bedeutung des Themas hervorzuheben.
2.1 Die naturliche Vegetation Mitteleuropas
2.1.1 Bisheriges Bild
Als Zeitspanne fur die Entstehung der heutigen Landschaft Mitteleuropas mit ihren Biozonosen ist maBgeblich die Zeit nach der letzten Eiszeit anzuset- zen, d. h. etwa die letzten 18.000 Jahre.3
In diesem Zeitraum haben sich unter den sich einstellenden klimatischen Be- dingungen die Boden ausgebildet und das biotische Potential der Arten ge- funden.
Bisherigen Annahmen zu Folge handelt es sich bei der Beschaffenheit der postglazialen Landschaft Mitteleuropas, ohne Eingriff des Menschen, um ei- nen geschlossenen Wald (Buchenwald). Dieser Wald entsprache der Kli- maxvegetation. Darunter versteht man die typische Vegetation, die sich ohne Einfluss des Menschen auf den „mittleren Standorten“ eines Gebietes groR- flachig entwickeln wurde.4
Ausnahmen stellen dabei offene Bereiche da. Solche Offenlandbiotope be- schrankten sich nach diesen Annahmen auf bestimmte Standorte wie Felsen, Moore, Fluss- und Meeresufer.5
Verschiedene Denkmodelle wurden zu diesem Thema entwickelt. So auch die Mosaik-Zyklus-Theorie von Remmert, die im Folgenden naher beschrie- ben werden soll.
2.1.2 Die Mosaik-Zyklus-Theorie
Mit der Mosaik-Zyklus-Theorie von Remmert wurde das klassische Bild der Klimaxgesellschaft (Schlussgesellschaft) innerhalb der Vegetationskunde in ein neues Licht geruckt.
Diese Theorie geht von der Annahme aus, dass die Landschaft ohne Einfluss des Menschen vollstandig mit Wald bedeckt ware und somit einem Urwald gleiche.
Anhand von Untersuchungen von Urwaldrelikten wurde festgestellt, dass Ur- walder keineswegs groBraumlich einheitlich sind, sondern vielmehr aus klei- nen, zahlreichen Mosaiken vollkommen verschiedener Walder zusammen- gesetzt sind.
Die GroBe dieser Mosaike ist von Standort und Klima abhangig. Weiterhin zeigte sich, dass es sich um zyklische und unregelmaBige Entwicklungsab- folgen innerhalb der Waldgesellschaft - man geht von einem Buchen-Urwald aus - handelt. Neben Verjungungszustanden kommen auch Zusammen- bruchszustande vor. So ist es moglich, dass alte Baume im Alter von 250 bis 350 Jahren absterben und das dadurch auf den sonst unbelichteten und kar- gen, wenig belebten Erdboden Licht fallt. Dieses Licht macht es Hochstau- den mOglich zu wachsen. Diese werden aber haufig wieder von schnellwuch- sigen Pioniergeholzen wie Birken abgelost, die dann wiederum nach einigen Jahren von einem Mischwald aus Eschen, Ahorn und Wildkirsche ersetzt wurde. Ist dieser Mischwald circa 150 Jahre alt, wird er wiederum von einem Buchenbestand abgelOst. Nach ungefahr 500 Jahren hat sich der Zyklus ge- schlossen.
Es handelt sich also um die Abfolge typischer Waldgesellschaften (Zerfalls- und Verjungungsphase, Jugendphase, Optimalphase und Altersphase) mit unterschiedlichem Aussehen und unterschiedlicher Biodiversitat.
Dadurch, dass in jedem Bereich des Waldes, also in jedem Mosaik, ver- schiedene Zyklusphasen anzutreffen sind, finden Tiere und Pflanzen immer einen passenden Lebensraum.6
Doch ist es meines Erachtens gut moglich, dass auch die Mosaik-Zyklus- Theorie das Aussehen der Naturlandschaft nicht vollstandig erklart, denn der Einfluss der ursprunglich in Mitteleuropa vorkommenden groBen Pflanzen- fresser auf die Landschaftsgestaltung bleibt dabei unbeachtet.
2.2 Einfluss der groBen Herbivoren auf die Landschaftsstruktur
Die groBen Pflanzenfresser finden in den meisten Theorien keinen Platz. Lange Zeit traute man ihnen keinen Einfluss auf die Vegetation zu.
Man ging von der Annahme aus, dass das Klima die Pflanzenwelt bestimmt. Nur wenigen Tieren gestand man eine Beeinflussung der Landschaft zu.
Dazu zahlen:
- Eichelhaher und Tannenhaher:
Diese pflanzen unbewusst durch ihre Vorratshaltung Baume.
- Biber:
Diese Tiere benagen Geholze und stauen Gewasser an und konnen sogar eine Moorbildung auslosen.
- Afrikanische Elefanten:
Die Baume beschadigen konnen und Walder in Savannen umwandeln konnen.
Im Gegensatz zu den wilden Elefanten sind die Eichelhaher bei uns noch heute weit verbreitet.7
Vor 30.000 Jahren bevolkerten allerdings noch Elefanten Europa, Afrika, Amerika und Sudasien. Auch viele weitere Megaherbivoren lebten einst in Nordwest- und Mitteleuropa.
2.2.1 Tiere der letzten Eiszeit und des davor liegenden Interglazials
Die Tiere, die wahrend der letzten Eiszeit und im davor liegenden Interglazial vorkamen, konnen unterteilt werden in:
- Russeltiere:8
1. Wald- oder Altelefant {Palaeoloxodon antiquus) (= Elephas nama- dicus): Dieses GroBtier kam wahrend der Eiszeiten im Mittelmeer- raum vor und war wahrend der Warmzeiten auch in Deutschland vertreten. Es ist weltweit ausgestorben.
2. Mammut {Mammuthus primigenius):
Bei diesem Tier handelt es sich um eine weit verbreitete Art der Steppentundra, Tundra und Taiga. Wahrend der Eiszeiten war das Mammut in Mitteleuropa recht haufig. Auch das Mammut ist weltweit ausgestorben.
- Unpaarzeher:
1. Nashorner:9
a) Wald- oder Merck'sches Nashorn (Dicerorhinus kirchbergensis): Diese Nashornart hielt sich uberwiegend in Parklandschaften auf und in Savannen mit gemaBigtem Klima. Dieses Tier ist ebenfalls weltweit ausgestorben.
b) Steppennashorn (Dicerorhinus hemitoechus):
Das Steppennashorn kam, wie der Name anklingen lasst, in Steppen des gemaBigten Klimas vor. Es ist ebenfalls weltweit ausgestorben.
c) Woll- oder Fellnashorn (Coelodonta antiquitatis):
Hierbei handelt es sich um einen hochspezialisierten Weidegan- ger der Steppentundra. Weltweit ist das Woll- oder Fellnashorn ausgestorben.
d) Sibirisches Einhorn oder Riesennashorn (Elasmotherium sibiri cum):
Dieses Nashorn ist auf Graser spezialisiert und kam in den sud- russischen Steppen vor. In Mitteleuropa scheint es selten vorge- kommen zu sein. Dieser Megaherbivore ist weltweit ausgestorben, wahrscheinlich sogar schon im Mittelpleistozan
2. Pferde:10
a) Wildpferd (Equus ferus):
Das Wildpferd ist ein Herdentier offener und halboffener Lebens- raume. Heute gibt es sie wildlebend nur noch in der Unterart der Przewalski-Pferde in der Wuste Gobi.
b) Europaischer Wildesel (Equus hydruntinus):
Dieser Wildesel ist am Ende des Weichsel-Glazials weltweit ausgestorben. Naheres ist zu ihm nicht bekannt.
c) Kulan oder Halbesel (Equus hemionus):
Der Kulan ist ein Steppenbewohner, der in Herden lebt. Heute kommt er in Nordasien vor.
- Paarzeher:11
1. Schweine:
Wildschwein oder Schwarzwild (Sus scrofa):
Das Wildschwein ist ein Vertreter bewaldeter und halboffener Lebensraume. Die heutigen Wildschweine ahneln diesen Tieren, sind allerdings grower.
2. Flusspferde:
Europaisches Flusspferd (Hippopotamus antiquus): Ausgestorben.
3. Hirsche:
a) Rothirsch (Cervus elaphus):
Der Rothirsch war im Spatpleistozan in ganz Europa zahlreich verbreitet. Er belebt halboffene Lebensraume und ist heute aus jagdrechtlichen Grunden in Randgebiete seines ehemaligen Vor- kommens zuruckgedrangt, zum Beispiel in die Eifel.
b) Riesenhirsch (Megalocerus giganteus):
Der Riesenhirsch ist weltweit ausgestorben, kam aber in offenen und halboffenen Landschaften Eurasiens und Nordafrikas haufig vor.
c) Damhirsch (Dama dama):
Bevorzugter Lebensraum des Damhirschs sind Parklandschaf- ten. Er ist nach der Eiszeit in Mitteleuropa von Romern wieder eingefuhrt worden.
d) Reh (Capreolus capreolus):
Das Reh ist weit verbreitet und kommt in offenen und bewaldeten Gebieten vor.
e) Elch (Alces alces):
Der typische Lebensraum des Elchs sind feuchte Walder und Moore. Der Elch kommt in Europa in Skandinavien und Osteuro- pa vor.
f) Ren oder Rentier (Rangifer tarandus):
Beim Ren handelt es sich um eine Hirschart der Tundra, Taiga und des Hochgebirges. Heute kommen diese Tiere uberwiegend nur noch in domestizierter Form in Skandinavien und Russland vor.
- Horntraqer:12
1. Saiqa-Antilope (Saiga tatarica):
Diese Antilope bewohnte im Pleistozan Steppen von England bis Alaska. Heute kommt die Saiqa-Antilope nur noch in Zentralasien vor.
2. Gemse (Rupicapra rupicapra)
Gemse waren in der letzten Eiszeit in Mitteleuropa bis zur Elbe vertreten. Heute kommen sie nur noch in den Alpen vor. Allerdinqs werden sie im Schwarzwald kunstlich anqesiedelt.
3. Moschusochse (Ovibus moschatus):
Der Moschusochse war im Pleistozan in Tundren weit verbreitet. Im Holozan kam er dann nur noch in Nordostkanada und Gronland vor. Heute wird dieses Tier in Alaska und Norweqen wiederanqesiedelt.
4. Wildschaf oder Mufflon (Ovis ammon):
Die Verbreitunq des Wildschafs in Mitteleuropa ist aufqrund der dunnen Knochen und der dadurch weniqen Fossilfunde unklar. Heute werden Wildschafe in qanz Europa aus Jaqdqrunden kunstlich anqesiedelt.
5. Steinbock (Capra ibex):
Der Steinbock wird heute an vielen Stellen wiederanqesiedelt. Er kam in der Eiszeit in qanz Europa bis in die Mittelqebirqe vor, ist heute ein Tier des Hochqebirqes, welches mit dem Aufkommen der Feuerwaffen so qut wie ausqerottet wurde und heute in seinem qesamten naturlichen Verbreitunqsqebiet wiederanqesiedelt wird.
6. Europaischer Tahr (Hemitragus bonali):
Von diesem Tier fand man wenige Funde in Frankreich. Es ist ein Bewohner bergiger Lebensraume. Diese Gattung kommt heute nur noch im Himalaja vor.
7. Steppenwisent (Bison priscus):
Herdentier der Steppen und der Steppentundra, das weltweit ausgestorben ist.
8. Wisent oder Waldwisent (Bison bonasus):
Bevorzugter Lebensraum des Wisents sind lichte Walder. Er uberlebte bis ins 20. Jahrhundert und wird in Osteuropa und auch in Deutschland wiederangesiedelt.
9. Auerochse oder Ur (Bos primigenius):
Hier handelt es sich um die Stammform domestizierter Rinder. Im Postglazial hatten Auerochsen ihre hochste Dichte.
- Nagetiere:13
Biber (Castor fiber):
Der Biber war einst weit verbreitet und sehr haufig. Mittlerweile ist er eher selten. Man versucht ihn heute zum Beispiel in Bayern wiederanzusiedeln.
- Raubtiere:
1. Hyanen:14
a) Sabelzahnkatze (Homotherium latidens):
Dieses Tier war schon wahrend der letzten Eiszeit eher selten. Heute ist es weltweit ausgestorben.
b) Wildkatze (Felis silvestris):
Wildkatzen sind weit verbreitet und kommen von Wald bis Steppe uberall vor.
c) Luchs oder Nordluchs (Felis lynx):
Der Luchs bevorzugt bewaldetete Lebensraume und ist in Mitteleuropa fast ausgerottet. In der Schweiz wird versucht diese Tiere wiederanzusiedeln.
d) Hohlenlowe oder Europaischer Lowe (Panthera leo spelaea):
Der Hohlenlowe war im Pleistozan bis in die Tropen weltweit verbreitet.
e) Leopard (Panthera pardus).
Der Leopard kommt heute nur noch in Afrika und Asien vor. Im Pleistozan war er auch in Mitteleuropa verbreitet.
2. Marder:15
a) VielfraB (Gulo gulo):
Beim VielfraB handelt es sich um einen groBen Marder, der vorallem in Mooren vorkommt. Kam er im fruhen Postglazial noch in Norddeutschland vorkam, so lebt er heute nur noch in eurasischen und amerikanischen Taiga und Tundra.
b) Dachs (Meles meles):
Der Dachs kommt heute noch haufig in Europa vor und zwar in Waldern und Parklandschaften.
c) Fischotter (Lutra lutra):
Der Fischotter ist in Europa weit verbreitet.
3. Hunde:16
a) Wolf (Canis lupus):
Der Wolf ist Bewohner verschiedener Lebensraume, so zum Beispiel des Waldes. Er kommt heute vorwiegend in Italien, Spanien, Nordskandinavien und Osteuropa vor.
b) Alpenwolf (Cuon alpinus europaeus):
Heutiges Vorkommen nur noch in Sudostasien.
c) Fuchs oder Rotfuchs (Vulpes vulpes):
Der Fuchs ist heute noch in Europa weit verbreitet.
d) Eis- oder Polarfuchs (Alopex lagopus):
Diese Fuchsart ist kleiner als der Rotfuchs und hatte seine hochste Dichte in Mitteleuropa wahrend der letzten Eiszeit - sogar bis Spanien. Heute kommt er nur noch in der eurasischen und amerikanischen Arktis vor.
4. Baren:17
a) Hohlenbar (Ursus spelaeus):
Der Hohlenbar ist ein sehr groRer Bar, der weltweit ausgestorben ist.
b) Braunbar (Ursus arctos):
Der Braunbar ist ein in bewaldeten Gebieten weit verbreiteter Allesfresser, der heute noch in Skandinavien, den Pyrenaen, Osteuropa und Italien vorkommt. In Deutschland ist er ausgerottet.
Gesteht man all diesen beschriebenen Tieren einen Einfluss auf die Vegetation und die Gestaltung der Landschaft zu, so wird deutlich, dass sich die ursprungliche Landschaft nicht zu einem Bild reduzieren lasst, sondern dass Natur durch dynamische Prozesse beeinflusst wird. AuRerdem treten Ein- flusse wie Klima, Licht, Kontinentalverschiebung, Ereignisse wie Sturmfluten, Lawinen, Feuer und Wind hinzu, die ebenfalls an der Gestaltung der Landschaft beteiligt sind.
„Die Naturlandschaft ware also eine Mischung aus vielfaltig strukturiertem Laubwald mit offenen Bereichen unbekannter - eventuell erheblicher - Aus- dehnung18.“
2.2.2 Ausrottung/Aussterben der Megaherbivoren
Viele der eben beschriebenen Tiere sind schon lange ausgestorben, so zum Beispiel Waldelefant oder Einhorner19.
Insgesamt hat es in mindestens sechs „Aussterbewellen“ gegeben; die am Ende des Pleistozans unterscheidet sich allerdings sehr von den Anderen.
Bei allen vorhergehenden Aussterbewellen waren Land- und Meerestiere aller GroBen betroffen. Am Ende der letzten Eiszeit verschwanden aber nur Landtiere und zwar uberwiegend groBe Tiere.
Als Grund fur dieses Aussterben kommen heute noch zwei miteinander kon- kurrierende Thesen in Betracht:
- die Klimahypothese und
- die Overkillhypothese.20
2.2.2.1 Die Klimahypothese
Die Vertreter der Klimahypothese gehen davon aus, dass die pleistozanen GroBsauger den allmahlichen Klimaveranderungen zum Opfer fielen, da die- se Veranderungen sich negativ auf ihre Lebensbedingungen, wie zum Bei- spiel auf die Verfugbarkeit von Nahrung, ausgewirkt haben.
Viele GroBtiere verschwanden wahrend der letzten Eiszeit, aber nicht, wie man vermuten konnte, wahrend des Kaltemaximums, sondern erst als die Temperaturen allmahlich wieder anstiegen und die Gletscher zuruckwichen. Vom Hochglazial bis zum Hohepunkt der heutigen Warmzeit vergingen unge- fahr 7.000 Jahre - genugend Zeit fur die Tiere sich an den Wechsel des Kli- mas zu gewohnen und sich den veranderten Bedingungen anzupassen. Au- Berdem ahnelte der Temperaturanstieg stark schon vorherigen Eiszeiten, bei denen die GroBtierarten aber nicht ausstarben.21
Tiere wie Steppenwisent oder Hohlenbar hatten zum Beispiel gar keine be- sondere Vorliebe fur ein spezielles Klima. Sie kamen sowohl in der Eiszeit als auch zu Warmzeiten vor.
Hatte es nur eine einzige Eiszeit gegeben, so konnte man die Klimahypothe- se sogar nachvollziehen. Aber jedes Mal uberlebten die meisten Tiere den Wechsel der Zeiten. So gab es zum Beispiel immer mindestens eine Nas- horn- und eine Elefantenart.
In den Warmzeiten lebte der Waldelefant bei uns, wahrend das Mammut in den Kaltzeiten bei uns vorkam, da es aus Skandinavien und Sibirien einge- wandert war.
Ruckte das Eis vor, so wurden die Tiere, die an warme Klimata, jedoch zu- mindest an gemaBigte Klimata, gewohnt waren, mehr und mehr nach Suden in den Mittelmeerraum gedrangt - so zum Beispiel der Waldelefant.
Es bildeten sich viele kleinere Lebensraume, so genannte Refugialgebiete. Der Waldelefant uberlebte den groBten Teil der letzten Eiszeit auf der Iberi- schen Halbinsel, konnte aber im Holozan ratselhafter Weise nicht mehr zu- ruckkehren. Ebenso erging es Mammut, Wollnashorn, Wald- und Steppen- nashorn.22
Die Annahme eine Klimahypothese erklare das Aussterben zahlreicher Me- gaherbivoren zum Ende des Pleistozans ist aufgrund der angefuhrten Argu- mente eher fraglich.
2.2.2.2 Der Einfluss des jagenden Menschen auf die Tierwelt Mitteleu- ropas - die Overkillhypothese
Ein anderer Faktor, der die letzte Eiszeit von den Anderen trennt, ist das Auf- treten und die Ausbreitung des modernen Menschen. Einen vom Menschen unbeeinflussten naturlichen nacheiszeitlichen Landschaftszustand hat es nicht gegeben. Die heutige Landschaft und die dazugehorige Dichte an GroBsaugern sind nachhaltig anthropogen verandert worden.
Die Gattung Homo erschien vor etwa 2 Millionen Jahren in Afrika. Vor etwa 1,5 Millionen Jahren breitete sich Homo erectus nach Sudasien und nach Europa aus. Dieser jagte bereits wahrend der Holstein-Warmzeit mit einfa- chen Waffen, zum Beispiel Steingeraten (Faustkeilen o. a.) zum Schlagen und Hauen, GroBwild.23
In den letzten 100.000 Jahren ersetzte dann Homo sapiens seinen Vorfah- ren. Wissenschaftliche Untersuchungen und Funden zufolge ist der moderne Mensch in Afrika entstanden und hat sich von dort uber die Kontinente hin- weg ausgebreitet24. GemaB dieser "Out-of-Africa"-Theorie begann vor etwa 100.000 Jahren die Auswanderung des Homo sapiens nach Europa und A- sien.
In Europa lebte nun eine Rasse des heutigen Menschen. Es war der Nean- dertaler (Homo sapiens neanderthalensis).
Dieser jagte GroBtiere wie Mammuts mit Lanzen und Wurfspeeren, meist aus angespitzten Mammutknochen oder Eibenholz sowie mit Fallen. Die Speere wiesen haufig eine Lange von 2,5 Metern auf. Dies ist auf einen Fund in Schoningen zuruckzufuhren. Durch diese Erfindung erhohte sich der Jagdra- dius von zuvor 0-3 Metern (Lanzen) auf 0-15 Meter (Speere).
Neandertaler waren auf Mammuts und Bisons spezialisierte Jager. Sie lauer- ten ihnen meist auf ihren Wegen in Winterweidegebiete auf und erlegten sie dann.
[...]
1 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird als Synonym zu der Begrifflichkeit „groBe Pflanzen- freser“ ebenfalls die lat. Bezeichnung „Megaherbivoren“ verwendet.
2 Vgl. Bunzel-Drüke/ M., J. Drüke & H. Vierhaus: Quaternary Park. Überlegungen zu Wald, Mensch und Megafauna.[i. f. z.: Quaternary Park] - ABUinfo Nr.17/18 (4/93 u. 1/94), Bad Sassendorf, 1994, S. 4.
3 Vgl. Bunzel-Druke, Margret: Artenschwund durch Eiszeitjager? [ i. f. z.: Artenschwund durch Eiszeitjager] In: Bayerische Landesanstalt fur Wald und Forstwirtschaft: GroRtiere als Landschaftsgestalter - Wunsch oder Wirklichkeit? Berichte aus der LWF, Nummer 27, Freising 2000, S. 1.
4 Vgl. Brunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 11.
5 Ebd., S. 12.
6 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 13.
7 Vgl. Bunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 13.
8 Ebd., S. 15.
9 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 15.
10 Vgl. Bunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 15.
11 Ebd., S. 17.
12 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 17 f.
13 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 17 f.
14 Vgl. Bunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 19.
15 Ebd.
16 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 19.
17 Vgl. Bunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 19.
18 Bunzel-Druke, Quaternary Park, 1994, S. 29.
19 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 22.
20 Vgl. Engelhardt, Wolfgang: Das Ende der Artenvielfalt. Aussterben und Ausrottung von Tieren. [i. f. z.: Das Ende der Artenvielfalt] Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997, S. 17.
21 Ebd.
22 Vgl. Bunzel-Drüke, Quaternary Park, 1994, S. 21.
23 Vgl. Feustel, Rudolf: Abstammungsgeschichte des Menschen. 6., uberarb. und erw. Auf- lage. - Fischer, Jena 1990, S. 82 ff.
24 Ebd., S. 85.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Megaherbivorentheorie?
Sie besagt, dass Mitteleuropa ohne den Menschen kein geschlossener Wald gewesen wäre, sondern eine halboffene Parklandschaft, geprägt durch das Weiden großer Pflanzenfresser.
Welche Tiere eignen sich für die Landschaftspflege?
Besonders geeignet sind robuste Rinderrassen (z.B. Heckrinder, Galloways) und Wildpferderassen (z.B. Koniks, Exmoor-Ponys) sowie Wisente.
Was ist die Mosaik-Zyklus-Theorie?
Eine Theorie von Remmert, die davon ausgeht, dass Ökosysteme ein dynamisches Mosaik aus verschiedenen Zerfalls- und Erneuerungsphasen bilden.
Warum ist der Wisent für den Naturschutz wichtig?
Als größtes Landsäugetier Europas besetzt der Wisent eine ökologische Nische, die durch das Offenhalten von Wäldern die Artenvielfalt fördert.
Was ist die Overkillhypothese?
Sie besagt, dass das Aussterben der Megafauna im Quartär primär durch die Jagd des Menschen und nicht allein durch den Klimawandel verursacht wurde.
- Quote paper
- Marion Plog (Author), 2006, Wilde und domestizierte große Pflanzenfresser in der Landschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137653