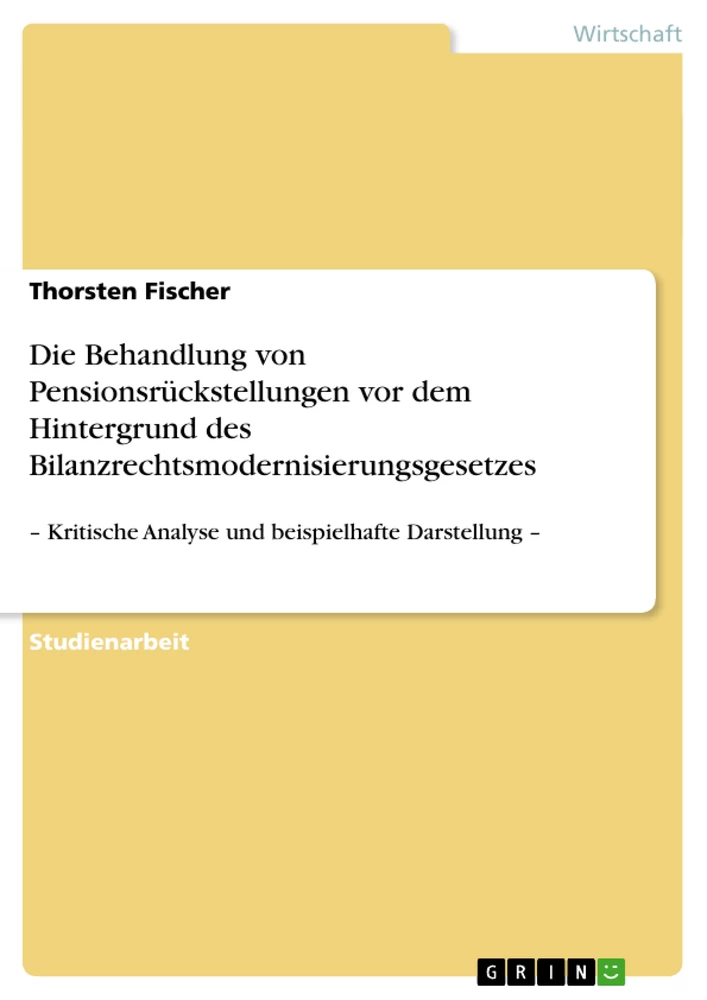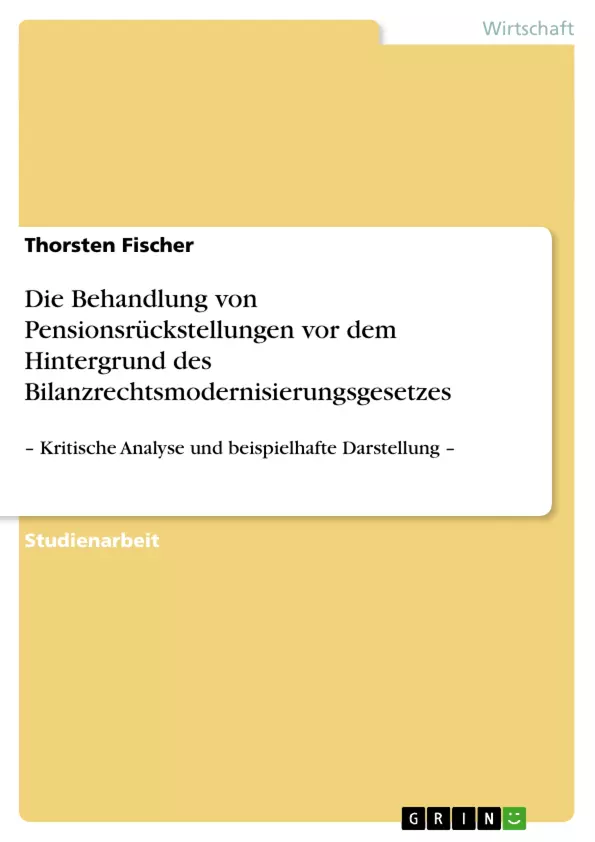In der Literatur finden sich unzählige Veröffentlichungen, die sich mit dem „neuen deutschen Bilanzrecht“ beschäftigen. Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechts-modernisierungsgesetz – BilMoG) wurde nach zahlreichen Kommentierungen, letztlich verabschiedet. Das jetzt beschlossene Gesetz hat viele Änderungen gegenüber dem ersten Referentenentwurf im November 2007, dem ergänzten sowie dem erweiterten Regierungsentwurf, erfahren. Frei nach dem „Struck’schen Gesetz“, welches besagt, dass kein Gesetz die zuständigen Gremien [den Bundestag; der Verfasser] verlässt, so wie es hereingekommen ist, haben sich zahlreiche Modifikationen etlicher Gesetze ergeben. Daher sollen, die nun endgültig verabschiedeten Regelungen, kritisch analysiert werden. Die Auswirkungen werden in der hier vorliegenden Hausarbeit für den Bereich der Pensionsrückstellungen genauer erläutert.
Inhaltsverzeichnis
Anlagenverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Kontext der Rückstellungen
2.1 Definition und rechtliche Grundlagen
2.2 Ansatz von Rückstellungen
2.3 Bewertung von Rückstellungen
2.4 Ausweis von Rückstellungen
3 Der Begriff der Pensionsrückstellungen
3.1 Definition und rechtliche Grundlagen
3.2 Ansatz von Rückstellungen für Pensionen
3.3 Bewertung von Verpflichtungen für Pensionen
3.4 Ausweis von Verpflichtungen für Pensionen
4 Pensionsrückstellungen − Die Modifizierungen durch das BilMoG
4.1 Ansatz von Rückstellungen für Pensionen
4.2 Bewertung von Verpflichtungen für Pensionen
4.2.1 Berücksichtigung von Zukunftstrends
4.2.2 Diskontierung
4.3 Ausweis von Verpflichtungen für Pensionen
4.3.1 Versicherungsmathematische Verfahren
4.3.2 Saldierungsgebot von Vermögen mit Altersversorgungsverpflichtungen
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Klassifikation der Rückstellungen
Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Die handelsrechtlichen Ansatzvorschriften für Pensionsverpflichtungen
Anlage 2: Mittelbare Pensionsverpflichtungen
Anlage 3: Beispiel zur Diskontierung von Pensionsrückstellungen
Anlage 4: Beispiel zur Anwendung der Saldierung von Vermögen mit Pensions-rückstellungen
1 Einleitung
In der Literatur finden sich unzählige Veröffentlichungen, die sich mit dem „neuen deutschen Bilanzrecht“[1] beschäftigen.[2] Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG)[3] wurde nach zahlreichen Kommentierungen,[4] letztlich verabschiedet.[5] Das jetzt beschlossene Gesetz hat viele Änderungen gegenüber dem ersten Referentenentwurf im November 2007,[6] dem ergänzten[7] sowie dem erweiterten[8] Regierungsentwurf, erfahren.[9] Frei nach dem „Struck’schen Gesetz“, welches besagt, dass kein Gesetz die zuständigen Gremien [den Bundestag; der Verfasser] verlässt, so wie es hereingekommen ist, haben sich zahlreiche Modifikationen etlicher Gesetze ergeben. Daher sollen, die nun endgültig verabschiedeten Regelungen, kritisch analysiert werden. Die Auswirkungen werden in der hier vorliegenden Hausarbeit für den Bereich der Pensionsrückstellungen genauer erläutert. Rückstellungen im internationalen Kontext, nämlich im System der IFRS oder der US-GAAP werden im Rahmen der Arbeit nicht beleuchtet.[10] Zu Beginn wird grundlegend auf die Rückstellungen eingegangen, später die Pensionsrückstellungen mit den Änderungen des BilMoG näher betrachtet. Ein Fazit beschließt die Ausführungen.
2 Der Kontext der Rückstellungen
2.1 Definition und rechtliche Grundlagen
„Rückstellungen sind für ungewisse, zukünftige Verpflichtungen zu bilden und dienen der periodengerechten Aufwandsverrechnung“[11] gibt der Nestor der deutschen Betriebswirtschaftslehre, Günter Wöhe, den Lesern seines Klassikers „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ mit auf den Weg. Inhaltlich geht der Begriff der Rückstellung einher mit dem Ziel der Verringerung von Ertragsteuerzahlungen und Gewinnausschüttungen. Kurzum kann mit der Bildung einer Rückstellung ein Finanzierungseffekt erreicht werden.[12] Rückstellungen werden daher in Unternehmen für Aufwendungen gebildet, die nach dem Abschlussstichtag – ergo in der Zukunft – zu einem Abfluss von Liquidität führen, wobei die Ursache hierfür im aktuellen Geschäftsjahr liegt.[13] Eine Legaldefinition der Rückstellungen ist im HGB a.F. nicht zu finden.[14] Im Rahmen der Steuerbilanz, unter Berücksichtigung der Maßgeblichkeit,[15] begehren die Vorschriften des § 5 EStG und den damit einschlägigen Absätzen 2a, 3, 4, 4a und 4b die Aufmerksamkeit des Bilanzierenden. Der BFH[16] hat in seiner Rechtsprechung dem Steuerpflichtigen folgende Abgrenzungsmerkmale aufgezählt:
1. Es muss eine Verbindlichkeit gegenüber Dritten bestehen oder eine zukünftige Entstehung wahrscheinlich sein;
2. Die Verbindlichkeit ist wirtschaftlich vor dem Bilanzstichtag entstanden;
3. Der Schuldner muss mit der Inanspruchnahme der Rückstellung ernsthaft rechnen.
Die Rückstellungen lassen sich unter Zuhilfenahme der folgenden Abbildung 1 besser verdeutlichen und nachvollziehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Klassifikation der Rückstellungen[19]
Rückstellungen können grundsätzlich in Innen- und Außenverpflichtungen aufgeteilt werden.[20] Die Innenverpflichtung manifestiert sich darin, dass eine Verpflichtung gegenüber sich selbst zu Tage tritt. Eine Verpflichtung gegenüber Dritten wird als Außenverpflichtung charakterisiert.[21] Die Außenverpflichtung gegenüber einem externen Dritten kann als eine Schuld bzw. eine konkrete Verpflichtung erkannt werden.[22] Verpflichtungen nach innen, d. h. gegenüber sich selbst, drücken sich in Aufwandsrückstellungen[23] aus. Diese Innenverpflichtungen tragen der periodengerechten Erfolgsermittlung Rechnung.[24] Die Verpflichtungen gegenüber Dritten wiederum können in Rückstellungen für drohende Verluste und in Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten[25] qualifiziert werden. Rückstellungen für drohende Verluste werden gebildet wenn der Bilanzierende bestimmt annehmen muss, d.h. greifbare Anhaltspunkte bestehen, dass ein Verlust bevorsteht.[26] Die Außenverpflichtungen, die einseitig und dem Grunde nach ungewiss sind, finden hiernach den Ausdruck in den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.[27]
2.2 Ansatz von Rückstellungen
Die Kodifikation für den Ansatz von Rückstellungen ist in § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB begeben und spiegelt das Vorsichtprinzip wider.[28] Der Ansatz wird hier dem Grunde nach vorgenommen.[29] Unter steuerlichen Gesichtspunkten ergänzt der BFH, dass, im Falle des Ansatzes einer Verbindlichkeit und deren Inanspruchnahme, mehr Argumente dafür als dagegen sprechen müssen.[30] Weiterhin ist zu bemerken, dass der Gesetzgeber in der Steuerbilanz explizit den Ansatz von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ausgeschlossen[31] und de facto auch in § 5 Abs. 4a EStG festgelegt hat.
2.3 Bewertung von Rückstellungen
Die Rückstellungen sind indes in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, wie in § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB a. F. niedergelegt wurde.[32] N. h. M. wurde ein sog. Erfüllungsbetrag berücksichtigt um o. g. Beurteilung gerecht zu werden.[33] Die gesetzlichen Regelungen für den Steuerpflichtigen im Rahmen der steuerlichen Bewertung der Rückstellungen erfolgt im § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG und geht einher mit den Einschränkungen des tatsächlichen Wertansatzwahlrechts. Beispielsweise sei hier bei der steuerlichen Betrachtung, der Vorbehalt im Rahmen von Sachleistungsverpflichtungen auf Einzelkosten und angemessene Gemeinkosten sowie eine Abzinsungsverpflichtung angeführt.[34]
2.4 Ausweis von Rückstellungen
Der Ausweis von Rückstellungen erfolgt gemäß § 266 Abs. 3 HGB a. F. auf der Passivseite der Bilanz („Gliederung der Bilanz: Passivseite, B. Rückstellungen“). Rückstellungen werden demnach in drei Bilanzpositionen ausgewiesen:
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen;
2. Steuerrückstellungen;
3. Sonstige Rückstellungen.[35]
Kleinen und mittleren Kapitalgesellschaften wird gestattet von der streng formellen Norm leicht abzuweichen und eine einfachere Abbildung der Rückstellungen wiederzugeben.[36]
3 Der Begriff der Pensionsrückstellungen
Pensionsrückstellungen werden angesichts des langfristigen Charakters und wertmäßigen Umfangs als „Paradebeispiel“ für Rückstellungen bezeichnet.[37] Dieser langfristige Charakter kann schlecht abgebildet werden; jedoch kann das Volumen der Pensionsrückstellungen, dass in deutschen Großunternehmen vorhanden ist, mit 230[38] – 250[39] Mrd. Euro beziffert werden. Nach dem gerade Geschilderten muss dem Thema Pensionsrückstellungen eine beträchtliche Bedeutsamkeit zugebilligt werden.
[...]
[1] Als Gesamtwerk zu betrachten Küting, Karlheinz/Pfitzer, Norbert/Weber, Claus-Peter (2009), S. 1 ff.
[2] Vgl. Bieg, Hartmut/Kußmaul, Heinz u.a. (2009), S. 1 ff.; Petersen, Karl/Zwirner, Christian (2009), S. 1 ff.
[3] Bundesregierung (2009), Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG); im Folgenden mit BilMoG abgekürzt.
[4] Statt vieler: Bieg, Hartmut/Bofinger, Peter/Küting, Karlheinz/Kußmaul, Heinz/Waschbuch, Gerd/ Weber, Claus-Peter (2008), S. 2543 ff.
[5] Auf die Veröffentlichung im BGBl. am 28.05.2009, gilt das BilMoG ab dem 29.05.2009, als in Kraft getreten.
[6] Vgl. Bundesregierung (2007), S. 1 ff.
[7] Vgl. Bundesregierung (2008a), S. 1 ff.
[8] Vgl. Bundesregierung (2008b), S. 1 ff.
[9] Vgl. Deutscher Bundestag (2009), S. 1 ff.
[10] Hierzu vertiefend Kußmaul, Heinz (2008a), S. 731 f.; Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 493 ff.
[11] Wöhe, Günter/Döring, Ulrich (2008), S. 645.
[12] Vgl. Wöhe, Günter (2008), S. 645 ff.; vertiefend zum Finanzierungseffekt von Rückstellungen Bieg, Hartmut/Kußmaul, Heinz (2000), S. 452 f.
[13] Vgl. Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 415.
[14] Vgl. Coenenberg, Adolf G. (2005), S. 390.
[15] Das handelsrechtliche Wahlrecht wird in der Steuerbilanz zu einem Passivierungsverbot; vgl. ausführlich zur Maßgeblichkeit Kußmaul, Heinz (2008a), S. 25 ff.
[16] Vgl. BFH-Urteil vom 19.10.1993.
[17] Vgl. vertiefend Coenenberg, Adolf G. (2005), S. 393.
[18] Vgl. Mayer-Wegelin, Eberhard (2004), § 249 Rn. 26.
[19] Modifiziert entnommen aus Kußmaul, Heinz (2008a), S. 726.
[20] Vgl. Wöhe, Günter/Döring, Ulrich (2008), S. 791 f.
[21] Vgl. Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 416.
[22] Vgl. Kußmaul, Heinz (2008a), S. 725 f.
[23] Vgl. ausführlich zu den Aufwandsrückstellungen Bieg, Hartmut/Kußmaul, Heinz (2009), S. 80 ff. und S. 92 ff.
[24] Vgl. Kußmaul, Heinz (2008), S. 729 f.
[25] Vgl. Bieg, Hartmut/Kußmaul, Heinz (2000a), S. 448 ff.; hierzu insbesondere Kapitel 3 und 4 dieser Hausarbeit.
[26] Vgl. Mayer-Wegelin, Eberhard (2004), § 249 Rn. 61 ff.
[27] Vgl. Dusemond, Michael/Kessler, Harald (2001) S. 72; zum weiteren Aufspannen des Begriffes der ungewissen Verbindlichkeiten Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 418.
[28] Vgl. Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 422.
[29] Vgl. Kußmaul, Heinz (2008a), S. 139.
[30] Vgl. Hey, Johanna (2008), § 17 Rz. 111.
[31] Vgl. Kußmaul, Heinz (2008a), S. 139.
[32] Vgl. Baetge, Jörg/Kirsch, Hans-Jürgen/Thiele, Stefan (2007), S. 429.
[33] Vgl. Küting, Karlheinz/Pfitzer, Norbert/Weber, Claus-Peter (2009), S. 323.
[34] Vgl. Kußmaul, Heinz (2008a), S. 60.
[35] Vgl. Wöhe, Günter/Döring, Ulrich (2008), S. 793.
[36] Vgl. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB a. F.; zu den Änderungen des BilMoG bzgl. den sonstigen Rückstellungen siehe Zülch, Henning/Hoffmann, Sebastian (2009), S. 369 ff.
[37] Vgl. Wöhe, Günter/Döring, Ulrich (2008), S. 646.
[38] Vgl. Schwind, Joachim (2008), S. 402.
[39] Vgl. Rhiel, Raimund/Veit, Annekatrin (2008), S. 193.
Häufig gestellte Fragen
Was ändert das BilMoG bei Pensionsrückstellungen?
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) führte umfassende Modifikationen bei der Bewertung, dem Ansatz und dem Ausweis von Pensionsverpflichtungen ein, unter anderem bei der Diskontierung.
Wie werden Rückstellungen allgemein definiert?
Rückstellungen sind Passivposten für ungewisse zukünftige Verpflichtungen, die der periodengerechten Aufwandsverrechnung dienen.
Was ist das Saldierungsgebot im BilMoG?
Es regelt die Verrechnung von Planvermögen (Deckungsvermögen), das ausschließlich der Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dient, mit den entsprechenden Rückstellungen.
Welche Rolle spielen Zukunftstrends bei der Bewertung?
Nach BilMoG müssen bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen voraussichtliche Lohn-, Gehalts- und Rententrends berücksichtigt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenverpflichtungen?
Außenverpflichtungen bestehen gegenüber Dritten (z. B. ungewisse Verbindlichkeiten), während Innenverpflichtungen (Aufwandsrückstellungen) Verpflichtungen gegenüber sich selbst darstellen.
- Quote paper
- Thorsten Fischer (Author), 2009, Die Behandlung von Pensionsrückstellungen vor dem Hintergrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137859