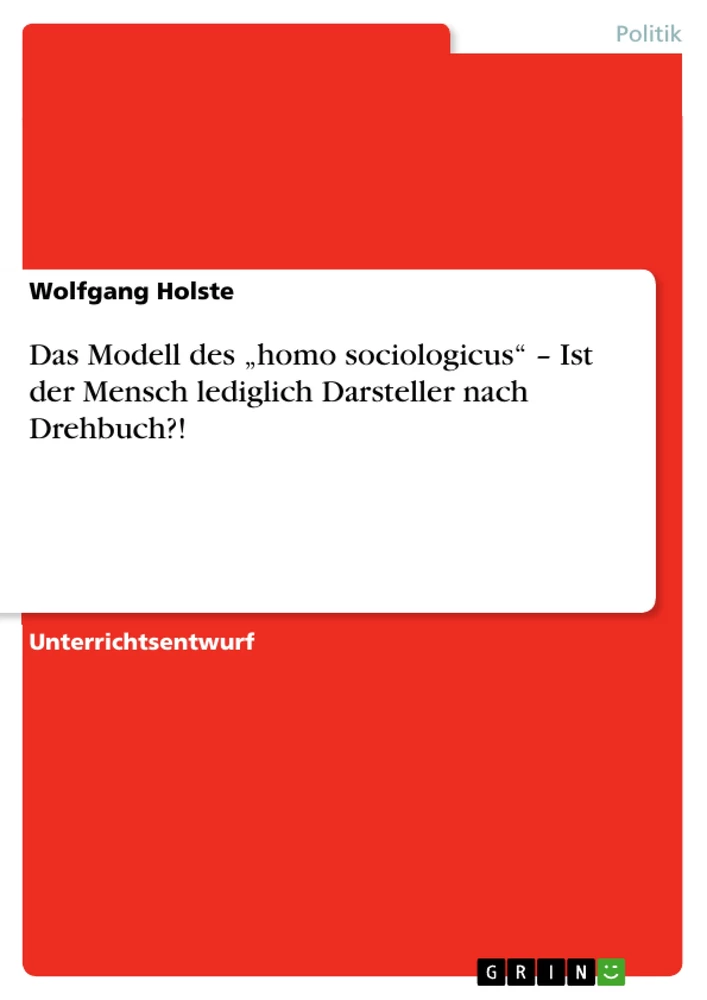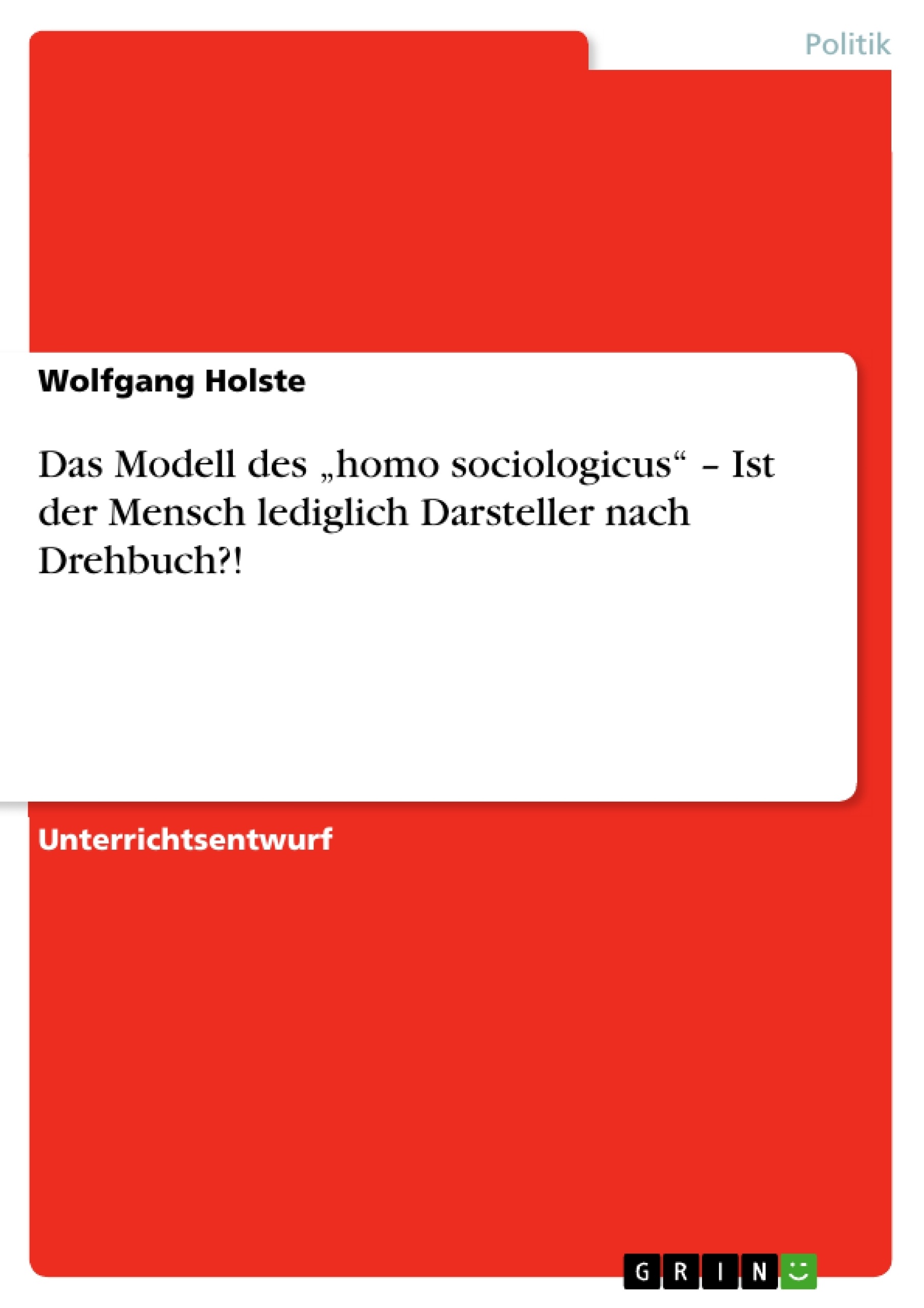Die Unterrichtsreihe „Wie sind wir geworden was wir sind?! – Der Sozialisationsprozess im Spannungsfeld zwischen personaler Identität und gesellschaftlicher Prägung“ wurde entsprechend dem schulinternen Curriculums für das Fach Sozialwissenschaften in der Jahrgangsstufe 11/I, 2. Quartal, konzipiert, welches am Inhaltsfeld II „Individuum, Gruppen und Institutionen“ des Lehrplanes Sozialwissenschaften für die Sek. II Gymnasium/Gesamtschule angelehnt ist.1 Obligatorisch für dieses Inhaltsfeld und sinnleitend für diese Stunde ist dabei die Erarbeitung und Thematisierung von Erklärungsmodellen (hier: Dahrendorfs traditionelle Rollentheorie des „homo sociologicus“).
1 Vgl.: Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne Sozialwissenschaften für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Frechen 1999, S. 19.
Entwurf zum 3. Unterrichtsbesuch im Fach Sozialwissenschaften
gemäß OVP § 11.3
Referendar: Wolfgang Holste
Schule: Städtisches Gymnasium Y.
Lerngruppe: Sowi GK Jgst. 11 (28 SuS)
Datum: 07.12.2006
Zeit: 1. Stunde (7.30-8.15 Uhr)
Raum: OS 3
Anwesend: Frau X., Fachseminarleiterin
Herr X., AKO
Thema der Unterrichtsreihe: Wie sind wir geworden was wir sind?! – Der Sozialisationsprozess im Spannungsfeld zwischen personaler Identität und gesellschaftlicher Prägung
Thema der Unterrichtsstunde: Das Modell des „homo sociologicus“ – Ist der Mensch lediglich Darsteller nach Drehbuch?!
Reihenziel: Die SuS sollen den Prozess ihrer individuellen Vergesellschaftung und Persönlichkeitsbildung nachvollziehen und beurteilen können, indem sie die kulturellen bzw. gesellschaftlichen Einflüsse auf der Mikro- und Makro-Ebene analysieren und sich darauf aufbauend mit ihrem sozialen Handeln reflektiert auseinandersetzen.
Stundenziel: Die SuS sollen mit Hilfe der Methoden „Placemat“, Textanalyse, Gruppenarbeit und Karikaturen Kriterien des „Menschenbildes“ des „homo sociologicus“ erarbeiten und erörtern sowie Verbesserungsansätze entwickeln und beurteilen.
Teilziele:
TLZ 1: Die SuS sollen die Hauptaussagen des Textes „homo sociologicus“ von Ralf Dahrendorf zusammenfassen und wiedergeben, indem sie ihre Hausaufgaben anhand der Methode „Placemat“ strukturieren und präsentieren.
TLZ 2: Die SuS sollen eigene und fremde Kritikpunkte zum Dahrendorf-Konzept herausarbeiten und erläutern, indem sie den Text in Gruppenarbeit kriteriengeleitet analysieren sowie Textstellen gezielt widerlegen.
TLZ 3: Die SuS sollen ausgehend von den Kritikpunkten mögliche Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Konzeptes erörtern und beurteilen, indem sie ihren eigenen Vergesellschaftungsprozess anhand einer Abbildung mit dem Modell in Bezug setzen.
Einbettung der Stunde in die Unterrichtsreihe:
1. UE: Ist menschliches Verhalten vorhersagbar oder zufällig?! – Die Soziologie als
Wissenschaft vom sozialen Handeln
2. UE: Welche Bedeutung für unser Handeln haben soziale Normen und Werte?! – Das
„soziale Lebewesen“ Mensch
3. UE: Wie wird man fähig, in der Gesellschaft leben zu können?! - Der Mensch als
gesellschaftliches Wesen und Individuum
4. UE: Sozialisation = Vergesellschaftung der menschlichen Natur?! – Das Modell der
sozialen Rolle
5. UE: Prägt der Mensch die Gesellschaft oder wird er von ihr geprägt?! – Der Prozess der
Sozialisation
6. UE: Jugendzeit = Schulzeit?! – Der Prozess der schulischen Sozialisation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. UE: Wann ist der Mensch ein Mensch?! – Grundqualifikationen des Rollenhandelns aus
interaktionistischer Sicht
9. UE: Personale vs. soziale Identität – „Flexible Ich-Identität“ als gelungene Balance?!
10. UE: Die individuelle Lebensplanung – Autobahn oder Sackgasse der
Identitätsentwicklung?!
Didaktisch-methodischer Schwerpunkt
Die Unterrichtsreihe „Wie sind wir geworden was wir sind?! – Der Sozialisationsprozess im Spannungsfeld zwischen personaler Identität und gesellschaftlicher Prägung“ wurde entsprechend dem schulinternen Curriculums für das Fach Sozialwissenschaften in der Jahrgangsstufe 11/I, 2. Quartal, konzipiert, welches am Inhaltsfeld II „Individuum, Gruppen und Institutionen“ des Lehrplanes Sozialwissenschaften für die Sek. II Gymnasium/ Gesamtschule angelehnt ist.[1] Obligatorisch für dieses Inhaltsfeld und sinnleitend für diese Stunde ist dabei die Erarbeitung und Thematisierung von Erklärungsmodellen (hier: Dahrendorfs traditionelle Rollentheorie des „homo sociologicus“).
Diese Schwerpunktsetzung erlaubt es, den – z.T. sehr abstrakten – Prozess der Vergesellschaftung bzw. Persönlichkeitsbildung, sprich den Gegenstand der Unterrichtsreihe, auf eine wissenschaftspropädeutische Ebene zu hieven. In diesem Zusammenhang war mir weiterhin wichtig, eine Theorie bzw. ein „Menschenbild“ zu wählen, welches zu einer differenzierten Betrachtung und damit zu kontroversen Diskussionen anregt. Um dies zu gewährleisten und um die SuS mit dem doch sehr langen und aufgrund seines Erscheinungsdatums sprachlich und inhaltlich z.T. schwer verständlichen Text (Erstveröffentlichung 1958) nicht zu überfordern, hatten die SuS bereits in der Hausaufgabe die Möglichkeit, sich ohne Zeitdruck mit dem Text auseinanderzusetzen und sich diesen – gemäß den Prinzipien des Lernens in der Oberstufe – weitestgehend eigenständig zu erschließen. Da dies erwartungsgemäß den leistungsschwächeren SuS des Kurses noch nicht immer zur vollen Zufriedenheit gelingt, werden daher zu Beginn der Erarbeitung etwaige Nachfragen zum Text geklärt, um auf diese Weise „präventiv“ Missverständnisse zu vermeiden sowie ein gemeinsames Textverständnis bzw. Basiswissen zu generieren. Um die Stunde nicht allzu sehr theorielastig zu gestalten, war es mir zudem wichtig, – wie von Massing gefordert – an den Vorerfahrungen der SuS anzuknüpfen.[2] In den beiden vorangegangenen Stunden wurde daher das aus der Lebenswelt der SuS und ebenfalls von Dahrendorf stammende Fallbeispiel des Lehrers Schmidt herangezogen, auf das sich der Text „homo sociologicus“ stellenweise bezieht.[3]
Da dieser Unterrichtsgegenstand bzw. das theoretische Konstrukt des „homo sociologicus“ für sich allein genommen laut der Problem-Definition von Breit[4] jedoch noch kein solches beinhaltet, werden die SuS zu Beginn der Stunde mit einer Karikatur (Folie 1) konfrontiert, die letztlich auf die Frage- bzw. Problemstellung im Stundenthema hinführen soll („h.s.“ = Mensch nach Drehbuch?!). In der abschließenden Vertiefungsphase habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen auf eine Karikatur zurückzugreifen (Folie 2), die zudem einen hohen Aufforderungscharakter für die SuS besitzt, da diese eine als Metapher getarnte Verschleierung bzw. Verfremdung aufdecken und entschlüsseln sollen.[5] Ausgehend von ihrem bis zu dem Zeitpunkt erarbeiteten Dahrendorf-Grundwissen gehe ich in diesem Zusammenhang davon aus, dass die SuS in ihren Deutungen den Baum als Individuum, den Pfahl als Gesellschaft und das Seil als Sanktionen bzw. Rollenerwartungen relativ schnell „dechiffrieren“ werden. Dabei lässt sich abschließend das persönliche Selbstverständnis der SuS in Bezug auf das Verhältnis Gesellschaft zu Individuum differenziert beurteilen.
Die dafür notwendige vorangehende Sachanalyse findet in den beiden Erarbeitungsphasen statt. Durch arbeitsteilige Gruppenarbeit mit Hilfe der Methode „Placemat“ ist es dabei möglich, auch die schüchternen, zurückhaltenden SuS des Kurses mit in den Erarbeitungsprozess zu integrieren bzw. in der 2. Erarbeitungsphase als „Experten“ einzusetzen, sodass es durch das Prinzip des Lernens durch Lehren sowohl für leistungsstarke als auch für leistungsschwache SuS zu einem positiven Effekt auf das Selbstbewusstsein kommt, da sie selbst als „Hilfslehrer“ eingesetzt werden und ihren Mitschülern Wissen vermitteln.
[...]
[1] Vgl.: Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und Lehrpläne Sozialwissenschaften für die Sekundarstufe II – Gymnasium/
Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Frechen 1999, S. 19.
[2] Vgl.: Massing, P.: Die Textanalyse. In: S. Frech/ H.-W. Kuhn/ P. Massing (Hrsg.): Methodentraining für den
Politikunterricht. Schwalbach/ Ts. 2004, S. 37.
[3] Vgl.: Floren, F. J.: Wirtschaft Gesellschaft Politik. Sozialwissenschaften in der Jahrgangsstufe 11.
Braunschweig 2005, S. 212 ff.
[4] Vgl.: Breit, G.: Problemorientierung. In: W. Sander (Hrsg.): Handbuch politische Bildung. Bonn 2005, S. 108
ff.
[5] Vgl.: Kuhn, H.-W.: Karikaturen. In: S. Frech/ H.-W. Kuhn/ P. Massing (Hrsg.): Methodentraining für den
Politikunterricht. Schwalbach/ Ts. 2004, S. 27.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Modell des „homo sociologicus“?
Das Modell des „homo sociologicus“ beschreibt den Menschen als ein Wesen, das durch gesellschaftliche Rollen und Erwartungen definiert wird. Es stellt die Frage, inwieweit das Individuum lediglich ein Darsteller nach einem gesellschaftlich vorgegebenen Drehbuch ist.
Wer entwickelte die traditionelle Rollentheorie des „homo sociologicus“?
Die in diesem Dokument behandelte traditionelle Rollentheorie geht maßgeblich auf den Soziologen Ralf Dahrendorf zurück, dessen Texte als Grundlage für die Analyse dienen.
Welche Rolle spielt der Sozialisationsprozess in diesem Modell?
Der Sozialisationsprozess wird als Spannungsfeld zwischen der personalen Identität und der gesellschaftlichen Prägung betrachtet. Er erklärt, wie Individuen lernen, in einer Gesellschaft zu funktionieren und deren Normen zu übernehmen.
Welche Unterrichtsmethoden werden zur Erarbeitung des Themas vorgeschlagen?
Im Unterrichtsentwurf werden Methoden wie die „Placemat“-Technik, Textanalyse, Gruppenarbeit sowie die Interpretation von Karikaturen eingesetzt, um die Kriterien des Modells zu erarbeiten.
Was ist das Ziel der im Dokument beschriebenen Unterrichtsreihe?
Das Ziel ist es, dass Schüler den Prozess ihrer individuellen Vergesellschaftung nachvollziehen und beurteilen können, indem sie kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse auf Mikro- und Makro-Ebene analysieren.
Gibt es Kritik am Konzept des „homo sociologicus“?
Ja, das Dokument sieht vor, dass Schüler eigene und fremde Kritikpunkte herausarbeiten. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob der Mensch tatsächlich nur ein passiver Rollenausführer ist oder ob Raum für individuelle Freiheit bleibt.
- Quote paper
- Wolfgang Holste (Author), 2007, Das Modell des „homo sociologicus“ – Ist der Mensch lediglich Darsteller nach Drehbuch?!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137887