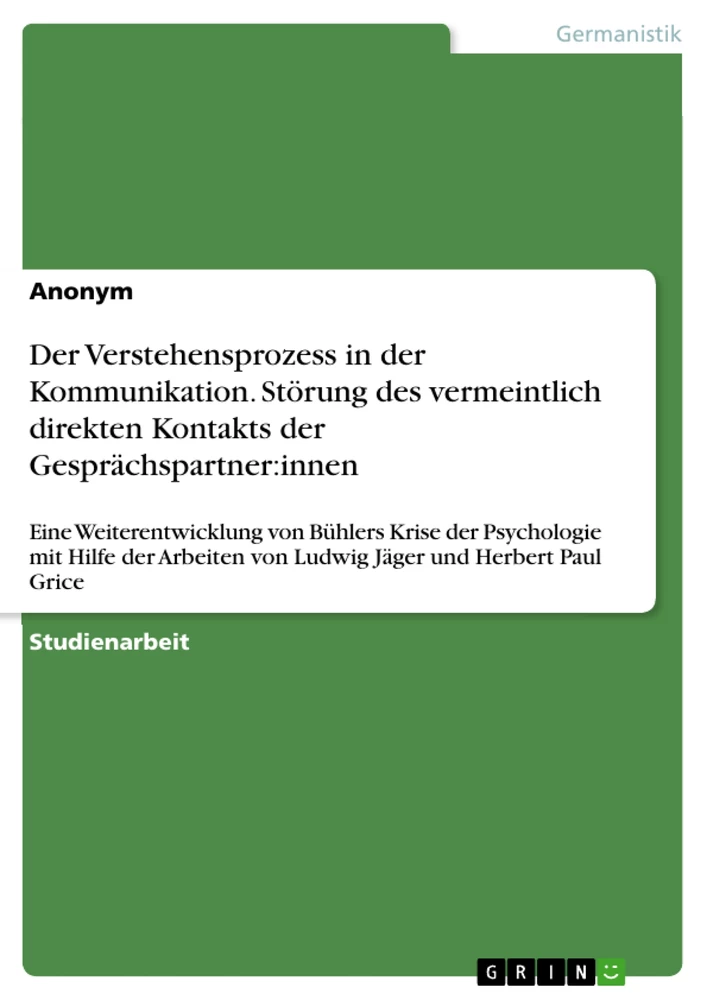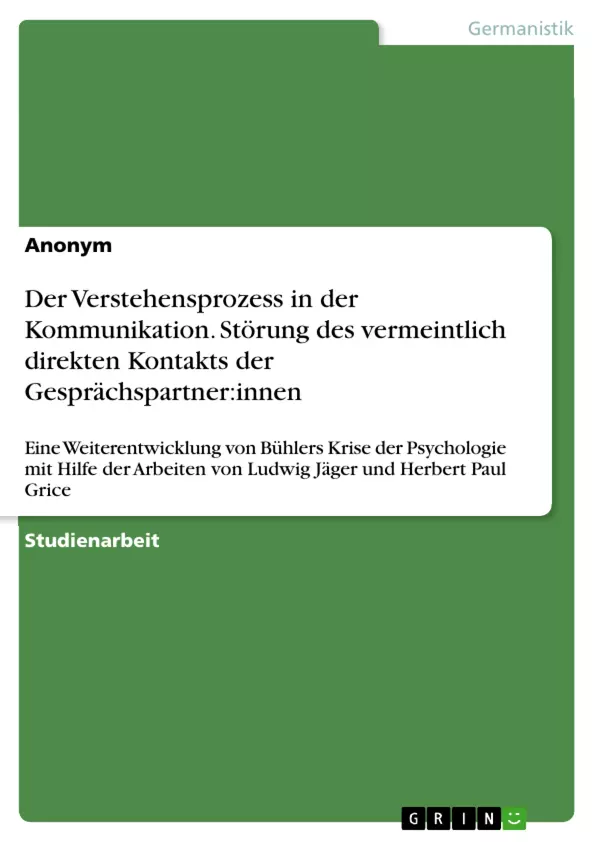Diese Hausarbeit möchte den Prozess der gemeinsamen Sinnkonstitution in wechselnden Sprechhandlungen zweier Gesprächspartner:innen unter die Lupe nehmen und Schritt für Schritt theoretisch analysieren.
Befindet man sich im verbalen Gespräch mit einer anderen Person, so steht zwischen Sprecher:in und Hörer:in immer die Sprache als Mittler. Nur mit Hilfe dieser Sprache, die als konventionelles Mittel agiert, können die Akteur:innen ihr Gegenüber verstehen. Dennoch denkt man im Gespräch kaum über diesen Sachverhalt nach, man befindet sich in vermeintlich direktem Kontakt mit dem/der Gesprächspartner:in. Dieser direkte Kontakt kann jedoch durch verschiedene Ursachen auf sprachlicher Ebene gestört werden. Im Moment des (vermeintlichen) Missverstehens tritt die Sprache in den Vordergrund, die Beteiligten werden sich, mindestens unterschwellig, bewusst, dass die Sprache im Gespräch immer zwischen ihnen steht. Sie haben nun das Ziel, den störungsfreien Kontakt schnellstmöglich wiederherzustellen.
Dieser Prozess der gesprochenen Sprache soll in der Hausarbeit also anhand der Theorie von Karl Bühler als Grundlage aufgerollt und mit den Arbeiten von Ludwig Jäger verknüpft werden. Auch die Arbeiten des Sprachphilosophen Herbert Paul Grice können hier produktiv zum Erkenntnisgewinn beitragen.
Als Ausgangsfrage der Hausarbeit ergibt sich damit, wie der scheinbar direkte Kontakt in der Kommunikation als sprachlich vermittelt aufgedeckt wird und darauf aufbauend, wie es danach gelingt, die Kommunikation und damit einhergehend das gegenseitige Verstehen aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie sich an diese Theorie anknüpfend, exemplarisch das Auftreten von Problemen und deren Auflösung nach ironischem Sprachgebrauch betrachten lässt.
Dazu wird zunächst einmal die Theorie Bühlers aus den Werken Die Krise der Psychologie und Sprachtheorie - Die Darstellungsfunktion der Sprache dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf die Themen gelegt wird, die für die Beantwortung der Ausgangsfrage aufschlussreich sind. Der Fokus liegt hier auf der Darstellungsfunktion der Sprache, besonders auf dem sogenannten Kontakt höherer Ordnung, verbunden mit Kontakt- und Wahrnehmungstiefe. Anschließend soll der (vermeintlich) direkte Kontakt in der menschlichen Kommunikation erläutert werden. Darauf aufbauend folgt ein Kapitel zur Ironie in der Kommunikation.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Bühlers Entfaltung der Sprachtheorie in Krise der Psychologie und Sprachtheorie - Die Darstellungsfunktion der Sprache
- 2.1 Ausdruck, Appell und Darstellung: Die Funktionen des sprachlichen Zeichens
- 2.2 Kontaktverstehen: Kontakttiefe und Wahrnehmungstiefe
- 3. Weiterentwicklung von Bühlers Ansatz aufbauend auf Ludwig Jägers Störung und Transparenz
- 3.1 Die Begriffe Störung und Transparenz
- 3.2 Synthese der Theorien von Karl Bühler und Ludwig Jäger
- 4. Modi der Störung und Transparenz am Beispiel der Ironie in der Kommunikation mit Hilfe von Grices Implikaturtheorie.
- 4.1 Grices Implikaturtheorie mit dem Schwerpunkt Ironie.
- 4.2 Die Rolle des Beispiels der Ironie bezogen auf die Theorien Bühlers und Jägers
- 5. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Verstehensprozess in der Kommunikation, insbesondere im Kontext von Störungen des scheinbar direkten Kontakts zwischen Gesprächspartnern. Sie beleuchtet, wie Sprache als Mittler zwischen Sender und Empfänger agiert und wie diese mediierende Funktion bei Störungen deutlich wird. Die Arbeit fokussiert auf die Theorien von Karl Bühler und Ludwig Jäger, um die Prozesse des Missverstehens und der Wiederherstellung von Verständnis zu analysieren.
- Die Rolle der Sprache als Mittler in der Kommunikation
- Die Bedeutung von Störungen des vermeintlich direkten Kontakts in der Kommunikation
- Die Analyse der Theorien von Karl Bühler und Ludwig Jäger im Kontext von Missverstehen und Wiederherstellung von Verständnis
- Die Anwendung von Grices Implikaturtheorie auf das Beispiel der Ironie
- Die Verbindung zwischen Sprache, Kommunikation und sozialem Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach dem Verstehensprozess in der Kommunikation bei Störungen des vermeintlich direkten Kontakts zwischen Gesprächspartnern vor. Sie erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und die zu analysierenden Theorien von Karl Bühler, Ludwig Jäger und Herbert Paul Grice.
- Kapitel 2: Bühlers Entfaltung der Sprachtheorie: Dieses Kapitel behandelt Bühlers Theorie der sprachlichen Zeichen und sein Konzept des Kontaktverstehens, wie es in seinen Werken „Krise der Psychologie“ und „Sprachtheorie – Die Darstellungsfunktion der Sprache“ dargelegt wird. Der Schwerpunkt liegt auf den drei Funktionen des sprachlichen Zeichens (Ausdruck, Appell, Darstellung) und dem Konzept der Kontakttiefe und Wahrnehmungstiefe.
- Kapitel 3: Weiterentwicklung von Bühlers Ansatz: Dieses Kapitel analysiert die Konzepte von Störung und Transparenz, die Ludwig Jäger in Bezug auf Bühlers Theorie einführt. Es zeigt, wie sich diese Konzepte mit Bühlers Ideen verbinden lassen und wie sie einen dynamischeren Blick auf den Kommunikationsprozess erlauben.
- Kapitel 4: Modi der Störung und Transparenz am Beispiel der Ironie: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Ironie in der Kommunikation anhand der Theorie von Herbert Paul Grice. Es zeigt, wie die Implikaturtheorie Grices die Konzepte der Störung und Transparenz aus den Theorien von Bühler und Jäger verdeutlichen kann.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die Sprache als Mittler in der Kommunikation, der Verstehensprozess, Störungen des direkten Kontakts, die Theorien von Karl Bühler und Ludwig Jäger, die Implikaturtheorie von Herbert Paul Grice, und die Analyse der Ironie als Beispiel für einen Kommunikationsstörung. Diese Themen werden im Kontext von sozialem Handeln und Interaktion erörtert.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert der Verstehensprozess in der Kommunikation?
Er basiert auf der gemeinsamen Sinnkonstitution, wobei Sprache als notwendiger Mittler zwischen den Gesprächspartnern steht.
Was sind die drei Funktionen des sprachlichen Zeichens nach Karl Bühler?
Bühler unterscheidet Ausdruck (Sprecher), Appell (Hörer) und Darstellung (Gegenstände und Sachverhalte).
Was bedeuten „Störung“ und „Transparenz“ nach Ludwig Jäger?
Transparenz herrscht, wenn die Sprache als Mittler unbemerkt bleibt; bei einer Störung (Missverständnis) tritt die Sprache selbst in den Vordergrund.
Wie erklärt Grices Implikaturtheorie Ironie?
Ironie ist eine bewusste Verletzung von Konversationsmaximen, bei der der Hörer die gemeinte Bedeutung hinter dem wörtlich Gesagten erschließen muss.
Was ist „Kontaktverstehen“?
Ein Konzept von Bühler, das die Tiefe der gegenseitigen Wahrnehmung und den scheinbar direkten Kontakt in der Sprechhandlung beschreibt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2023, Der Verstehensprozess in der Kommunikation. Störung des vermeintlich direkten Kontakts der Gesprächspartner:innen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1379198