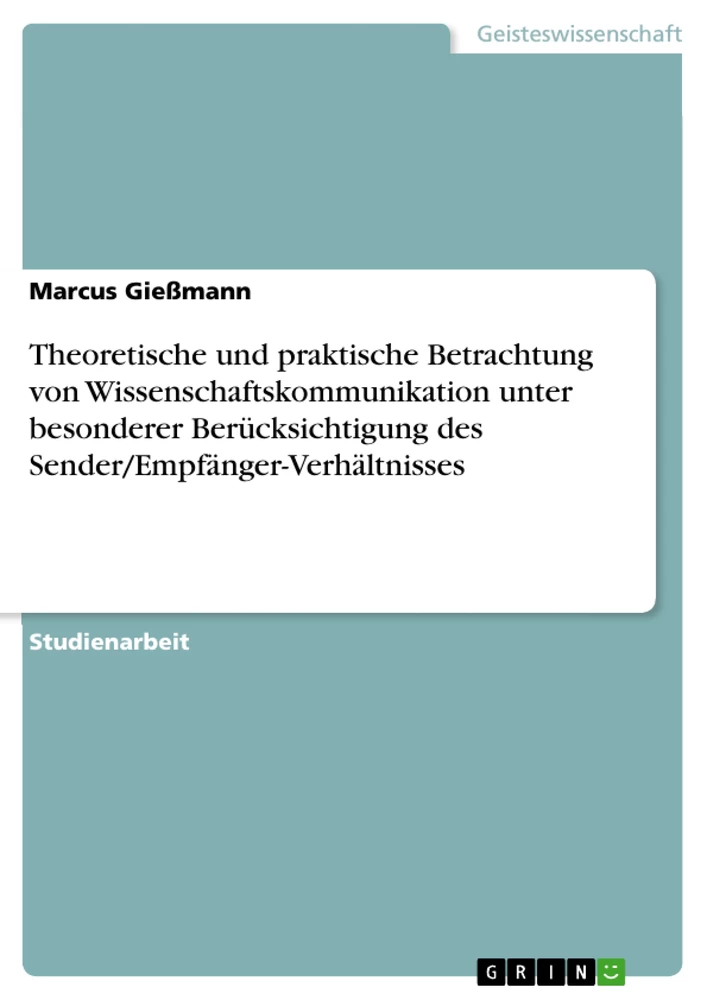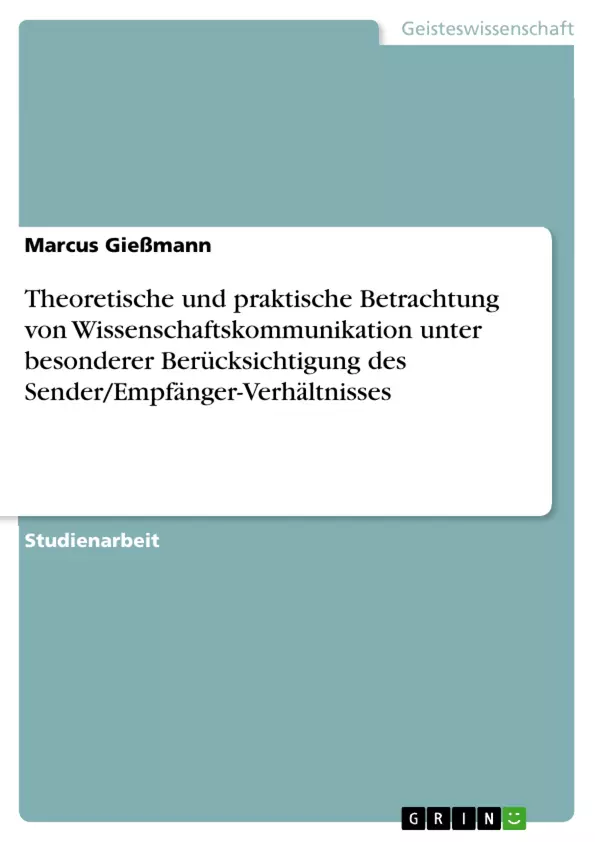Die vorliegende Arbeit ist grob in zwei Teile gegliedert: Den ersten, theoretischen, bilden Überlegungen, die sich mit Besonderheiten und Funktion von Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen (Punkte 1-3). Insbesondere wird das Sender und Empfänger-Verhältnis in der Wissenschaftskommunikation problematisiert. Auf eine Kategorisierung von Akteuren, Medien und sonstigen theoretisch-schematischen Konstrukten wurde verzichtet, da hierzu bereits ausreichend Material vorliegt. Im zweiten, der Praxis entlehnten Teil, findet eine stichprobenartige Darstellung der Realisierung von Wissenschaftskommunikation anhand der Rezeption eines wissenschaftlichen Kommunikats bei fünf Probanden statt (Punkt 4).
Abschließend wird untersucht, ob und inwieweit die theoretischen Überlegungen mit den praktischen Ergebnissen in Verbindung gebracht werden können (Punkt 5).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die besondere Art der Wissenschaftskommunikation
- 1.1. Darstellung der raum-zeitlich bedingten Interdependenzen zwischen Sender/Empfänger und dem Kommunikationskanal (Medien)
- 1.2. Die besondere (Ausgangs-)Position von Sender und Empfänger in der Wissenschaftskommunikation
- 1.3. Asymmetrische Kommunikation
- 1.4. Die spezielle Anschlussfähigkeit in der Wissenschaftskommunikation
- 2. Die Funktion der Wissenschaftskommunikation
- 3. Ein vernachlässigtes Faktum: Die praktische Wertlosigkeit der (meisten) Kommunikate in der Wissenschaftskommunikation
- 4. Beschreibung der Realisierung der Rezeption von Wissenschaftskommunikation anhand von Einzelfallbeispielen
- 5. Interpretation der Ergebnisse
- 6. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wissenschaftskommunikation, sowohl theoretisch als auch praktisch. Der Fokus liegt auf dem Sender-Empfänger-Verhältnis und der Frage, wie dieses die Besonderheiten der Wissenschaftskommunikation prägt. Ein empirischer Teil analysiert die Rezeption wissenschaftlicher Kommunikate.
- Besonderheiten der Wissenschaftskommunikation im Vergleich zu allgemeiner Kommunikation
- Das asymmetrische Sender-Empfänger-Verhältnis in der Wissenschaftskommunikation
- Die Funktion und der praktische Wert von Wissenschaftskommunikation
- Empirische Analyse der Rezeption wissenschaftlicher Kommunikate
- Verknüpfung von Theorie und Empirie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die besondere Art der Wissenschaftskommunikation: Dieses Kapitel differenziert Wissenschaftskommunikation von allgemeiner Kommunikation. Es werden die Unterschiede in Bezug auf das Sender-Empfänger-Verhältnis, die Rolle der Medien und die Anschlussfähigkeit der Inhalte herausgearbeitet. Die Unterscheidung zwischen externer ("Science Communication") und interner ("Scholarly Communication") Wissenschaftskommunikation wird eingeführt und die Asymmetrie im Kommunikationsverhältnis hervorgehoben. Die Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse, indem es die spezifischen Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation beleuchtet und den Kontext für die folgenden Kapitel schafft. Die "diffusen" Empfänger in der externen Wissenschaftskommunikation werden im Kontrast zu den klar definierten Empfängern der internen Kommunikation gesetzt. Die Notwendigkeit, die Inhalte für den Empfänger anschlussfähig zu machen, wird als zentrale Herausforderung herausgestellt.
2. Die Funktion der Wissenschaftskommunikation: Dieses Kapitel behandelt die Funktion der Wissenschaftskommunikation. Es untersucht die Rolle der Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft und ihre Bedeutung für den Informationsfluss. Im Gegensatz zum Obskurantismus, der das Wissen gezielt zurückhält, ermöglicht Wissenschaftskommunikation den Zugang zu Informationen und fördert die Aufklärung. Das Kapitel diskutiert die Bedeutung von freiem und ungezügeltem Informationsaustausch als Indikator für eine aufgeklärte Gesellschaft. Der Einfluss von Machtstrukturen auf den Informationsfluss und die Rolle der Wissenschaftskommunikation bei der Durchbrechung dieser Strukturen wird analysiert.
3. Ein vernachlässigtes Faktum: Die praktische Wertlosigkeit der (meisten) Kommunikate in der Wissenschaftskommunikation: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit dem oft geringen praktischen Nutzen vieler wissenschaftlicher Kommunikate. Es analysiert die Diskrepanz zwischen dem Aufwand der Wissenschaftskommunikation und ihrer tatsächlichen Wirkung. Die Argumentation konzentriert sich auf die mangelnde Relevanz für den Empfänger und die Schwierigkeiten bei der Übermittlung komplexer wissenschaftlicher Inhalte. Das Kapitel bereitet den Leser auf den empirischen Teil der Arbeit vor, in dem die Rezeption von Wissenschaftskommunikation untersucht wird.
4. Beschreibung der Realisierung der Rezeption von Wissenschaftskommunikation anhand von Einzelfallbeispielen: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Rezeption eines wissenschaftlichen Kommunikats bei fünf Probanden. Es geht detailliert auf die Methodik der Studie ein und präsentiert die Ergebnisse der Rezeptionsanalyse. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Interpretation und die Verknüpfung mit den vorherigen theoretischen Überlegungen. Dieses Kapitel ist der Kern des praktischen Teils der Arbeit.
5. Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung aus Kapitel 4. Es untersucht den Zusammenhang zwischen den theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel und den praktischen Ergebnissen der Rezeptionsanalyse. Die Interpretation wird die Grenzen und Möglichkeiten der Wissenschaftskommunikation aufzeigen. Es wird der Bezug zu den zentralen Themen der Arbeit hergestellt und die Ergebnisse in einen größeren Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Wissenschaftskommunikation, Sender-Empfänger-Verhältnis, Asymmetrische Kommunikation, Rezeption, Empirische Untersuchung, Wissenschaftsverständnis, Aufklärung, Medien, Kommunikationskanal.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wissenschaftskommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wissenschaftskommunikation umfassend, sowohl theoretisch als auch empirisch. Der Fokus liegt auf dem Sender-Empfänger-Verhältnis und der Frage, wie dieses die Besonderheiten der Wissenschaftskommunikation prägt. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der Rezeption wissenschaftlicher Kommunikate.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Besonderheiten der Wissenschaftskommunikation im Vergleich zur allgemeinen Kommunikation, das asymmetrische Sender-Empfänger-Verhältnis, die Funktion und den praktischen Wert von Wissenschaftskommunikation, eine empirische Analyse der Rezeption wissenschaftlicher Kommunikate und die Verknüpfung von Theorie und Empirie. Es wird auch die Unterscheidung zwischen externer ("Science Communication") und interner ("Scholarly Communication") Wissenschaftskommunikation betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Kapitel 1 differenziert Wissenschaftskommunikation und beleuchtet Herausforderungen. Kapitel 2 behandelt die Funktion und Bedeutung von Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft. Kapitel 3 analysiert kritisch den oft geringen praktischen Nutzen vieler wissenschaftlicher Kommunikate. Kapitel 4 beschreibt eine empirische Untersuchung zur Rezeption wissenschaftlicher Kommunikate. Kapitel 5 interpretiert die Ergebnisse dieser Untersuchung und Kapitel 6 bietet eine Reflexion der gesamten Arbeit.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung angewendet?
Kapitel 4 beschreibt eine empirische Untersuchung der Rezeption eines wissenschaftlichen Kommunikats bei fünf Probanden. Die Arbeit geht detailliert auf die Methodik der Studie ein und präsentiert die Ergebnisse der Rezeptionsanalyse. Die genaue Methodik wird im Detail in Kapitel 4 erläutert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Kapitel 4 präsentiert und in Kapitel 5 interpretiert. Die Interpretation untersucht den Zusammenhang zwischen den theoretischen Überlegungen und den praktischen Ergebnissen der Rezeptionsanalyse und zeigt Grenzen und Möglichkeiten der Wissenschaftskommunikation auf.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit ergeben sich aus der Interpretation der empirischen Ergebnisse und der theoretischen Analyse. Diese werden in Kapitel 5 und 6 zusammengefasst und in einen größeren Kontext eingeordnet. Die Arbeit zeigt die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation auf, insbesondere hinsichtlich der Relevanz und der Anschlussfähigkeit der Inhalte für den Empfänger.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Wissenschaftskommunikation, Sender-Empfänger-Verhältnis, Asymmetrische Kommunikation, Rezeption, Empirische Untersuchung, Wissenschaftsverständnis, Aufklärung, Medien, Kommunikationskanal.
- Arbeit zitieren
- Marcus Gießmann (Autor:in), 2009, Theoretische und praktische Betrachtung von Wissenschaftskommunikation unter besonderer Berücksichtigung des Sender/Empfänger-Verhältnisses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137943