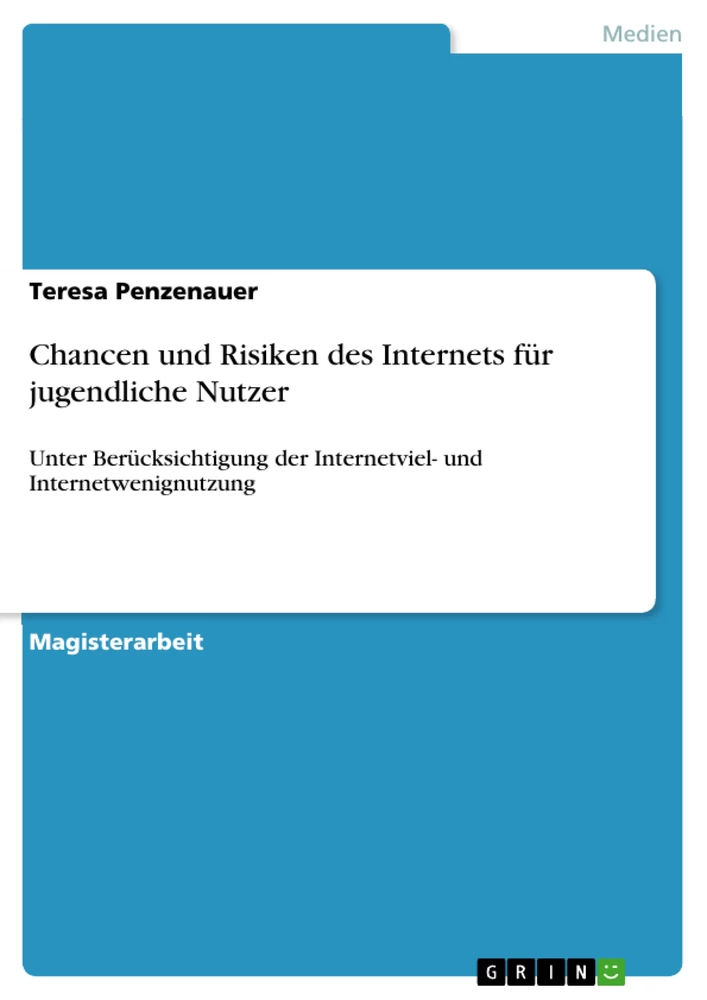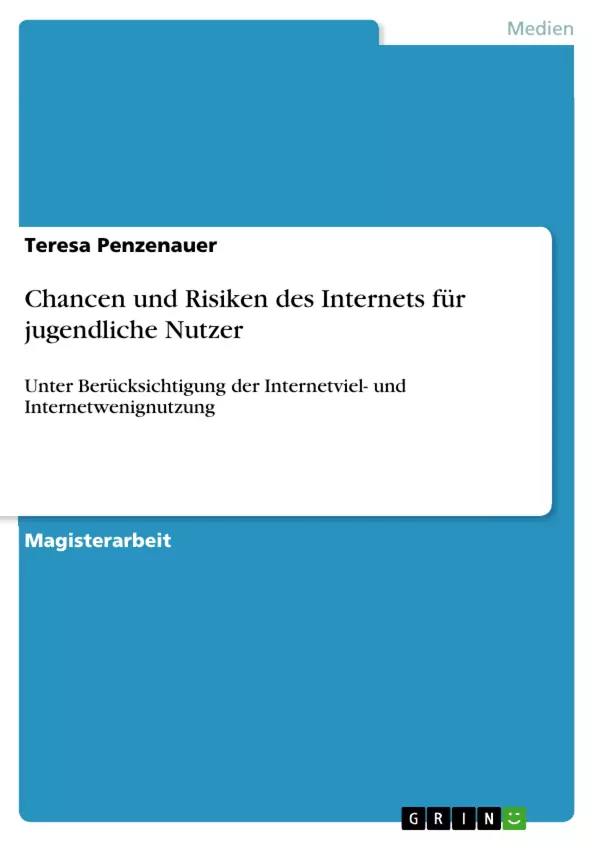Diese empirische Arbeit untersucht, ob die jugendliche Internetnutzung mehrheitlich Chancen oder Risiken birgt, unter besonderer Berücksichtigung der Internetviel- und Internetwenignutzung. Zu diesem Zweck wurden vier Gruppendiskussionen mit jeweils zwei Gruppen von Jugendlichen und zwei Gruppen von Eltern, die jeweils Internetviel- oder Internetwenignutzer sind, durchgeführt. Festzustellen galt es nicht nur, welchen Gefahren die Jugendlichen im Internet ausgesetzt sind, sondern auch, wie gefährdet sich die Jugendlichen selbst sehen, welche Erfahrungen sie im Netz machen, mit welchen Erfahrungen sie zu den Eltern gehen und wie sie allgemein ihre Internetnutzung empfinden. Durch die Gruppendiskussionen mit den Eltern sollte erkennbar werden, inwiefern sich die Eltern für die Internetnutzung ihrer Kinder interessieren, wie sie selbst zu diesem Medium stehen, welche Eingriffstrategien sie haben und ob es einen Zusammenhang zwischen dem Erziehungs- und dem Kommunikationsstil, bezogen auf die jugendliche Internetnutzung, gibt. Ummantelt von den Cultural Studies als theoretischen Zugang und den normativen Positionen des öffentlichen Mediendiskurses als weiterer, theoretischer Anknüpfungspunkt, werden Begriffe wie Kindheitstheorien, das Jugendalter, Entwicklungsaufgaben, Medienkompetenz, Medienpädagogik, Pflichten der Eltern, Erziehungsstile, Mediensozialisierung, Internet und Identitätsbildung, veränderte Mediennutzung, die Internetnutzung in starker Anlehnung an die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 und die jugendgefährdenden Inhalte im Internet erläutert. Der empirische Teil zeigt auf, dass das „wie“ der Internetnutzung bestimmt, ob sich die Nutzung konstruktiv oder subversiv auswirkt. Dieses „wie“ der jugendlichen Internetnutzung ist abhängig von zahlreichen Einflussfaktoren: Ausbildung, Mediensozialisierung durch Eltern und Peer Group, soziokulturelle Faktoren wie ländlicher oder urbaner Wohnort und Einkommen der Eltern, Technologieausstattung im Haushalt, Erziehungsstil und vieles mehr. Insgesamt konnten sechs Internetnutzungstypen bestimmt werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Persönlicher Zugang zum Thema.. 8
2 Einleitung.. 9
3 Erkenntnisinteresse.. 13
4 Theoretischer Zugang: Cultural
Studies..
15
4.1 Inhaltliche Definition der Cultural Studies.. 16
4.2 Cultural Studies und
Medien..
18
5 Normative Positionen im öffentliche
Mediendiskurs..
20
5.1 Die
Kulturpessimisten.
20
5.2 Die kritischen Medienoptimisten..
21
5.3 Die euphorischen
Medienpromotoren..
21
6 Vorstellungen von Kindheit: Neue Soziologie der Kindheit und Klassisches
Stufenmodell
der Entwicklungspsychologie..
23
6.1 Kulturpessimisten und Stufenmodell..
23
6.2 Kritische Medienoptimisten/euphorische Medienpromotoren und die Neue
Soziologie
der
Kindheit..
24
6.3 Konsequenzen der Kindheitstheorien für die normativen
Positionen.. 24
7 Das Jugendalter
Adolescence..
26
7.1 Entwicklungsaufgaben..
28
7.2 Zentrale Themen im
Jugendalter..
29
7.2.1
Familie..
30
7.2.2 Beziehungen zu Gleichaltrigen (Peers).. 32
7.2.3 Schule und
Berufsvorbereitung..
33
7.2.4 Orientierung durch das Freizeitleben.. 33
7.3 Jugendliche Wertetypen in Österreich..
34
7.3.1 Die unentschiedenen
Optimisten..
35
7.3.2 Die egozentrischen
Hedonisten..
36
7.3.3 Die resignierten Skeptiker..
36
7.3.4 Die freizeitorientierten Hedonisten..
37
7.3.5 Die leistungsorientierten
Idealisten..
37
7.3.6 Die prosozialen Pragmatiker..
38
7.4 Psychosoziale Entwicklungen und
Entwicklungsprobleme.. 39
8 Internet und Identitätsbildung.. 41
9 Medienpädagogik – Eine
Einleitung..
42
9.1 Medienpädagogische Handlungskonzepte nach
Swoboda.. 44
9.2 Medienbildung nach Ingrid Geretschlaeger.. 45
9.3 Die Pflichten der
Eltern..
47
9.4 Medienkompetenz als
Zauberformel?..
48
9.5 Medienkompetenz durch die
Mediensozialisation..
50
9.6 Sozialisationsprozesse im Kontext der
Mediennutzung.. 53
10 Das Internet als
Dschungel..
54
10.1 Medienbezogene Auslöser der veränderten Mediennutzung.. 55
10.2 Nutzerbezogene Auslöser der veränderten
Mediennutzung.. 56
10.3 Anhaltspunkte der veränderten Mediennutzung.. 56
11
Internetnutzung..
58
11.1 ARD/ZDF-Onlinestudie
2008..
59
11.2 Einfluss der sozialen Milieus auf die
Internetnutzung.. 67
11.3 Stadt-Land-Unterschiede in der Internetnutzung .. 68
12 Jugendgefährdung im
Internet..
70
12.1 Pornografie..
72
12.2 Neonazis und politischer Extremismus..
76
12.3 Okkulte Gruppierungen und
Sekten..
79
12.4 Selbstmord- und Pro Ana-Websites..
80
12.5 Gefahren auf Social-Network- und
Community-Seiten.. 83
12.6 Neue Phänomene „Happy Slapping“ und
„Snuff“.. 84
12.7 Sexueller Missbrauch im Internet..
85
Empirischer Teil.. 88
13
Erkenntnisinteresse..
89
13.1 Qualitative Methode:
Gruppendiskussion..
91
13.2 Zielsetzung der Gruppendiskussion..
92
13.3.Gruppenformen..
92
13.4 Die Rolle des Diskussionsleiters..
93
Reflexive Prinzipien nach
Bohnsack..
94
13.5 Ablauf der
Gruppendiskussion..
96
13.6 Vor- und Nachteile der
Gruppendiskussion..
97
13.7 Methodendesign..
98
13.7.1 Internet-Vielnutzer und Internet-Wenignutzer: In Anlehnung an
George Gerbner..
98
13.7.2
Diskussionsanreiz..
100
13.7.3 Zentrale Fragestellungen während der Gruppendiskussionen.. 101
14 Dominierende Orientierungsmuster..
103
14.1 Gruppe elterliche
Internetwenignutzer..
103
Profile der teilnehmenden Ehepaare..
103
Kurzbeschreibung des Diskussionsverlaufs.. 105
14.2 Gruppe jugendliche
Internetvielnutzer..
122
Kurzbeschreibung des Diskussionsverlaufs.. 122
Profile der
Teilnehmerinnen..
124
14.3 Gruppe elterliche
Internetvielnutzer..
138
Profile der Diskussionsteilnehmer..
138
Kurzbeschreibung des Diskussionsverlaufs.. 140
14.4 Gruppe jugendliche Internetwenignutzer.. 154
Profile der
Diskussionsteilnehmerinnen.
154
Kurzbeschreibung der
Gruppendiskussion..
156
15
Typen..
169
15.1 Der passive
Internetpessimist..
169
15.2 Der aufgeschlossene Internetoptimist..
170
15.3 Der kritische Internetwenignutzer..
171
15.4 Der indifferente Internetwenignutzer..
171
15.5 Der hyperaktive, junge Internetrealist..
172
15.6 Der junge, passive Internetwenignutzer..
173
16
Fazit..
174
16.1 Gute Zeiten – Schlechte Seiten..
174
16.2 Der Reiz des
Verbotenen..
176
16.3 Die Verantwortung liegt bei allen..
177
16.4 Normative Positionen und
Internetnutzung..
178
16.4.1 Die
Kulturpessimisten..
179
16.4.2 Kritische Medienoptimisten/euphorische Medienpromotoren und die
Neue
Soziologie der
Kindheit..
180
16.5 Soziokulturelle Faktoren..
182
16.6 Mütter sorgen sich mehr, Männer kennen sich besser aus?.. 183
16.7 Medienkompetenz..
184
16.8 Jugendgefährdung im
Internet..
186
16.8.1 Pornografie..
186
16.8.2 Sexueller Missbrauch im Internet..
188
17 Quellenverzeichnis.. 190
18 Anhang.. 197
Abstract
Diese empirische Arbeit untersucht, ob die jugendliche Internetnutzung mehrheitlich Chancen oder Risiken birgt, unter besonderer Berücksichtigung der Internetviel- und Internetwenignutzung. Zu diesem Zweck wurden vier Gruppendiskussionen mit jeweils zwei Gruppen von Jugendlichen und zwei Gruppen von Eltern, die jeweils Internetviel- oder Internetwenignutzer sind, durchgeführt. Festzustellen galt es nicht nur, welchen Gefahren die Jugendlichen im Internet ausgesetzt sind, sondern auch, wie gefährdet sich die Jugendlichen selbst sehen, welche Erfahrungen sie im Netz machen, mit welchen Erfahrungen sie zu den Eltern gehen und wie sie allgemein ihre Internetnutzung empfinden. Durch die Gruppendiskussionen mit den Eltern sollte erkennbar werden, inwiefern sich die Eltern für die Internetnutzung ihrer Kinder interessieren, wie sie selbst zu diesem Medium stehen, welche Eingriffstrategien sie haben und ob es einen Zusammenhang zwischen dem Erziehungs- und dem Kommunikationsstil, bezogen auf die jugendliche Internetnutzung, gibt. Ummantelt von den Cultural Studies als theoretischen Zugang und den normativen Positionen des öffentlichen Mediendiskurses als weiterer, theoretischer Anknüpfungspunkt, werden Begriffe wie Kindheitstheorien, das Jugendalter, Entwicklungsaufgaben, Medienkompetenz, Medienpädagogik, Pflichten der Eltern, Erziehungsstile, Mediensozialisierung, Internet und Identitätsbildung, veränderte Mediennutzung, die Internetnutzung in starker Anlehnung an die ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 und die jugendgefährdenden Inhalte im Internet erläutert. Der empirische Teil zeigt auf, dass das „wie“ der Internetnutzung bestimmt, ob sich die Nutzung konstruktiv oder subversiv auswirkt. Dieses „wie“ der jugendlichen Internetnutzung ist abhängig von zahlreichen Einflussfaktoren: Ausbildung, Mediensozialisierung durch Eltern und Peer Group, soziokulturelle Faktoren wie ländlicher oder urbaner Wohnort und Einkommen der Eltern, Technologieausstattung im Haushalt, Erziehungsstil und vieles mehr. Insgesamt konnten sechs Internetnutzungstypen bestimmt werden: Die Jugendlichen fallen jeweils entweder in die Gruppe der „hyperaktiven Internetrealisten“ oder in die Gruppe der „jungen, passiven Internetwenignutzer“. Erste sind, bis auf eine Ausnahme, Internetvielnutzer, die das Netz vielfältig nutzen, aber auch schon viele, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Insgesamt konnten sie sich aber eine kritisch-konstruktive Internetnutzung aneignen und haben selbst Strategien entwickelt, Risiken zu minimieren und schlechte Eindrücke zu verarbeiten. Die „jungen, passiven Internetnutzer“ sind Internetwenignutzer, kommen aus dem ländlichen Raum, besuchen keine höheren Schulen, kommen eher aus geringeren Einkommensschichten und besitzen kaum Medienkompetenz, den Chat als Ausgangfunktion ihrer Mediennutzung haben sie bis jetzt nicht verlassen. Anders als anzunehmen bewerten sie ihre Internetnutzung als positiv, die schlechten Erfahrungen im Internet stehen nicht im Vordergrund. Bei den elterlichen Gruppen ergaben sie vier Nutzungstypen: Der „passive Internetpessimist“ ist, unabhängig von seiner Medienkompetenz oder Ausbildung, eine Art „Internethasser“, der dieses Medium eher verteufelt als gutheißt, ähnlich wie der Kulturpessimist bei den normativen Positionen. Der „aufgeschlossene Internetoptimist“, ähnlich dem kritischen Medienoptimisten bei den normativen Positionen, formiert sich nur aus Internetvielnutzern mit hoher Ausbildung und solider Medienkompetenz, die die Eigenschaften des Internet, trotz mancher Risiken, als wertvoll und interessant empfinden und ihre Kinder kritisch auf das Medium hinführen und auch schützen. Der „kritische Internetwenignutzer“ hat kaum Medienkompetenz, steht der jugendlichen Internetnetzung aber positiv gegenüber und versucht medienpädagogische Eingriffstrategien anzuwenden. Der „indifferente Internetwenignutzer“ erkannte erst im Laufe der Gruppendiskussion, dass es zahlreiche Gefahren für Heranwachsende im Internet gibt und besitzt kaum Medienkompetenz. Dieser Typus versucht seine fehlende Erziehungsverantwortung zu beschönigen, indem er darauf verweist, dass man Kinder nie vollkommen schützen könne und auch andere Medien ungeeignete Inhalte anbieten würden.
1 Persönlicher Zugang zum Thema
Schon bei meinen beiden Bakkalaureat-Arbeiten an der Universität Salzburg waren meine Themen internetbasiert, ich behandelte jeweils in reinen Literaturanalysen die Themen „Journalismus im Umbruch – ist bloggen Journalismus?“ bei Prof. Dr. Hummel und „Chancen und Risiken der Cyberlove – Partnersuche im Internet“ bei Dr. Christian Fuchs. Und spätestens nach meiner zweiten Bakkalaureat-Arbeit über die Partnersuche im Internet wurde mir klar, dass sich auch meine Magisterarbeit rund um das Thema Internet drehen würde. Denn mir war bewusst geworden, dass das Internet nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch Nachteile und Gefahrenquellen - vor allem für labile oder junge Internetnutzer [1]. Fortan betrachtete ich das Internet zunehmend mit anderen Augen und bemerkte schnell, dass es tatsächlich viele Inhalte gibt, die unkontrollierbar von jedem verwendet und auch online gestellt werden können. So fiel mir beispielsweise auf der Social-Network-Plattform „Szene1“ beim Durchstöbern der verschieden Fotoalben auf, dass man immer wieder Fotos und Videos fand, die pornographisch, Gewalt (Fotos junger Männer mit Handfeuerwaffen, Bundesheerler mit angelegten Gewehren…) oder Drogen verherrlichend waren. Außerdem war es mir selbst öfters passiert, dass mich Männer in den 30ern und 40ern anschrieben, mir Komplimente zu meinen Fotos und teilweise recht eindeutige Angebote machten. Nur, ich war zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen – aber was wäre gewesen wenn ich zehn, 11 Jahre alt gewesen wäre? Wie wäre ich dann mit solchen Erlebnissen umgegangen?
Das Themenfeld „Jugendschutz im Internet“ geriet so in meine Aufmerksamkeit und ursprünglich wollte ich dieses Thema in meiner Magisterarbeit abhandeln. Doch nach dem ersten Magisterseminar-Termin bei Prof. Vitouch im WS 08/09 an der Universität Wien stellte sich heraus, dass es einen effektiven Jugendschutz im Internet de facto schlicht weg nicht gibt und wahrscheinlich nie geben wird – und deswegen nicht erforschbar ist. Deswegen verlagerte ich mein Erkenntnisinteresse in den Bereich, in dem in erster Linie Jugendschutz und das Verständnis dafür, geschehen sollte: innerhalb der Familie und auch während der Schulausbildung.
2 Einleitung
Dass die Menschheit immer mehr Zeit mit den Medien verbringt [2] (zumindest in den Industriestaaten), das ist nun keine Neuigkeit mehr und wenig überraschend. Dennoch gibt es eine Bewegung medialer Nutzungsdaten, die aufhorchen lässt: die des Internet. Vor allem Jugendliche nutzen das Medium Internet immer öfter und vor allem immer intensiver [3], auch Kinder kommen schon im Kleinkindalter mit dem Internet in Kontakt und integrieren es als selbstverständliches Alltagsmedium in ihre Lebenswelt. Oberstaatsanwalt Peter Vogt spricht sogar davon, dass sich das Internet zu einem Leitmedium in der Heranwachsendenszene entwickelt (vgl. Richard/Krafft-Schöning 2007: 9) - es ist zu einer bedeutenden Sozialisationsinstanz [4] herangereift (vgl. Geretschlaeger 2005: 1). Die Internetnutzung in Österreich steigt kontinuierlich an, es sind bereits fast fünf Millionen Österreicher online, ca. vier Millionen nutzen das Internet mehrmals die Woche - und in dieser Aufstellung sind die Kinder unter 14 Jahren noch gar nicht berücksichtigt.
[Abb. in dieser Vorschau nicht enthalten]
Abbildung 1: Internet Nutzung in Österreich seit 1996 bis 2008. Quelle: Integral, AIM
Die meisten Internetuser finden sich laut Integral AIM (Austrian Internet Monitor) in der Altersklasse der 14- bis 19-jährigen. Die Internet-User geschlechtsspezifisch betrachtet, nutzen 16 Prozent mehr Männer als Frauen das Internet - dies Lücke schließt sich aber zusehends.
[Abb. in dieser Vorschau nicht enthalten]
Abbildung 2: Internet Nutzung nach Zielgruppen (Geschlecht und Alter). Quelle: Integral, AIM
Durch die hohe Medienkonvergenz und Digitalisierung durchdringen die Medien alles und jeden und verlangen eine hohe Crossmedialität (vgl. Hasebrink 2008: 111). Diese bündelt sich zunehmend im Internet, angefangen bei den Onlineausgaben der Zeitungen, der Fernsehsender und deren Formate, Kino, selbstgemachte Filme und Mitschnitte auf YouTube, über Onlineshopping, E-Government und Onlinebanking, bis hin zu den zahlreichen Spiele-Seiten, kommunikativen Plattformen und Suchmaschinen, die zu jedem nur erdenklichem Thema Inhalte und Informationen liefern. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Medium Internet etabliert und stark weiterentwickelt, es ist die dynamischste Medienentwicklung seit den letzten 15 Jahren, der Nutzungsumfang und die Wertschätzung verschieben sich weiterhin in Richtung digitale Medien (vgl. Oehmichen/Schröter 2008: 394).
Das Internet ist also ein Medium, das jedem alles zur Verfügung stellt. Aufgrund der einzigartigen Netzwerkstruktur entzieht es sich einer totalen Kontrolle, man kann nie wissen, auf was man als nächstes stoßen wird. Hinzu kommt, dass im Grunde genommen jeder User Teil dieses weltumspannenden Netzwerks ist und es auch aktiv mitgestalten und verändern kann (siehe dazu auch Döring 2003: 18). Diese Unkontrollierbarkeit und ständige Verformbarkeit ist eine Fähigkeit des Internets, die hoch geschätzt wird, da sie Möglichkeiten eröffnet, die im Real Life undenkbar sind.
Doch in Anbetracht dessen, dass das Internet vorwiegend von Erwachsenen betrieben und produziert wird, also Inhalte online zu finden sind, die nicht für Jugendliche oder Kinder geeignet sind, entfaltet sich hier ein großes Risikopotential. Die Jugendlichen müssen also vor dem geschützt werden, was Erwachsene im Internet konsumieren und produzieren (vgl. Dörken- Kuchharz 2008: 14). Und in Anbetracht dessen, dass es keinen wirksamen Jugendschutz im Internet [5] gibt, müssen sich die Jugendlichen auch selbst schützen. Pornografie, Pädophilie, Rechtsradikalismus, Fanatismus, Extremismus, Pro-Magersucht-Seiten, Gewaltverherrlichung und anderes Gräuel, mit dem man diese Aufzählung ins Unendliche strecken könnte, kann man im Internet mit nur einem Klick finden bzw. auch online stellen. Peter Vogt meint:
„Um so wichtiger ist es, Heranwachsende vor Inhalten und Einflüssen der Erwachsenenwelt, die nicht ihrem Entwicklungsstandard entsprechen, zu schützen und sie somit bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.“ (Richard/Krafft-Schöning 2007: 9)
Und es geht nicht nur darum, die jungen User vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, sondern ihnen auch klarzumachen, dass sie sich selbst schützen müssen: die Privat- und Intimsphäre, persönliche Daten und auch die körperliche und seelische Unversehrtheit. Viele pädophile Täter (und klarerweise andere Sextäter) machen sich das Internet zunutze, um Opfer auszuspionieren und in die Falle zu locken (vgl. RTR 2007: 36). Abgesehen davon können sich auch Jugendliche im Internet strafbar machen, in dem sie „Happy Slapping“ oder „Snuff [6]“ betreiben, zwei neue Phänomene, die einem Wertewandel und unglaublicher Langeweile entspringen und in dieser Arbeit noch erörtert und erklärt werden. Abgesehen von den schon genannten Problemen, gibt es im Internet soziale Risikopotentiale, wie beispielsweise Internetsucht [7], Eskapismus oder auch soziale Isolation, wenn zugunsten der virtuellen Kontakte die realen Freundschaften vernachlässigt werden (vgl. Süss 2004: 49).
In der Verantwortung steht hier also nicht nur der Staat mit der - auf das Internet bezogen unwirksamen - Jugendschutzgesetzgebung [8], sondern alle: die Eltern, Lehrer, Pädagogen und die Medienindustrie, Politik, Kirche, Hochschulen - Jugendschutz im Internet sollte als öffentliche Aufgabe wahrgenommen werden (Dörken-Kuchharz 2008: 7). Die Zauberworte oder auch Schlüsselfunktionen, die helfen können die Kinder und Jugendliche zu schützen, heißen Medienkompetenz [9], Medienpädagogik und Aufklärung im Sinne der Prävention.
Die Eltern wissen oft nicht Bescheid darüber, was ihre Kinder im Internet rezipieren. Entweder, weil sie nicht daran denken, dass sich ihre Kinder in Gefahr befinden könnten, weil ihnen das Verständnis für dieses Medium völlig fehlt, weil sie es selbst kaum oder gar nicht verwenden oder weil es ihnen schlicht weg egal ist, sozusagen das Internet als eine Art „Babysitter“ einsetzen, damit sie ihre Ruhe haben. Deswegen möchte ich mit dieser empirischen Forschungsarbeit, mithilfe der qualitativen Methode der Gruppendiskussion, herausfinden, wie groß die kommunikative Differenz zwischen Eltern und deren Kindern ist, wenn sie über die Internetnutzung sprechen. Was glauben Eltern über die Internetnutzung ihrer Kinder? Inwiefern wird innerhalb der Familie darüber gesprochen? Und wie viel Kontrolle über die Eltern aus? Und aus der Perspektive der Jugendlichen soll diskutiert werden, wie sie das Internet verwenden, ob es schon einmal problematische Vorgänge gegeben hat, welches Potential sie dem Internet zuschreiben und wie sehr das Internet schon in ihren Medienalltag verstrickt ist.
3 Erkenntnisinteresse
Meine Hauptforschungsfrage lautet: „Was sind die Chancen und Risiken der jugendlichen Internetnutzung?“ Da mein Erkenntnisinteresse ein sehr umfangreiches ist, habe ich es in 22 Unterforschungsfragen aufgeteilt, um es angemessen beantworten und alle relevanten Themenbereiche abdecken zu können. Folgende Fragestellungen beschreiben mein detailliertes Erkenntnisinteresse:
Grundlegend:
(1) Wie unterscheidet sich die Kommunikation der Eltern und Jugendlichen über die wahrgenommen Chancen und Risiken im Internet für Jugendliche?
(2) Welcher Erziehungsstil korrespondiert mit welchem Kommunikationsstil zwischen Eltern und Kindern?
Eltern:
(3) Was wissen die Eltern generell über die Internetnutzung ihrer Kinder?
(4) Wie beurteilen die Eltern den Umgang ihrer Kinder mit dem Internet, welche Ängste haben sie und welche Strategien des Eingreifens?
(5) Sind die Kinder medienkompetenter als die Eltern oder werden sie nur fälschlicherweise als kompetenter wahrgenommen?
(6) Werden die Kinder medienpädagogisch in der Schule und von den Eltern betreut?
(7) Bilden sich die Eltern medienpädagogisch weiter?
(8) Wird die Internetnutzung der Kinder mit den Eltern besprochen?
(9) Sind Männer nach wie vor interneterfahrener und haben deswegen die höhere Medienkompetenz?
(10) Inwiefern spielt die Ausbildung der Eltern eine Rolle beim Erkennen der Chancen und Risiken der jugendlichen Internetnutzung?
(11) Inwiefern spielt die Quantität der elterlichen Internetnutzung eine Rolle beim Erkennen der Chancen und Risiken der jugendlichen Internetnutzung?
Jugendliche:
(12) Umgekehrt stellt sich die Frage, wie Jugendliche ihren Umgang mit dem Internet definieren: als Problem und Angst belastet?
(13) Oder pflegen die Heranwachsenden einen lockeren Umgang mit dem Internet und kennen keine negativen Erfahrungen?
(14) Reden sie mit ihren Eltern über ihre Internet-Erfahrungen?
(15) Oder tauschen sie sich eher mit ihren Freunden aus?
(16)Wieviel Zeit verbringen die Jugendlichen im Internet, warum und vor allem was rezipieren sie dort?
(17)Was wissen sie über die Gefahren im Internet?
(18)Was ist ihnen vielleicht schon im Internet passiert?
(19) Haben sie über diese negativen Geschehnisse mit ihren Eltern gesprochen?
(20) Inwiefern spielt die Ausbildung der Jugendlichen eine Rolle beim Erkennen der Chancen und Risiken ihrer Internetnutzung?
(21) Inwiefern spielt die Quantität der jugendlichen Internetnutzung eine Rolle beim Erkennen der Chancen und Risiken ihrer Internetnutzung?
(22) Inwiefern spielt der Wohnort (Stadt/Land) eine Rolle beim Erkennen der Chancen und Risiken der jugendlichen Internetnutzung?
4 Theoretischer Zugang: Cultural Studies
Da mein Thema dieser empirischen Arbeit ein sehr vielschichtiges ist, das viele Bereiche durchdringt - in erster Linie natürlich die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft unter dem Aspekt der Rezipientenforschung (was, wie, wann, warum und wie lange nutzen Jugendliche das Internet), Medienwirkungsforschung (wie wirken Internetinhalte auf Jugendliche), gefolgt von einem großen Schnittbereich zu den Sozialwissenschaften (Mediensozialisation, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Neue Soziologie der Kindheit), Psychologie (mögliche Traumatisierung durch Erlebnisse im Internet, Familienpsychologie, Medienpsychologie, Entwicklungspsychologie) und Erziehungswissenschaften (Erziehungsstile, familiäre Kommunikation), Rechtswissenschaften (ineffektiver Jugendschutz, Aufsichtspflicht der Eltern) - liegt es nahe, sich die Cultural Studies als theoretischen Zugang heranzuziehen. Denn die Cultural Studies wehren sich gegen eine klare inhaltliche Bestimmung ihrer Forschungs- und Analyseansätze und agieren stark inter- und transdisziplinär [10].
Zu Beginn der Cultural Studies war man stark darauf bedacht, als unspezifizierbar zu gelten, als eine Theorie, die aufgrund ihrer Offenheit immer und überall zum Einsatz kommen kann. Mittlerweile haben sie aber eine klare Linie entwickelt, die einen festen Kern hat. Es geht grundlegend um die kulturellen Distinktionen und Bedeutungssysteme aus dem Blickwinkel der Akteure oder auch der Struktur (vgl. Renger 2003: 512). Auch in Bezug auf die verwendete Methode dieser Arbeit empfehlen sich die Cultural Studies, da dort die qualitative Methode der Gruppendiskussionen vor allem auf den Gebieten der Jugend-, Frauen- und Medienforschung zum Einsatz kommen (vgl. Pfaff 2006: 1). Auch Renger verweist darauf, dass vor allem interpretative Verfahren als Methode in den Cultural Studies Anwendung finden (vgl. Renger 2003: 514).
Wie der Name schon vermuten lässt, ist das zentrale Forschungsobjekt der Cultural Studies die Kultur. Kultur einerseits als „whole way of life“, also als Lebensweise (Machstrukturen, Ideen, Verhalten, Sprachen, Institutionen, Gewohnheit uvm.) und andererseits ein weites Feld kultureller Praxis (Kunst jeder Art wie beispielsweise Schriftstellerei, Malerei, Architektur usw.). Kultur ist definiert als sozialer Prozess, der immerzu stattfindet und die kulturelle Produktion, Zirkulation und Konsumation beschreibt (vgl. Renger 2003: 514). Alltagskultur steht also keineswegs im Gegensatz zum Begriff der Kultur, die oft als „elitäre Kultur“ (miß)verstanden wird (vgl. Jele 1999: 8). Im nachfolgenden Kapitel 24 „Die euphorischen Medienpromotoren“, wird darauf hingewiesen, dass es einzige Ansätze der Cultural Studies gibt, die Populärkultur als etwas Positives sehen.
4.1 Inhaltliche Definition der Cultural Studies
Lawrence Grossberg spricht von den Cultural Studies als Projekt, denn der Ansatz des Forschungsprozesses muss ständig neu definiert werden, je nach dem, welcher Kontext berücksichtigt werden soll. Grossberg (1994) definiert dieses Projekt mit fünf Schlagworten, Tony Benett (1998) nennt sechs. Beide Entwürfe zusammengefasst ergeben sieben inhaltliche Merkmale der Cultural Studies (vgl. Renger 2003: 513f):
1. Radikale Kontextualität: Kein kulturelles Produkt oder Praxis kann ohne den kontextuellen Zusammenhang (sozial, politisch, historisch usw.) erfassbar sein. Die Berücksichtigung des Kontextes kann eng (sexueller Missbrauch im Internet) oder weit gefasst sein (Gefahren im Internet für Minderjährige).
2. Theorieverständnis: Durch die radikale Kontextualität bleiben die Cultural Studies immer kontextbezogen und versuchen, diesen Kontext besser verstehbar zu machen.
3. Politischer Charakter: Cultural Studies haben also ein interventionistisches Moment, da nicht zweckfreie, wissenschaftliche Forschung gefragt ist, sondern der Gewinn von Wissen, der aktuelle soziokulturelle Probleme lösen kann. Es geht also um praktische Relevanz im Verwertungszusammenhang.
4. Interdisziplinarität: Kultur kann nicht innerhalb einer einzigen Forschungsrichtung oder Theorie bearbeitet werden, da sie immer darüber hinaus reicht.
5. Macht: Die meisten Ansätze der Cultural Studies drehen sich auch rund um den Aspekt der Macht. Bestimmte Formen von Kultur sind in ihrer Organisation und Ausführung mit Macht verbunden, wie beispielsweise das kulturell konstruierte Gendersystem, soziale Klassenstrukturen oder rassistische Machstrukturen.
6. Kultur als Institution: Die Kultur selbst ist eine Institution, die nicht nur aus Texten [11] , ihren Bedeutungen und den institutionellen Rahmen besteht, sondern selbst an der Verbreitung und Wirkung von sozial-semiotischen und -materiellen Beziehungen beteiligt ist.
7. Selbstreflexion: Der Ansatz der Cultural Studies unterwirft sich ständiger Selbstreflexion, sowohl in der wissenschaftlichen Analyse, als auch in der Schreibpraxis.
(Vgl. Renger 2003: 513f)
4.2 Cultural Studies und Medien
Die Cultural Studies betrachten die Medienrezeption als Element, das den Alltag mitbestimmt und umgekehrt, da die Medien in den Alltag eingebettet sind. Die Medienrezeption kann nicht kontextlos betrachtet werden, als reine Interaktion zwischen Rezipient und Medieninhalt (vgl. Bilandžić 2003: 355). Für die Medienrezeption gelten nicht allein äußere Gründe als Auslöser für einen bestimmten Medienkonsum, wie beispielsweise beim Uses-and-Gratifications- Approach, bei der die Bedürfnisbefriedigung durch bestimmte Erwartungen an die Medieninhalte geknüpft ist (vgl. Bilandžić 2003: 346f). Das Vergnügen und Unterhaltungserleben der Medienrezeption ist ein zentraler Bestandteil der Cultural Studies. Der Medienrezipient ist gleichberechtigter Akteur neben dem medialen Text und dessen Produzenten, denn der Text muss erst vom Rezipient interpretiert werden, bevor irgendeine Wirkung geschehen kann.
„der emittierte Text ist nur ein Vorprodukt, eine Art aktualisierte Konserve, und erst der >gelesene< und wie auch immer verstandene Text ist in der Rezipientenforschung von Bedeutung, denn darin konstituiert er sich erst als soziale Tatsache“ (Krotz 1995: 249, zit. nach Bilandžić 2003: 355).
Stuart Hall unterscheidet an dieser Stelle drei Lesearten: Die dominante Leseart entspricht genau der beabsichtigten Interpretation des Textproduzenten, die verhandelte Leseart erkennt die Interpretationsabsicht des Produzenten an, bringt aber auch oppositionelle Elemente ein und schließlich die oppositionelle Leseart, bei der der Medienrezipient genau das Gegenteil herausliest. John Fiske (1987) betont insbesondere die oppositionelle Leseart, da diese es dem Medienrezipienten überlässt, eigene Bedeutungen zu konstruieren. Er erfährt so das Vergnügen, „hegemonialen Diskursen“ zu entkommen und eigene Diskurse zu implementieren und zu verbreiten [12].
Fiske greift zur Erklärung von Vergnügen auf das Konzept von Roland Barthes [13] zurück: dieser unterscheidet zwischen „plaisir“ (Vergnügen) und „jouissance“ (Genießen). Plaisir entspricht dem Vergnügen, sich intellektuell mit Texten auseinanderzusetzen, da die geläufigen Muster und Bedeutungen bekannt sind bzw. erkannt werden. Man vergnügt sich also an der Machart des Textes. Jouissance ist die unmittelbare Lust am Text, ohne die kulturellen Voraussetzungen zu kennen. Als Beispiel nennt Barthes Emotionen wie Angst, Wut und Schmerz (vgl. Bilandžić 2003: 353-356).
Als weiterer Forschungsansatz kann hier auch noch die strukturanalytische Rezeptionsforschung erwähnt werden, die neben der konstruktivistischen Ausrichtung auch kulturgebunden ist. Der Rezipient, der ein individuelles Vorwissen und Erfahrungen hat, konsumiert in einer gewissen sozialen Situation Medien. Hierbei wird vor allem hinterfragt, welche Aspekte des Alltags in die Rezeption einfließen (z.B. in Bezug auf die aktuelle Lebenssituation) und welche Aspekte der Medienrezeption in den Alltag zurückfließen (z.B. mediale Konfliktlösungsmuster in den Alltag implementiert). In dieser Forschungsausrichtung wird auch untersucht, inwiefern die Mediennutzung zur Alltagsbewältigung und Identitätsbildung eingesetzt wird und steht so im Schnittpunkt der Rezeption- und Wirkungsforschung (vgl. Bilandžić 2003: 356), denn die Jugendlichen haben mit dem Internet ein sehr attraktives Medium gefunden, mit dem sie sich ausdrücken können, sei es nun bildlich, audiovisuell oder textlich (vgl. With 2007: 3).
5 Normative Positionen im öffentliche Mediendiskurs
Im öffentlichen Mediendiskurs dominieren - den Medienumgang der Heranwachsenden betreffend - idealtypisch betrachtet, drei normative Positionen: Die Kulturpessimisten, die kritischen Medienoptimisten und die euphorischen Medienpromotoren. Diese werden nachfolgend thematisch umrissen und durch einige ihrer Vertreter ergänzt.
5.1 Die Kulturpessimisten
Die Kulturpessimisten warnen hauptsächlich vor den negativen Folgen und Einflüssen der Medien auf jeden Einzelnen [14]. Die Medien werden mit Drogen verglichen, die süchtig machen, die die Wirklichkeit ersetzen und so auch die Kindheit verkürzen oder gar ganz verschwinden lassen. Außerdem begünstigen die Medien eine Spaßgesellschaft, in der sich alles nur um Unterhaltung dreht. Medien werden demzufolge in erster Linie als Risikofaktoren und Belastungen dargestellt. Laut Neil Postman bzw. Marie Winn aus den USA und Werner Glogauer aus Deutschland, verhindern die Medien die Entwicklung einer intakten Identität und nehmen den Heranwachsenden die Möglichkeit, authentische Kommunikation gestalten zu können. Da die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen noch nicht gefestigt ist, werden sie als besonders gefährdet eingestuft. Selbstverständlich erhält diese Ansicht immer dann Aufwind, wenn schreckliche Einzelfälle geschehen, wie beispielsweise der Amoklauf in Littleton/ USA, bei dem gewaltverherrlichende Computerspiele als Schlüsselreiz geahndet wurden (vgl. Süss 2004: 15).
5.2 Die kritischen Medienoptimisten
Diese Vertreter verstehen die Medien nicht als Störfaktor der Kultur, sondern als Teil dieser. Für sie sind die Medien unauflöslich mit der alltäglichen Lebenswelt eines jeden Menschen verbunden. Der Umgang mit Medien wird hier zur Kulturtechnik erklärt, unter besonderer Beachtung der Medienkompetenz. Christian Doelker, Dieter Baake und Ingrid Paus- Hasebrink meinen, dass die Medien ein wichtiger Baustein der Identitätsfindung und -gestaltung sind. Denn die Medien sind nicht nur kommunikative Technologien, sondern Instrumente der Vergemeinschaftung. Die Medien unterstützen eine gesunde Entwicklung und haben vorwiegend positive Wirkungen, bzw. neutrale. Die Entwicklung von Medienkompetenz soll einen kritischen Umgang mit den Medien ermöglichen, auch die Medienindustrie wird dazu ermutigt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Strukturelle Zwänge werden in diesem Ansatz nicht beachtet (vgl. Süss 2004: 16).
5.3 Die euphorischen Medienpromotoren
Diese Perspektive bejubelt die Medien geradezu. Die Vertreter dieser Position sind vor allem Informatiker aus dem Bildungsbereich, Politiker und Geschäftsleute aus der Computerbranche. Für sie sind die neuen Medien der Schlüssel zu einer gleichberechtigten und wohlhabenden Gesellschaft, in der Chancengleichheit herrscht. Ohne die Neuen Medien ist die Informationsflut gar nicht zu bewältigen. Die Autoren glauben, dass das Lernen mit Medien am erfolgreichsten ist und so wurden seit den 70ern jedes Jahrzehnt einem anderen Medium eine neue Revolution im Bildungssektor zugeschrieben: erst den Sprachlabors, in den 80ern galt das Fernsehen als das ultimative Bildungsmedium und ab den 90ern folgten Computer und Internet als Medien der Wissensproduktion und des Wissenstransfers. Einige Ansätze der Cultural Studies gleichen dieser Perspektive. Hier werden Medien als Populärkultur definiert, die ohne negative Einflüsse oder Folgen auf die Gesellschaft wirken und von dieser genutzt werden. Die Mediennutzer sind selbstständig und kreativ, sie können eine Botschaft auch genau umgekehrt, also oppositionell interpretieren und so ihre Mythen in den Medien durchleben. Die Medienangebote werden als eine Art „Steinbruch“ dargestellt, aus dem sich jeder alles herausbrechen kann, um individuelle Sinn- und Bedeutungsmuster zu generieren (vgl. Süss 2004: 16f).
Die empirische Medienforschung kann keiner der drei normativen Positionen eine völlige Absage oder Bestätigung erteilen. Im Endeffekt können alle drei Perspektiven zum Tragen kommen: Medien können Identitätsentwicklungen und Kommunikationsmuster unterstützen und erweitern, sie können aber auch das Gegenteil erreichen. Welche Entwicklung in der Mediensozialisation ihren Lauf nimmt, hängt vor allem davon ab, WIE die Medien verwendet und diese Erfahrungen verarbeitet werden. Am ehesten kann man die Ansicht der kritischen Medienoptimisten empirisch unterstreichen, denn die Wirkungen auf den Medienrezipienten sind stark situationsabhängig. Dabei kann es durchaus zu Extremsituationen mit Negativerfahrungen kommen, die die Sicht der Kulturpessimisten unterstützt, es kann aber auch besonders gute Erfahrungen geben, die den euphorischen Medienpromotoren Recht geben (vgl. ebd. 2004: 17).
6 Vorstellungen von Kindheit: Neue Soziologie der Kindheit und Klassisches Stufenmodell der Entwicklungspsychologie
Hinter den gerade abgehandelten, normativen Positionen stehen verschiedene Vorstellungen von Kindheit. Die „Neue Soziologie der Kindheit“ aus England distanziert sich von dem klassischen Stufenmodell der Entwicklungspsychologie. Ersteres entstammt, wie der Name schon sagt, der Soziologie und letzteres der Psychologie. Die Kindheitssoziologen kritisieren, dass die Entwicklungspsychologie die Kinder als „unfertige Erwachsene“ betrachtet, denn für sie sind Kinder gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft, die eine eigene, vollwertige Rolle innehaben und auch so behandelt werden müssen. Hinter dem Stufenmodell steht laut ihnen ein Machtanspruch der Erwachsenen, der von einem einseitigen Normalitätskonzept ausgeht, welches eine konformistische Entwicklung eines jeden Kindes anstrebt. Deswegen kritisieren sie das klassische Stufenmodell als überholt, da in der heutigen postmodernen Gesellschaft ein Pluralismus herrscht, der mehrere differenzierte Entwicklungsverläufe hervorgebracht hat, die gleichberechtigt nebeneinander stehen.
6.1 Kulturpessimisten und Stufenmodell
Die Kulturpessimisten berufen sich stärker auf das Kindheitsmodell der Entwicklungspsychologie. Sie glauben, dass die Heranwachsenden vor bestimmten Medieneinflüssen geschützt werden müssen, da sie für diese noch nicht reif genug sind. Die psychosoziale Entwicklung des Kindes scheint gefährdet, wenn es zu früh mit bestimmen Medieneinflüssen konfrontiert werden würde. Die Kindheit wird also als eine Art Schonraum definiert, in dem gewisse Einflüsse nichts zu suchen haben. Diese Perspektive ist wohl auch der Grund dafür, warum viele Jugendschutzbestimmungen sehr eigenartig formuliert sind. Die Eltern sind demnach die ausführende Gewalt, die bestimmt, welche medialen Inhalte für ihre Kinder geeignet sind und welche nicht. Die Heranwachsenden selbst werden dazu nicht befragt, es findet dazu kein Dialog statt (vgl. Süss 2004: 17).
6.2 Kritische Medienoptimisten/euphorische Medienpromotoren und die Neue Soziologie der Kindheit
Kinder gelten in dieser Perspektive als eigenverantwortlich und können kompetent mit den Medien umgehen. Sie können die richtigen Medien für ihre individuellen Bedürfnisse auswählen und erhalten dadurch einen gleichberechtigten Status innerhalb der Gesellschaft. Die Kinder treten in Interaktion mit den Erwachsenen und können sich so den Medienkonsum aushandeln und auch besprechen. Hier verfügen nicht die Eltern über die Medienrezeption, sondern sie lassen sich unter Umständen auch von ihren Kindern überzeugen. Der selbstverantwortliche Umgang mit Medien soll den Kindern so früh wie möglich gewährt werden (vgl. Süss 2004: 18).
6.3 Konsequenzen der Kindheitstheorien für die normativen Positionen
Die Ansichten der Entwicklungspsychologie wiederum kann man dahingehend unterstützen, dass es unweigerlich eine gewisse Entwicklungsabfolge gibt, die genetisch vorbestimmt ist. Die Ontogenese [15] bestimmt durch Reifen und Lernen im Zeitverlauf gewisse physische und psychische Entwicklungen. Das Verstehen von Medienaussagen als kognitive Kompetenz ist an das Alter des Rezipienten gekoppelt. Dies konnte in vielen empirischen Studien belegt werden. Allerdings ist es auch so, dass nicht allein das Alter ausschlaggebend für die Medienkompetenz ist. Die soziale Schicht, das nahe Umfeld, gesellschaftliche Verhältnisse und zahllose andere situative Einflüsse überlagern und ergänzen den Entwicklungsablauf von Heranwachsenden. Insofern hat hier also die Neue Soziologie der Kindheit ihre Berechtigung:
„Die Position der Kindheitssoziologie lässt sich daher ebenfalls stützen, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass sich die gesellschaftlichen Milieus in den postmodernen Gesellschaften immer weiter ausdifferenzieren. Kind sein bedeutet also etwas anderes, je nach dem, in welchem Umfeld man aufwächst.“ (Süss 2004: 18)
Kinder aus wohlhabenden Familien lernen bestimmte Kompetenzen früher als Kinder aus der Unterschicht. Ob eine Kompetenz erworben wird hängt auch davon ab, ob sie in der Umgebung des Kindes funktional ist. Ein indisches Slumkind ohne Schulbildung wird kaum etwas mit der Medienkompetenz für die Internetnutzung anfangen können. Abseits dieser eher formalen Kriterien geht es auch darum, ob das Kind sich zutraut, diese Kompetenz zu erwerben oder eben nicht. Hier spielen Versagensängste eine große Rolle.
„Man muss daher der Kindheitssoziologie zustimmen, dass das Kindheitskonzept der Erwachsenen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden kann. Wenn Kinder als unmündige Personen betrachtet und behandelt werden, dann bleiben sie auch unmündig. Und umgekehrt kann ein Empowerment dazu führen, dass Kinder früh selbstständig und selbstverantwortlich handeln können, unter anderem im Bezug auf ihren Medienumgang.“ (Ebd. 2004: 18)
Man darf diese Abhandlung aber nicht so verstehen, dass die Entwicklungspsychologie und die Neue Soziologie der Kindheit gegeneinander antreten. Die heutige Entwicklungspsychologie hat längst erkannt, wie wichtig die Umwelteinflüsse sind und hat neue Ansätze entwickelt, die ökologische und systemische Einflussgrößen aufgreifen (ebd. 2004: 18).
7 Das Jugendalter Adolescence
„Jugend und Adoleszenz (lat. adolescere: heranwachsen) werden synonym für den Lebensabschnitt zwischen dem Ende der Kindheit und dem Beginn des Erwachsenenstatus verwendet, in der Regel die zweite Lebensdekade. Die Adoleszenz beginnt mit dem Einsetzen der Pubertät und endet, wenn die Kompetenzen zur Ausgestaltung der Aufgaben des Erwachsenen in den Bereichen persönliche Leistungsbereitschaft, Beruf, Partnerschaft, Konsum und Freizeit sowie politische Beteiligung vorhanden sind.“ (Grob 2007: 187)
Im Jugendalter finden zahlreiche Übergänge von der Kindheit zum Erwachsenen statt. Privilegien des Kindesalters müssen aufgegeben und neuen Kompetenzen des Erwachsenenalters erworben werden. Die Idee des Jugendalters als eigenständige Lebensphase kam erst im 17. Jahrhundert zum Vorschein, Pädagogen forderten fortan einen kindgemäßen Unterricht [16]. Ab Ende des 19. Jahrhunderts kam es in der westlichen Welt zu veränderten Arbeits-, Produktions- und Sozialstrukturen, die Ausbildung der Jugendlichen wurde vertieft und nahm damit mehr Zeit in Anspruch (vgl. ebd. 2007: 187). Hurrelmann et al. spricht in der Jugend-Shell- Studie 2006 sogar von einer künstlichen Ausdehnung der Lebensphase des Jugendalters, da in der Mitte der 80er Jahre in Deutschland die Zahl der Arbeitsplätze stark abnehmend war und die Jugendlichen nun länger ausgebildet bzw. fortgebildet wurden. Außerdem bedarf es immer mehr hochausgebildeten Nachwuchs, der mindestens Matura benötigt oder ein Hochschulstudium, um in den Arbeitsmarkt eintreten und einen gewissen Wohlstand erwirtschaften zu können.
Im 21. Jahrhundert dauert die Lebensphase des Jugendalters zwischen zehn und 20 Jahren und kann so als eigener Lebensabschnitt definiert werden (vgl. Hurrelmann et al. 2006: 32f). Die Heranwachsenden befinden sich also immer länger in einem Moratorium, dass sie optimal auf das Erwachsenenleben vorbereiten soll. Die Jugendlichen werden in der heutigen Zeit aber nicht mehr so stark angeleitet und kontrolliert wie früher, sondern müssen immer mehr alleine bewältigen. Dieser Umstand bringt ihnen zwar viel Freiheit - gleichzeitig verlieren sie jedoch an Orientierungspunkten und haben schneller Angst, bzw. isolieren sich (vgl. Süss 2003: 28). Werte, für die ihre Eltern noch kämpfen mussten, sind für die heutigen Jugendlichen selbstverständlich, sie verfügen über erheblich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten als die vorherigen Generationen.
Doch Werte wie soziale Sicherheit und Wohlstand werden besonders stark angestrebt und erscheinen den Jugendlichen als gefährdet (vgl. Koppers 2008: 22). In den letzten 150 Jahren haben sich die Sozialisationsbedingungen der Jugendlichen stark verändert, ausgelöst durch zahlreiche Demokratisierungsbewegungen in den westlichen Industriestaaten. Die Heranwachsenden bauen die zentralen Beziehungen nicht mehr nur im familiären Kontext auf, sondern auch außerfamiliär: in der Schule, im Freundeskreis, in der Arbeit, im Sportverein etc. Die Handlungsabläufe zwischen Jugendlichen und ihren Eltern verlaufen immer mehr getrennt voneinander (vgl. Grob 2007: 187).
Das Einsetzen der Pubertät läutet das Ende der Kindheit ein - das Jugendalter beginnt. Die ersten biophysiologischen Veränderungen der Pubertät setzen schon mitten in der Kindheit ein, sind von außen aber noch nicht sichtbar. Die Pubertät bezeichnet das Eintreten der Geschlechtsreife, die Mädchen bekommen ihre Menstruation (Menarche), die Burschen den ersten richtigen Samenerguss (Pollution), ihre sekundären Geschlechtsmerkmale - wie beispielsweise Brustwachstum, Schambehaarung und Bartwuchs – entwickeln sich. Die Mädchen sind den Burschen in ihrer Entwicklung um zwei Jahre voraus, sie treten früher in die Pubertät ein (vgl. ebd. 2007: 187f). Heute ist es bereits so, dass die Pubertät bei den Mädchen bereits in einem Alter von zehn bis 11 Jahren beginnt (mit dem Einsetzen der Menarche) (vgl. Internet 20: 2008). Die körperlichen Veränderungen führen bei den Heranwachsenden zu einem neuen Körperempfinden, sie entwickeln Schamgefühle und empfinden sich als unabhängiger, schlagen sich mit Selbstzweifel herum und erfahren diese Veränderungen teilweise auch durch Gewalt, Aggression, Delinquenz (übertreten rechtlicher Grenzen) und Devianz (Überschreitung sozialer Grenzen). Sie ziehen sich vermehrt von der Familie zurück, suchen mehr Kontakt zu den Gleichaltrigen und flüchten oftmals in die Einsamkeit. Um dies psychisch bewältigen zu können, haben nun auch die Eltern, Lehrer, Geschwister und Freunde eine andere Außenwahrnehmung des Heranwachsenden: das Kind ist nicht länger Kind, sondern wird als autonomer und eigenständig handelnd betrachtet. Dies schließt die Pflicht für die Jugendlichen mit ein, die auferlegten Aufgaben der sozialen Umgebung zu lösen. Wann genau das Jugendalter als abgeschlossen gilt, ist nicht klar definiert. Fragen der Identitätsfindung, kompetente Ausgestaltung der Rolle im Beruf, in der partnerschaftlichen Beziehung und Familie, als Konsument und Bürger müssen beantwortet werden (vgl. Grob 2007: 188).
7.1 Entwicklungsaufgaben
In der Sozialisationsforschung sind die sogenannten „Entwicklungsaufgaben“ gewisse soziale Ziele, die in einem gesellschaftlichen Kontext bewältigt werden müssen. Das Bewältigen neuer Entwicklungsaufgaben kann durch die körperliche Reifung, eigener Wertsetzungen oder von außen gesetzten Normen eingeleitet werden. Das Lösen einer Entwicklungsaufgabe beeinflusst den Lebenslauf des Sozialisanden wesentlich, es geschehen strukturelle Veränderungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
[Abb. in dieser Vorschau nicht enthalten] [17]
Abbildung 3: Entwicklungsaufgaben in Kindheit und Jugendalter nach Oerter/Dreher 2002. Quelle: Süss 2004: 34
Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, ist die Identitätsfindung eine Entwicklungsaufgabe, die besonders im Jugendalter geschieht und bewältigt werden muss. Erik H. Erikson hat bereits 1959 ein Entwicklungspsychologisches Stufenmodell erstellt, das auch den Einwänden der Kindheitssoziologen standhält. Erikson betont aber, dass die „Entwicklung eines kognitiven Konstruktes einer gefestigten Identität“ ein Leben lang andauert und sowohl entwicklungs- als auch sozialpsychologischen Einflussfaktoren unterliegt.
Identität wird beschrieben als „bewusstes Gefühl der individuellen Einmaligkeit“ und auch als Solidarität mit Gruppen oder Gemeinschaften. Das bedeutet, es gibt eine soziale und eine persönliche Identität. (vgl. Süss 2004: 34). Bei Erikson ist jeder Stufenübergang eine Krise, die es zu überwinden gilt - gelingt dies nicht, ist die weitere psychosoziale Entwicklung unter Umständen gefährdet [18]:
[Abb. in dieser Vorschau nicht enthalten]
Abbildung 4: Entwicklungsstufen und -aufgaben nach Erikson 1959. Quelle: Süss 2004: 35
7.2 Zentrale Themen im Jugendalter
Die wichtigsten Entwicklungsabläufe im Jugendalter sind: das Loslösen von der Familie, die intensiveren Beziehungen zu Altersgenossen, der Schulalltag, Freizeitaktivitäten, Werthaltungen und das Einstimmen auf das spätere Berufsleben. Grob und Jaschinski haben 2003 folgende Punkte formuliert, die die Heranwachsenden prägen: Familie, Beziehung zu Gleichaltrigen, Schule und die Orientierung durch das Freizeitleben.
7.2.1 Familie
Innerhalb der Familie erlernen die Heranwachsenden Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, sich von der Familie loszulösen, wie soziale Beziehungen funktionieren, was sie ausmachen und Konflikte zu lösen. Die emotionale Unabhängigkeit von den Eltern zu erreichen fällt den Jugendlichen oftmals schwer, ebenso wie den Eltern selbst. Um sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln zu können, kommt es in der Phase des Jugendalters vermehrt zu Konflikten und Auseinandersetzungen mit den Eltern. Die Heranwachsenden identifizieren sich plötzlich nicht mehr so stark mit den Eltern und entwickeln zunehmend andere Werte und Einstellungen. Haben die Jugendlichen eine zu enge Bindung zu ihren Eltern, erschwert dies die Loslösung. Vor allem Mädchen mit zu enger Bindung zu den Eltern entwickeln eine schwächere Selbstständigkeit. Durch den Loslösungsprozess vom Elternhaus verbringen die Jugendlichen auch weniger Zeit mit den Eltern und sind öfters unterwegs. Allerdings steht meistens die Mutter im engeren Kontakt zum Kind, weil sie mehr Zeit mit ihm verbringt und meistens den Großteil der Erziehungsarbeit leistet. Durch diese intensivere Beziehung zum Heranwachsenden wünschen sie sich auch mehr Informationen über die Aktivitäten ihres Schützlings. Dieser Wunsch kann natürlich auslösen, dass sich die Jugendlichen kontrolliert fühlen und Auskünfte verweigern, was unweigerlich zu Konflikten führt. Da die Pubertierenden aber älter werden und sich im Laufe der Zeit klarer ausdrücken können, lösen sich die Konflikte in der Mehrheit positiv. Die schwierige Balance zwischen Autonomiegewährung und elterlicher Kontrolle ist nicht leicht zu halten. Hier ist die maßgebliche Basis Vertrauen zwischen Kind und Eltern. Das Kind sollte von sich aus zu den Eltern gehen und aus seinem Alltag erzählen, dann braucht es nicht viel Kontrolle. Baumrind schuf 1991 das Modell der vier elterlichen Erziehungsstile, die sich zwischen selbständigem Handeln, Kommunikation, Konflikt und Harmonie abspielen. Die wesentlichen Begriffe dazu sind:
1. Herausforderung: Verlangen und erwarten verantwortungsvollen Verhaltens vom Heranwachsenden.
2. Zuwendung: Das Ausmaß der elterlichen Unterstützung, Eingehens und Akzeptanz auf die Bedürfnisse der Heranwachsenden (vgl. Grob 2007: 188f).
[Abb. in dieser Vorschau nicht enthalten]
Abbildung 5: Erziehungsstile nach Baumrind 1991. Quelle: Grob 2007: 189
In autoritativen Familien bekommen Jugendliche viel Zuwendung und werden aufgefordert, verantwortungsvoll und eigenständig zu handeln. Sie haben mehr psychosoziale Fähigkeiten, als Kinder, die anderen Erziehungsstilen unterliegen. Man schreibt den autoritativ erzogenen Kindern mehr Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein, Kreativität, Wissbegierigkeit, soziale Kompetenzen und mehr Erfolg in der Schulausbildung zu. Diese Vorteile der autoritativen Erziehung erscheinen in verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten.
In autoritär erziehenden Familien erfährt der Jugendliche kaum eigene Herausforderungen, aber genügend Zuwendung. Durch die emotionale Abhängigkeit bleibt er eher passiv und ist sozial wenig kompetent, schlägt sich mit Selbstzweifeln herum und ist nicht sehr wissbegierig.
Heranwachsende, die permissiv erzogen werden, müssen im erhöhten Maße eigenständig handeln, bekommen aber im Vergleich dazu zu wenig Zuwendung. Diese sind dann nicht etwa verantwortungsbewusster, sondern das Gegenteil tritt ein - die Jugendlichen sind unreifer, können sich nicht durchsetzen und verhalten sich gegenüber Gleichaltrigen konformer.
Kinder mit indifferent erziehenden Eltern bekommen wenig Zuwendung und werden kaum von den Eltern vor Herausforderungen gestellt. Sie sind häufig impulsiv, delinquent und experimentieren oftmals schon sehr früh mit Drogen, Alkohol und auch mit ihrem Sexualverhalten.
Weibliche Heranwachsende leiden vor allem unter fehlender Zuwendung, Burschen unter fehlenden Herausforderungen (vgl. Grob 2007: 190). Der Erziehungsstil innerhalb der Familien hat sich im Laufe der Jahre verändert, viele Familien behandeln ihre Kinder nun eher wie gleichberechtigte Partner und lassen sie vieles mitbestimmen. Außerdem gleichen sich die Erwachsenen immer mehr den Jugendlichen an, wollen jung aussehen, jung denken und ebnen so das Generationsgefälle ein. Dadurch verschwinden das Anerkennen der elterlichen Autorität und sicherlich oftmals auch der Respekts vor den Eltern. Immer öfter herrschen liberale und offene Erziehungsstile vor, die aber nicht nur positiv zu bewerten sind, sondern oftmals permissiver, inkonsequenter und resignierter sind als beispielsweise der autoritäre Erziehungsstil. Die Kinder machen was sie wollen und die Eltern greifen nicht ein - die Machtverhältnisse verschieben sich unter Umständen in die falsche Richtung. Durch die liberalen Erziehungsstile vereinfacht sich das Erziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern nicht etwa, sondern wird vielschichtiger und komplexer. Hinzu kommt auch noch, dass sich die Kinder immer früher und stärker von den Eltern abnabeln und sich auch die Erwachsenen selbst überfordert fühlen und daher bei Widerstand von Seiten des Kindes schnell aufgeben, um Konflikte von vornherein zu vermeiden (vgl. Koppers 2008: 24).
7.2.2 Beziehungen zu Gleichaltrigen (Peers)
Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, verbringen die Jugendlichen immer mehr Zeit mit ihren gleichaltrigen Freunden oder Gruppen. Neben der Familie sind die Peer Groups der wichtigste Sozialisationskontext in diesem Lebensabschnitt. Er werden neue und intensivere Beziehungen zu den Peers aufgebaut, auch zunehmende Intimität und Sexualität zwischen den Gleichaltrigen finden eingang. Innerhalb der Peer Groups werden viele Themen und Probleme besprochen und sie begleiten sich gegenseitig im Übergang von der Familie zur eigenen Partnerschaft. Zwischen den Jugendlichen gibt es keine Hierarchie im familiären Sinn, man ist sich gleich, man akzeptiert aber auch Andersartigkeit. Gleichheit meint in diesem Fall, dass man gerecht zueinander ist und sich und seine Meinung und Wünsche durchsetzen kann. Die Selbstdarstellung spielt in den Peer Groups eine große Rolle, ebenso wie die Verwirklichung eigener Ziele. Die Gleichaltrigen unterliegen innerhalb der Gruppe zwar keinen äußeren Normen mehr, dennoch haben sie ein eigenes Regelsystem, dass die internen Normen festlegt. Die Peer Groups haben fünf wichtige Funktionen für die Entwicklung der Jugendlichen:
1. Emotionale Geborgenheit: Vermeidung und Überwindung von Einsamkeit.
2. Identifikation: Lebensstile werden sichtbar, Diskussionen werden geübt, Perspektiven übernommen und Strategien der Konfliktlösung erfahren.
3. Ablösung: Das Loslösen von den Eltern wird erleichtert.
4. Eigene Ziele: Die internen Normen der Peer Group bieten Orientierung bei der Auswahl der eigenen Ziele.
5. Beziehungen: Durch die Peer Groups erfahren die Heranwachsenden, wie Beziehungen funktionieren. Sie lernen sich in unterschiedlichen Ausmaß zu öffnen und proben Zuverlässigkeit (vgl. Grob 2007: 190f).
7.2.3 Schule und Berufsvorbereitung
In der Schule bzw. im Lehrberuf werden die Jugendlichen auf das spätere Berufsleben vorbereitet und mit Allgemeinwissen ausgestattet. Sie lernen so ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit und Motivation kennen. Die Leistungsmotivation nimmt häufig mit zunehmendem Alter ab, da sich das Kontrollsystem der Schule mit der wachsenden Autonomie der Heranwachsenden überschneidet. Jugendliche aus gut situierten Familien erzielen meist bessere und höhere Bildungsabschlüsse. Dies geht oftmals einher mit dem autoritativen Erziehungsstil - die Eltern interessieren sich für den Schulalltag und haben insgesamt eine positive Einstellung dazu (vgl. Grob 2007: 191).
7.2.4 Orientierung durch das Freizeitleben
Freizeitaktivitäten werden meistens von den Jugendlichen selbst gewählt und sind intrinsisch motiviert. Hier kommen sie in Kontakt mit anderen Heranwachsenden sowie mit fremden Erwachsenen. Durch die selbstbestimmte Selektion der Freizeitaktivitäten ist die Stimmung der Adoleszenten besser als beispielsweise in der Schule, dennoch ist die Freizeit nicht gleich freie Zeit, sondern die meisten Aktivitäten ziehen fixe Termine nach sich. Leider sind viele Hobbies sehr kostspielig, die Jugendlichen aus sozial schwächeren Milieus nehmen so oft Außenseiterpositionen ein, ihr sozialer Status wird geringer bewertet. Viele Jugendliche, die der elterlichen Kontrolle entfliehen wollen und/oder nicht soviel Geld besitzen, treffen sich deswegen oft in Einkaufszentren, Parks oder auch Freibädern.
Die sozialen Kompetenzen werden nicht nur durch fremde Umgebungen und Menschen gefördert, sondern die Hobbies tragen maßgeblich zur Bildung von Freundschaften und ganzen Cliquen bei. Auch der Kontakt zwischen Eltern und Kindern kann durch die Freizeitaktivitäten unterstützt bzw. verbessert werden, da die Eltern zu Turnieren oder Vorführungen mitfahren und so immer mehr Interesse für das Tun ihrer Kinder entwickeln, bzw. die eigenständig erbrachten Leistungen der Heranwachsenden erfahren und wertschätzen können. Erleben sich die Jugendlichen innerhalb ihrer Hobbies als kompetent, kann dies zu mehr Selbstwertgefühl führen und auf das spätere Konkurrenzdenken im Berufsleben vorbereiten (vgl. Grob 2007: 192).
7.3 Jugendliche Wertetypen in Österreich
Grob meint, dass die Werte im 21. Jahrhundert unübersichtlicher sind als früher. Das liegt an den komplexen und teilweise paradoxen, gesellschaftlichen Anforderungen, die an die Jugendlichen gestellt werden. Die Globalisierung bringt nicht nur eine Welt umfassende, kapitalistische Wirtschaft, sondern auch ein vielfältiges Wertesystem mit sich. Jugendliche suchen im Allgemeinen nach pragmatischen Werten, die ihnen helfen, sich im Alltag zu orientieren und Probleme zu lösen (vgl. Grob 2007: 192f). Die österreichische Jugend-Wertestudie 2006/07 befragte im Jahr 2006 1.231 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. Die Studie definierte sechs verschiedene Wertetypen. Diese positionieren sich rund um folgende vier Wertedimensionen:
1. Authentischer Pragmatismus: Das bürgerliche Lebensglück ist erstrebenswert. Durch vernünftige und authentische Lebensweise schafft man sich ein schönes Zuhause, hat einen sicheren Arbeitsplatz und führt eine glückliche Partnerschaft. Gründlichkeit, Selbstbeherrschung und Selbstbestimmung überwiegen, um ein stabiles Lebensumfeld errichten zu können.
2. Freizeitorientierter Hedonismus: Diese Wertedimension beschreibt das genussorientierte Leben, die individuelle Selbstentfaltung steht im Vordergrund. Die Genusslust wird vor allem im Freizeitbereich ausgelebt.
3. Berufs- und leistungsbezogener Materialismus: Durch Leistung und Erfolg im zukünftigen Berufsleben soll ein gewisser gesellschaftlicher Status erreicht werden, um Materialismus zu ermöglichen.
4. Prosozialer Idealismus: Nicht-Materialismus und prosoziale Werte vereinen sich hier: Die Familie ist wichtig, die Lebensweise natürlich, man akzeptiert und hilft anderen Menschen, trotzdem wird die persönliche Entfaltung bedacht (vgl. Friesl et al. 2008: 262f).
7.3.1 Die unentschiedenen Optimisten
Diese Gruppe ist die Größte mit 28 Prozent, vor allem 16-jährige Österreicher finden sich hier. Alle vier Wertedimensionen sind gleichermaßen positiv bewertet, es gibt keine Hierarchie. Der einzig nennenswerte Unterschied liegt darin, dass muslimische Jugendliche weniger optimistisch zu sein scheinen als nicht-muslimische. Für die unentschiedenen Optimisten steht das eigene Wohl im Vordergrund, auch Fremdenfeindlichkeit ist bei diesem Wertetypus am stärksten ausgeprägt. Sie empfinden sich als gut verortet in der Gesellschaft und fühlen sich nicht fremdbestimmt, sondern ernst genommen. Sie glauben fest daran, ihre eigenen Ziele erreichen zu können. Mit dem Beruf wollen sie ihre Existenz sichern, aber gleichzeitig auch Sinnvolles tun. Politisch sind sie eher desinteressiert, Demokratie ist ihnen aber wichtig. Die weiblichen Optimistinnen lehnen traditionelle Rollenverteilungen ab, die männlichen können neben der traditionellen auch der emanzipatorischen Rollenverteilung etwas abgewinnen.
7.3.2 Die egozentrischen Hedonisten
12 Prozent der österreichischen Jugendlichen gehören dieser Gruppe an und diese ist zugleich auch die jüngste der Gruppen: der Modalwert liegt bei 15 Jahren. Die egozentrischen Hedonisten interessieren sich vorwiegend für ihre Freizeit, Lebenslust und -genuss. Soziale Einstellungen und Orientierungen werden abgelehnt, auch erfolgsorientierte Werte sind eher unwichtig. In dieser Gruppe dominieren klar die Burschen, nur ein Drittel sind Mädchen. Muslimische Jugendliche sind weniger oft vertreten als nicht-muslimische. Solidarität und Zukunftsdenken sind gering ausgeprägt, sie sehen der Zukunft offen entgegen und betreiben ihre Selbstverwirklichung vorwiegend in der Freizeit - dies sind ganz klar Alterseffekte. Die männlichen Hedonisten lehnen das egalitäre Rollenbild am stärksten ab.
7.3.3 Die resignierten Skeptiker
Diese Gruppe lehnt fast alle Wertemuster stark ab, vor allem muslimische Jugendliche sind hier zu finden - dreimal soviele wie nicht-muslimische Heranwachsende, insgesamt sind es zehn Prozent der Befragten. Sie zeichnen sich durch Resignation und Skepsis aus, fühlen sich nicht ernst genommen, sehen sich als fremdbestimmt und wünschen sich paradoxerweise einen Neo-Autoritarismus und einen „starken Mann“ in der Politik. Die Zukunft birgt für sie größtenteils Unsicherheit - auch deswegen wollen sie jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Dieser Unsicherheit rührt daher, dass sie den Arbeits- und Ausbildungsmarkt als unzureichend empfinden. Die resignierten Skeptiker legen kaum Wert auf Selbstverwirklichung und all diese Faktoren weisen darauf hin, dass die Jugendlichen aus benachteiligten sozioökonomischen Strukturen entstammen. Sowohl Mädchen als auch Burschen vertreten die traditionelle Rollenverteilung und lehnen emanzipatorische Strömungen ab.
7.3.4 Die freizeitorientierten Hedonisten
Die Gruppe, die 13 Prozent der Befragten umfasst, lehnen Leistungsorientierung und Materialismus stark ab und bewerten genussorientierte Wertemuster sehr hoch. Die freizeitorientierten Hedonisten bestehen größtenteils aus den 17-jährigen und sehen den prosozialen Idealismus positiver als die egozentrierten Hedonisten, d.h. sie übernehmen gern Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Sie lehnen es am stärksten von allen Gruppen ab, dass sie fremdbestimmt werden und streben vor allem nach Unbeschwertheit. Die Selbstverwirklichung findet ebenfalls am stärksten in der Freizeit statt, politisches Interesse ist kaum vorhanden. Die Zukunft wird positiv bewertet, man steht ihr offen gegenüber. Diese Gruppe ist auch weitaus solidarischer als die Egozentriker, trotzdem steht das eigene Lebensglück klar im Vordergrund. Autoritäre Werte lehnen sie ab, im gesellschaftspolitischen Sinn ist diese Gruppe eher unauffällig.
7.3.5 Die leistungsorientierten Idealisten
16 Prozent der österreichischen Jugendlichen gehören dieser Gruppe an, sowohl Burschen als auch Mädchen. Sie sind auf der einen Seite erfolgs- und leistungsorientiert, auf der anderen Seite streben sie nach sozialer Verantwortung und lehnen den authentischen Pragmatismus stark ab. Der prosoziale Idealismus ist am wichtigsten für sie. Viele Mitglieder dieser Gruppe sind bereits über 19 Jahre alt – sie streben jedoch nicht nach Beruf, Familie und Partnerschaft, sondern geben ihrer eigenen Entwicklung den größten Spielraum. Die leistungsorientierten Idealisten fühlen sich ernst genommen von der Gesellschaft. Obwohl sie erfolgreich sein wollen, haben sie keine fixen Pläne für die Zukunft. Sie sind eher politisch interessiert und bewerten die Regierung durchaus positiv und lehnen den „starken Mann“ in der Politik ab. Familiensolidarität und eine eigenverantwortliche Lebensweise werden positiv bewertet, autoritäre Einstellungen abgelehnt.
7.3.6 Die prosozialen Pragmatiker
Individuelles Lebensglück, Solidarität in der Familie und fremdenfeindliche Tendenzen zeichnen 21 Prozent der österreichischen Jugendlichen dieser Gruppe aus - hier sind in der Mehrheit Mädchen zu finden. Authentischer Pragmatismus und prosozialer Idealismus sind überdurchschnittlich ausgeprägt, Hedonismus wird abgelehnt, beruflicher Erfolg und Materialismus spielen eine durchschnittliche Rolle. Die jungen Frauen und einige wenige Burschen streben vor allem ein ausgeglichenes Privatleben an, der Beruf dient in erster Linie der Existenzsicherung. Selbstverwirklichung findet nicht in der Freizeit statt, sondern manifestiert sich in der eigenen Familie, Heim und Beruf. Sie wollen aber auch Verantwortung für eine soziale Umwelt übernehmen. Die prosozialen Pragmatiker sind gut in der Gesellschaft verortet, fühlen sich aber weniger ernst genommen. Politisch sind sie nur mäßig interessiert und fallen insgesamt betrachtet nicht wirklich auf, da sie eine eher angepasste Lebensform haben. Das egalitäre Rollenbild wird vor allem im Privatleben bevorzugt.
Resümee der Wertetypen
Die österreichischen Jugendlichen sind offensichtlich keine homogene Gruppe. Es wird deutlich, dass neben persönlichen Ressourcen vor allem gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen die Wertepräferenzen prägen. Alterseffekte und Ausbildung schlagen sich in pessimistischen bzw. optimistischen Zukunftsbildern nieder. Strukturelle Benachteiligungen können eine genderkonforme Sozialisation nach sich ziehen, das Ausleben des weiblichen Geschlechts kann aber auch ein sozialeres und ökonomischeres Bewusstsein ausprägen. Benachteiligungen jeder Art können zu Frustration führen, die sich in einer resignierten und skeptischen Lebensweise entlädt. Die Vielfalt der Jugendlichen ist nicht nur Ausdruck einer besonderen entwicklungspsychologischen Lebensphase, sondern spiegelt auch eine Pluralität wieder, die in modernen Lebenswelten entsteht und verschiedene Reaktionen hervorruft. Außerdem ist erkennbar, dass die Jugendlichen bereit sind, eigene Ressourcen in eine gerechtere Welt und in ihr persönliches Glück zu investieren (vgl. Friesl et al. 2008: 265-273).
7.4 Psychosoziale Entwicklungen und Entwicklungsprobleme
Die körperlichen, sozialen und psychischen Veränderungen während der Pubertät tragen auch zur Identitätsbildung bei. Wie bereits auf S. 28 dieser Arbeit erwähnt, versteht man unter Identität eine individuelle Persönlichkeit, definiert durch Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Identität gilt dann als gefestigt, wenn sie immer wieder Neues integrieren kann und problemlos neue Ausrichtungen erfährt. Die schon besprochene positive Lösung der acht Entwicklungsaufgaben bzw. Krisen nach Erikson fördert eine gute Identitätsbildung. Marcia entwickelte 1980 vier Entwicklungstatusse, die die Identitätsentwicklung beschreiben:
1. Diffuse Identität: Jugendliche in dieser Entwicklungsstufe haben kaum Verpflichtungen und haben die Möglichkeiten ihres Lebensbereichs kaum erforscht.
2. Übernommene Identität: Auch hier haben die Heranwachsenden kaum ihren Lebensbereich erkundet, haben aber bereits einige Verpflichtungen übernommen.
3. Kritische Identität: In dieser Entwicklungsstufe ist der Jugendliche ständig auf der Suche nach Informationen. Es findet ein hohes Maß an Erkundung statt, es werden verschiedene Alternativen gedanklich durchgespielt oder sogar ausprobiert. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, daher gibt es noch keine Verpflichtungen, die wahrgenommen werden müssen.
4. Erarbeitete Identität: Hier sind bereits Entscheidungen gefallen und Verpflichtungen werden wahrgenommen. Alle Möglichkeiten und Alternativen sind überdacht und erkundet, eigene Fähigkeiten und Interessen sind entschlüsselt worden. Es gibt gewisse Zukunftsperspektiven, die verfolgt werden.
Die Reihfolge der Entwicklungsstufen unterliegt keiner spezifischen Ordnung und kann mehrmals und variierend durchlaufen werden. Die Entwicklung ist von Jugendlichen zu Jugendlichen unterschiedlich (vgl. Grob 2007: 194).
Zentrale Themen und Probleme im Jugendalter
Grob teilt das Jugendalter in drei Altersabschnitte auf, in denen jeweils wechselnde zentrale Themen und Probleme in den Mittelpunkt der Entwicklung rücken:
11 bis 14 Jahre:
In diesem Alter sind zentrale Themen der eigene Status bei den Gleichaltrigen, sowie die eintretenden körperlichen Veränderungen und die Frage, ob diese auch normal verlaufen. Der veränderte Körper und die daraus resultierenden Konsequenzen müssen in die Identität integriert werden. Die schnelle Veränderung der Körpergröße und des Körperfettanteils, sowie die Ausprägung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale verändern das Selbstbild der Heranwachsenden nachhaltig. Die veränderte Fremdwahrnehmung ist ein wichtiger Antrieb für die Identitätsentwicklung. Die Familie und Freunde haben in dieser Zeit den größten Einfluss auf die Sozialisanden. Das sozial konstruierte Geschlecht muss in die Identität integriert werden, um die sexuelle Reifung zu ermöglichen.
15 bis 17 Jahre:
In den westlichen Kulturen befinden sich die meisten Jugendlichen nun in der Phase der kritischen Identität. Durch die Übertragung von Verantwortung und die Ermöglichung von Selbstbestimmung, sozialen Interaktionen und Rollenspielen zwischen mehreren Generationen wird die Identitätsentwicklung positiv beeinflusst. In diesem Alter sind die zentralen Themen die eigene Wirkung auf das andere Geschlecht und Attraktivität. Durch die zunehmende Intimität der Beziehungen wird nicht nur das Sexualleben erkundet, sondern auch erlebt, wie man auf den Partner wirkt, man erfährt also seine Fremdwahrnehmung, dies ist Teil der Identitätsentwicklung. Weiters spielt das zukünftige Berufsleben, Werte und Fragen um die Gerechtigkeit sowie die eigene Popularität eine große Rolle.
18 bis 22 Jahre:
Die Jugendlichen beginnen ihre eigenen Moral-, Ethik- und Wertvorstellung fest- und auszuleben, das wichtigste Element in dieser späten Jugendphase ist das Suchen nach einer angemessenen Sexualität. Diese trägt wesentlich zur Identitätsentwicklung bei und hilft stabile, lang andauernde Beziehung zu führen. Außerdem wird der Gedanke erprobt, selbst die Elternrolle zu übernehmen. Die Heranwachsenden dieser Altersgruppe befinden sich oftmals schon in gesellschaftlichen Strukturen außerhalb der Schule und unterliegen somit einem größeren gesellschaftlichen Einfluss, mit dem sie zurecht kommen müssen.
Wie vorher schon erwähnt (vgl. S. 27 dieser Arbeit), testen die Sozialisanden in der Lebensphase des Jugendalters die bestehenden Grenzen aus, übertreten sie oft bewusst und geraten so leicht in schwierige Lebenslagen. Vor allem der Druck in Peer Groups führt oft dazu, dass die Heranwachsenden normative Vorgaben durchbrechen. In keiner anderen Lebensphase begeht der Mensch so viele Grenzübertritte, wie im Jugendalter. Dies hängt mit den zahlreichen Veränderungen zusammen, die der Jugendliche erlebt: sein Körper verändert sich, seine Psyche und auch die sozialen Umstände. Vor allem Mädchen können teilweise schlecht mit diesen Veränderungen umgehen und entwickeln Essstörungen wie Magersucht und/oder Bulimie, haben Depressionen oder Angststörungen. Die Entwicklungsprobleme entspringen aber nicht nur unmittelbar der Lebensphase der Adoleszenz, sondern können lebensgeschichtlich weiter zurückliegen (vgl. Grob 2007: 194f).
[...]
[1] Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichte ich auf genderkonforme Formulierungen und bitte dies zu beachten. Ich beziehe mich im Allgemeinen auf beide Geschlechter, in Einzelsituationen, die nur eine Person betreffen, ist die genderkonforme Formulierung natürlich angegeben.
[2] Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2008, verbringen die erwachsenen Deutschen 225 Minuten mit dem Fernsehen, 186 Minuten mit dem Radio und 58 Minuten im Internet. Das Internet liegt somit auf dem dritten Rang der tagesaktuellen Medien. Insgesamt nutzen die Deutschen also 469 Minuten täglich Medien, das sind fast acht Stunden am Tag! (Vgl. Internet 10: 2008)
[3] 120 Minuten täglich sind die 14-19jährigen Deutschen im Internet, länger also als die Erwachsenen (vgl. Internet 10: 2008)
[4] Der Begriff der Sozialisation geht auf den französischen Soziologen Emile Durkheim zurück. Sozialisation ist laut Durkheim ein Prozess, der den asozialen und triebhaften Menschen gesellschaftsfähig macht. Heutige Definitionen von Sozialisation sind klarerweise weniger roh ausgedrückt. So meint Fröhlich 1987, Sozialisation sei ein Prozess, in dem der Mensch durch passive und aktive Interaktion mit anderen Personen, Gruppen und Objekten oder Strukturen, die eigene Verhaltens- und Erlebnisweise erwerbe. Diese Definitionen entspringen einer funktionalistischen Perspektive. In der sozialökologischen Perspektive ist das zentrale Mittel der Sozialisation Kommunikation. Nur wer kommunikative Kompetenzen entwickelt, kann erfolgreich am Sozialisationsprozess teilnehmen, dies bedingt gleichzeitig kommunikatives Handeln. Die Jugendlichen sind demnach auf vielfältige kommunikative Umwelten angewiesen, um Erfahrungen sammeln zu können (vgl. Süss 2003: 11f).
[5] „Das Internet kann so wenig wie andere Medien ausschließlich an Bedürfnisse des Jugendschutzes angepasst werden: Es ist ein generelles Informationsmedium für alle Inhalte. Fragen des Gebrauchs des Internet durch Jugendliche sind den Fragen des freien Zugangs nicht gleich zu stellen, sondern nachzuordnen, da zuerst alle Informationen mündigen Bürgern zur Verfügung stehen müssen.“ (vgl. Internet 5: 2008)
[6] Happy Slapping: Man schlägt wahllos auf jemanden ein, filmt dies mit Handy und übermittelt dies per Bluetooth von Handy zu Handy oder stellt es gleich ins Internet. Snuff: Man spielt entweder schwerste Körperverletzungen nach oder vollbringt sie real. Selbst Experten können oft nicht mehr sagen, was echt und was inszeniert ist (vgl. Richard/Krafft-Schöning 2007: 92f).
[7] Internetsucht drückt sich in der exzessiven Nutzung des Internet aus. Zum Beispiel sucht man zwanghaft nach Informationen, spielt täglich und stundenlang Online-Spiele, verbringt den halben Tag in Chatrooms oder besucht pausenlos pornografische Seiten. Durchschnittlich verbringt ein Internetsüchtiger 35 Stunden pro Woche im Netz. Die Mehrheit der Süchtigen ist laut einer Schweizer Studie unter 20 Jahren, männlich und Single (vgl. With 2007: 17). Mag. Dr. Ingrid Reichmayr, freie Kommunikationswissenschaftlerin aus Wien, weist aber darauf hin, dass der Begriff der Internetsucht umstritten ist. Trotzdem sind ca. zwei bis acht Prozent der Österreicher von dieser Sucht, die richtige Entzugserscheinungen nach sich zieht, betroffen (vgl. Internet 22: 2008)
[8] Das Internet als „demokratisches Medium“ ist kein rechtsloser Raum an sich, sondern beruht vor allem auf Governance (nicht-institutionalisiertes, informelles und regelgeleitetes Handeln) und freiwilliger Selbstregulation (vgl. Döring 2003: 20ff). Die Selbstregulation stützt sich auf implizite und explizite ethische Richtlinien, die im Zuge einer internetbezogenen Medienphilosophie entwickelt wurden (vgl. Döring 2004: 24).
[9] Der „Die Presse“ Zeitungsartikel vom 13.12.2008 von Erika Pichler „Surfen ist wie Rad fahren“ im „Spectrum“ der Samstagsausgabe, informiert sehr ausführlich und leicht verständlich über die wichtigsten Themen bzw. Gefahren rund um das Thema Kinder/Jugendliche im Internet. Bei einer europäischen Studie der Stiftung „Digitale Chancen“ 2008 des „Youth Protection Roundtable“ wurden insgesamt 126 Experten aus der Computerbranche sowie der Wohlfahrtspflege befragt. Bei der Eingangsfrage, was sie mit dem Thema Jugendschutz (ohne der Nennung des Internets!) allgemein verbinden, antworteten 63 Prozent, dass Medienkompetenz, elterliche Kontrolle und andere Schutzaktivitäten am wichtigsten seien (vgl. Youth Protection Roundtable 2008: 1ff).
[10] Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaften agieren im Zeitverlauf immer interdisziplinärer, auch wenn dies immer wieder zu Identitätsproblemen und zur „Vergesslichkeit des Faches“ führt, so Saxer. Er kritisiert die willkürliche Aneignung von Materialobjekten und Theorien aus anderen Disziplinen und die daraus entstehende „chaotische Theorienbildung“ (vgl. Meyen/Löblich 2006: 37ff). Noelle-Neumann meint jedoch: „>Überschneidungen< mit anderen Disziplinen seien auch deshalb >unvermeidlich<, weil eine >integrierende Wissenschaft< zahlreiche Zusammenhänge einordnen müsse – hier hinsichtlich ihrer Bedeutung für die öffentliche Kommunikation.“ (Noelle-Neumann 1975: 743ff, zit. nach Meyen/Löblich 2006: 36).
[11] In der Literaturwissenschaft werden die Medien als „Texte“ betitelt. Hier sind nicht nur gedruckte Texte gemeint, sondern ebenso Fotos, Bilder, audiovisuelle Medienprodukte, Radio, Hörspiele, Comics usw. In der Forschungsperspektive der Cultural Studies wird der Medienbegriff ähnlich verstanden. Siegfried J. Schmidt und Guido Zurstiege definieren den Medienbegriff dahingehend, dass er vier Komponenten in sich bündelt: 1. Kommunikationsinstrumente: Sprache und materielle Zeichen, wie beispielsweise die Schrift. 2. Medientechniken: Technologien, die es ermöglichen Medieninhalte als Bücher, Film oder auch als Chat-Nachricht herzustellen und auch zu verbreiten. 3. Institutionelle Einrichtungen: Diese verwenden, verwalten und finanzieren Medientechnologien, wie beispielsweise Verlage, Fernsehanstalten und Radiosender. Und schließlich 4. Die Medienangebote selbst: die aus den bisher genannten Komponenten hervorgehen. Also ein Buch, ein Zeitungsartikel, ein Kinofilm, eine E-Mail usw. (vgl. Pürer 2003: 211f).
[12] Hierbei ist zu beachten, dass der Rezipient aber keineswegs vollkommen frei ist; jeder ist in die Bedeutungswelten seines kulturellen Alltags eingebunden (vgl. Bilandžić 2003: 356).
[13] Roland Barthes (Literaturwissenschaftler), geboren 1915 in Cherbourg, gestorben 1980 in Paris. Er war einer der provokantesten Literaturwissenschaftler der Nachkriegszeit, der verschiedenste Theorien aufgriff, miteinander vermischte und an kulturellen Objekten (Texte, Filme, Liebe, Mode etc.) demonstrierte. Er ist Mitbegründer der Semiologie und im Laufe der Jahre wurde die Intertextualität die zentrale Kategorie seiner Forschungsarbeiten: Lesen wird zur Dekomposition des Textes, er wird in anbetracht des Lesers und dessen kulturellen Geflechts aufgelöst. (Vgl. Internet 2: 2008)
[14] Aber nicht nur die Kulturpessimisten stehen dem Internet kritisch gegenüber. Selbst Howard Rheingold, der den Begriff der „virtuellen Gemeinschaft“ maßgeblich mitprägte, ist besorgt über die Qualität des zwischenmenschlichen Austausches im Internet. Zu Beginn des Internets, in den 70ern und 80ern, war das Internet einer eher kleinen Gruppe hoch ausgebildeter Menschen vorbehalten, die vorbildlich miteinander im Internet umgingen. Seit dessen Kommerzialisierung und Popularisierung Mitte der 90er Jahre öffnete sich das Medium Internet zunehmend für alle Menschen (kein Medium konnte sich bis heute so schnell verbreiten wie das Internet) (vgl. Döring 2003: 8), dadurch steigt die Zahl der soziokulturellen Differenzen, Konfliktpotentiale und Anforderungen an die Nutzer immer mehr an (vgl. Döring 2003: VI).
[15] „Ontogenese [griechisch] die, Ontogenie, die Entwicklung des einzelnen Lebewesens“ (Internet 7: 2008). Ontogenese: „Biolog.: Individualentwicklung, die von der Eizelle bis zum Tod eine Reihe von Entwicklungsstadien durchläuft, nämlich die Periode der Embryonalentwicklung, die der Jugendstadien, die des ausgebildeten Zustandes und schließlich die Periode der Seneszenz, des Alterns.“(Bertelsmann Lexikon, 1996, S. 7288)“. (Internet 3: 2008)
[16] Bis zum 17. Jahrhundert galten Kinder als kleine Erwachsene, die kaum geschont wurden. Ab sieben Jahren galten sie als straffähig. Es gibt Berichte, die beschreiben, dass Kinder wegen Diebstahls und anderer Vergehen hingerichtet oder eingekerkert wurden (vgl. Süss 2003: 25).
[17] Hoppe-Graff und Kim plädieren schon seit 1999 dafür, dass Medienkompetenz als eigene Entwicklungsaufgabe angesehen werden sollte. (vgl. With 2007: 24).
[18] Es ist nicht zwingend so, dass eine nicht bewältigte Entwicklungsaufgabe in einem gewissen Alter zum Stillstand oder falschen Entwicklungsverlauf führt. Es KANN geschehen, dies kann aber nicht nur im Jugendalter geschehen, sondern ein Leben lang (vgl. Süss: 35f)
Häufig gestellte Fragen
Welche Gefahren bestehen für Jugendliche im Internet?
Zu den untersuchten Risiken gehören Pornografie, politischer Extremismus, Cybermobbing („Happy Slapping“), Pro-Ana-Websites und sexueller Missbrauch.
Welche Rolle spielen Eltern bei der Internetnutzung ihrer Kinder?
Die Studie zeigt, dass Erziehungsstil, Medienkompetenz der Eltern und die Kommunikation innerhalb der Familie maßgeblich beeinflussen, wie sicher sich Jugendliche im Netz bewegen.
Was ist der Unterschied zwischen Internet-Vielnutzern und Internet-Wenignutzern?
Die Arbeit analysiert, ob eine intensive Nutzung automatisch zu höheren Risiken führt oder ob sie auch Chancen zur Identitätsbildung und Kompetenzerweiterung bietet.
Was versteht man unter Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien kritisch, reflektiert und verantwortungsbewusst zu nutzen und deren Inhalte einzuordnen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialem Milieu und Internetnutzung?
Ja, Faktoren wie Einkommen der Eltern, Ausbildung und sogar der Wohnort (Stadt vs. Land) beeinflussen die technologische Ausstattung und die Art der Internetnutzung.
- Quote paper
- Teresa Penzenauer (Author), 2009, Chancen und Risiken des Internets für jugendliche Nutzer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138037