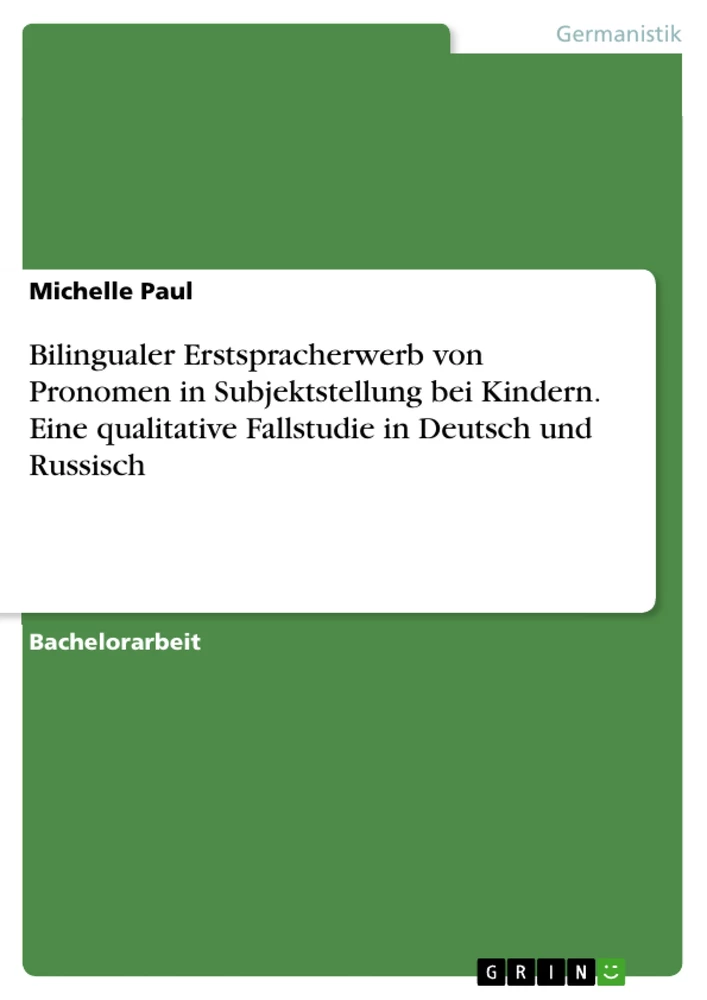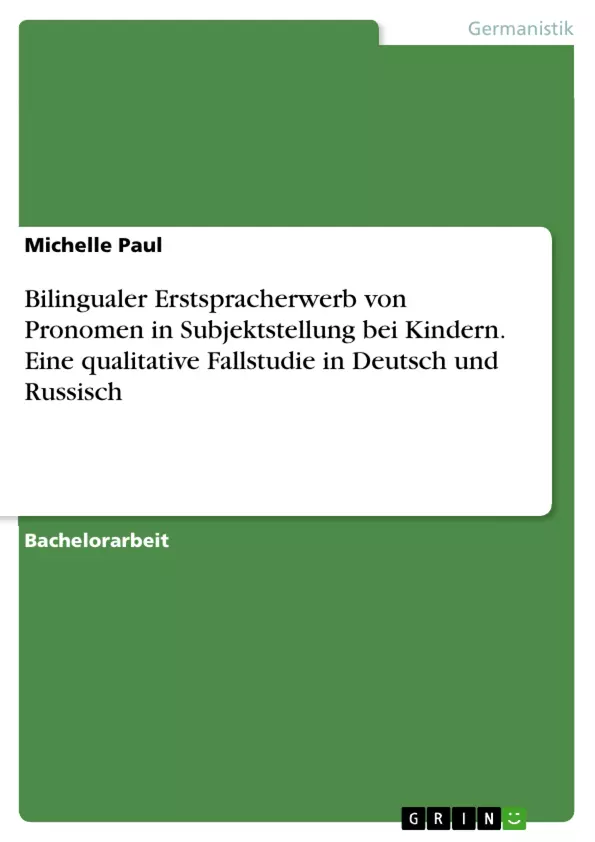Diese Arbeit präsentiert eine qualitative Fallstudie zum Erwerb von Pronomen in Subjektstellung bei zwei simultan bilingualen Kindern, K und M, im Alter von 1;05 bis 4;02. Die Studie konzentriert sich auf den Erstspracherwerb von Personalpronomen im Nominativ in den Sprachen Deutsch und Russisch. Ein interessanter Aspekt dieser Untersuchung ist der Einfluss der Pro-Drop-Eigenschaften beider Sprachen auf den Spracherwerb. Während Russisch eine partielle Pro-Drop-Sprache ist und das Weglassen des Subjekts im Satz erlaubt, erfordert Deutsch immer die explizite Nennung des Subjekts.
Die Untersuchung verwendet spontane Sprachaufnahmen der Kinder, um den Erwerb der Pronomen in beiden Sprachen zu analysieren. Die Arbeit erstellt Erwerbsprofile, die den zeitlichen Verlauf des Pronomenerwerbs darstellen. Sie zielt darauf ab, den Einfluss von Hintergrundfaktoren, wie der Spracheingabe und der Sprachdominanz, zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede im Erwerbsprozess der beiden Kinder aufzuzeigen.
Besonderes Augenmerk gilt der Frage, ob die Kinder separate sprachliche Kompetenzen entwickeln und zwischen den spezifischen Strukturen der beiden Sprachen unterscheiden können. Die Arbeit bietet Einblicke in den Erstspracherwerb von Pronomen in subjektiver Position und betrachtet die Auswirkungen der unterschiedlichen grammatischen Anforderungen der Zielsprachen.
Der theoretische Teil der Arbeit erklärt relevante Grundlagen des bilingualen Erstspracherwerbs, einschließlich der Unterschiede nach dem Alterskriterium und den sprachlichen Merkmalen des bilingualen Erstspracherwerbs. Der methodische Abschnitt erläutert die Datenanalyse und die berechneten Ergebnisse. Die gewonnenen Daten werden in Erwerbsprofilen visualisiert und vor dem theoretischen Hintergrund interpretiert.
Abschließend fasst die Arbeit die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen im Bereich des bilingualen Erstspracherwerbs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Gegenstand und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Bilingualismus: simultan/sukzessiv, gesteuert/ungesteuert
- 2.2 Hintergrundfaktor: Art der Inputvermittlung
- 2.3 Interferenz, Transfer, Sprachmischung
- 2.4 Der frühkindliche (bilinguale) Spracherwerb
- 2.5 Typologische Unterschiede Deutsch - Russisch: Morphosyntax
- 3. Methode
- 3.1 M und K
- 3.2 Datenerhebung: Analyse mit CLAN
- 3.3 Auswertung der erhobenen Daten
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Erwerbsprofile
- 4.1.1 MR
- 4.1.2 MD
- 4.1.3 KR
- 4.1.4 KD
- 4.2 Interpretation der Ergebnisse
- 4.3 Limitationen der Studie
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Erwerb von Subjektpronomen bei zwei simultan bilingualen Kindern (M und K), die Russisch und Deutsch sprechen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Erwerbsprofile für jedes Kind in beiden Sprachen zu erstellen und den Einfluss verschiedener Faktoren, wie Inputvermittlung und typologische Unterschiede der Sprachen (insbesondere bezüglich Pro-Drop-Eigenschaften), auf den Spracherwerb zu analysieren. Die qualitative Fallstudie erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 2,5 Jahren.
- Erwerb von Subjektpronomen im simultanen Bilingualismus (Russisch-Deutsch)
- Einfluss typologischer Unterschiede (Pro-Drop-Eigenschaften) auf den Spracherwerb
- Rolle von Hintergrundfaktoren wie Sprachinput und -dominanz
- Entwicklung separater sprachlicher Kompetenzen
- Qualitative Analyse von Spontansprachaufnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet das Forschungsinteresse der Autorin anhand ihrer eigenen bilingualen Sozialisation mit Russisch und Deutsch. Sie beschreibt eigene Beobachtungen zu Sprachmischung und Pronomengebrauch, welche ihre Neugier auf den bilingualen Spracherwerb, insbesondere den Erwerb von Pronomen, geweckt haben. Das Hauptziel der Arbeit wird definiert: die Erstellung von Erwerbsprofilen für Subjektpronomen bei zwei simultan bilingualen Kindern und die Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf diesen Erwerbsprozess. Die methodische Vorgehensweise – eine qualitative Fallstudie – und die Struktur der Arbeit werden kurz vorgestellt.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund für die Untersuchung. Es werden verschiedene Konzepte des Bilingualismus (simultan/sukzessiv, gesteuert/ungesteuert) erläutert, der Einfluss der Art der Inputvermittlung diskutiert und Phänomene wie Interferenz, Transfer und Sprachmischung definiert. Der frühkindliche bilinguale Spracherwerb wird beleuchtet, und schließlich werden typologische Unterschiede zwischen Deutsch und Russisch, insbesondere hinsichtlich der Morphosyntax und der Pro-Drop-Eigenschaften, detailliert betrachtet. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der komplexen sprachlichen Prozesse, die im Fokus der Studie stehen.
3. Methode: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Studie. Es werden die beiden untersuchten Kinder (M und K) vorgestellt, die Methode der Datenerhebung (Spontansprachaufnahmen) und deren Analyse mittels des Programms CLAN erläutert, und der Ansatz zur Auswertung der erhobenen Daten dargelegt. Dieser Teil bietet einen detaillierten Einblick in die methodische Vorgehensweise der qualitativen Fallstudie und gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden Erwerbsprofile für jedes Kind in beiden Sprachen erstellt, die den Gebrauch von Subjektpronomen im Verlauf der Zeit aufzeigen. Die Interpretation der Ergebnisse wird dargelegt, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kindern sowie der Einfluss von Hintergrundfaktoren untersucht werden. Schließlich werden auch Limitationen der Studie kritisch betrachtet. Dieses Kapitel stellt den Kern der Forschungsarbeit dar und liefert die empirischen Daten für die Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Simultaner Bilingualismus, Russisch, Deutsch, Spracherwerb, Subjektpronomen, Pro-Drop, Erwerbsprofile, qualitative Fallstudie, Sprachinput, Interferenz, Typologie, Morphosyntax.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Erwerb von Subjektpronomen bei simultan bilingualen Kindern (Russisch-Deutsch)
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Erwerb von Subjektpronomen bei zwei simultan bilingualen Kindern, die Russisch und Deutsch sprechen. Es werden Erwerbsprofile erstellt und der Einfluss verschiedener Faktoren wie Inputvermittlung und typologische Unterschiede der Sprachen analysiert.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie entwickeln sich die Erwerbsprofile von Subjektpronomen bei simultan bilingualen Kindern im Russischen und Deutschen, und wie wirken sich Faktoren wie Input, Sprachdominanz und typologische Unterschiede (insbesondere Pro-Drop) auf diesen Erwerb aus?
Welche Methoden wurden verwendet?
Es handelt sich um eine qualitative Fallstudie mit zwei simultan bilingualen Kindern (M und K). Die Datenerhebung erfolgte durch Spontansprachaufnahmen, die mit dem Programm CLAN analysiert wurden. Die Auswertung der Daten erfolgte qualitativ.
Welche theoretischen Grundlagen wurden berücksichtigt?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zum simultanen und sukzessiven Bilingualismus, zur Inputvermittlung, zu Interferenz, Transfer und Sprachmischung, sowie zum frühkindlichen Spracherwerb. Besonderes Augenmerk liegt auf den typologischen Unterschieden zwischen Deutsch und Russisch, insbesondere hinsichtlich der Morphosyntax und der Pro-Drop-Eigenschaft.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit erstellt individuelle Erwerbsprofile für jedes Kind in beiden Sprachen, die den Gebrauch von Subjektpronomen über einen Zeitraum von ca. 2,5 Jahren dokumentieren. Die Ergebnisse zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erwerbsprozess auf und diskutieren den Einfluss von Hintergrundfaktoren.
Welche Faktoren beeinflussen den Erwerb von Subjektpronomen?
Die Studie untersucht den Einfluss der Art der Inputvermittlung, der typologischen Unterschiede zwischen Deutsch und Russisch (insbesondere Pro-Drop), sowie mögliche Interferenz- und Transferphänomene auf den Erwerb von Subjektpronomen.
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Arbeit benennt und diskutiert kritisch Limitationen der Studie, die sich beispielsweise aus der kleinen Stichprobengröße (zwei Kinder) und dem spezifischen Fokus auf Subjektpronomen ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Simultaner Bilingualismus, Russisch, Deutsch, Spracherwerb, Subjektpronomen, Pro-Drop, Erwerbsprofile, qualitative Fallstudie, Sprachinput, Interferenz, Typologie, Morphosyntax.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zu den Ergebnissen, sowie ein Fazit und Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Dokument der Bachelorarbeit enthält eine detaillierte Beschreibung der Methodik, der Ergebnisse und der Diskussion. (Hinweis: Der Link zum vollständigen Dokument wird hier nicht bereitgestellt, da dieser im Kontext der Aufgabenstellung nicht verfügbar ist).
- Arbeit zitieren
- Michelle Paul (Autor:in), 2023, Bilingualer Erstspracherwerb von Pronomen in Subjektstellung bei Kindern. Eine qualitative Fallstudie in Deutsch und Russisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1381017