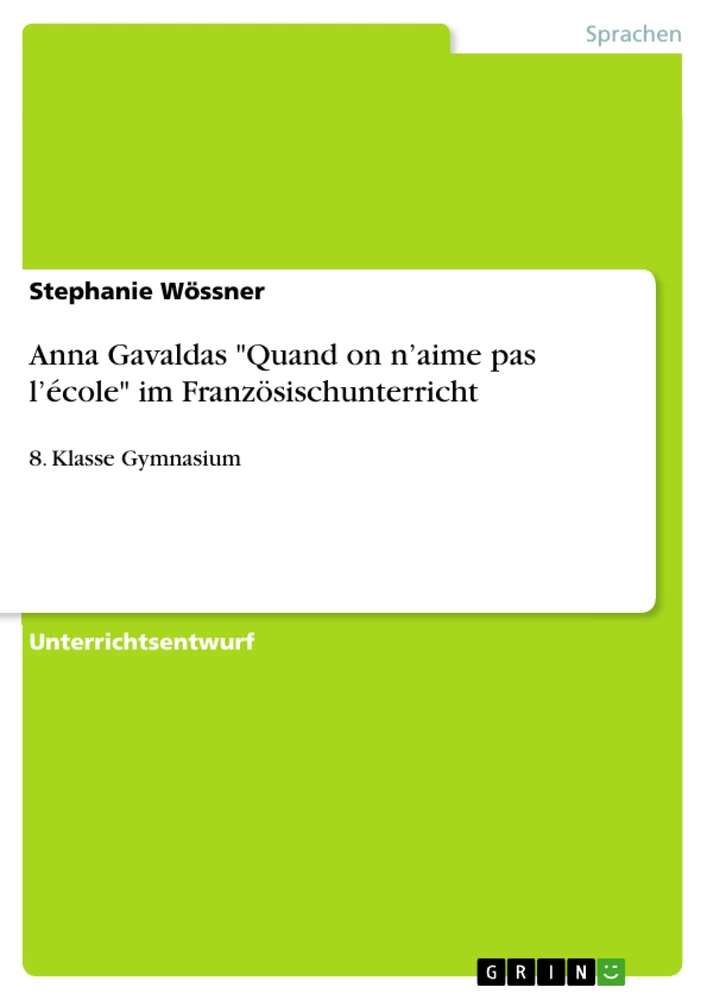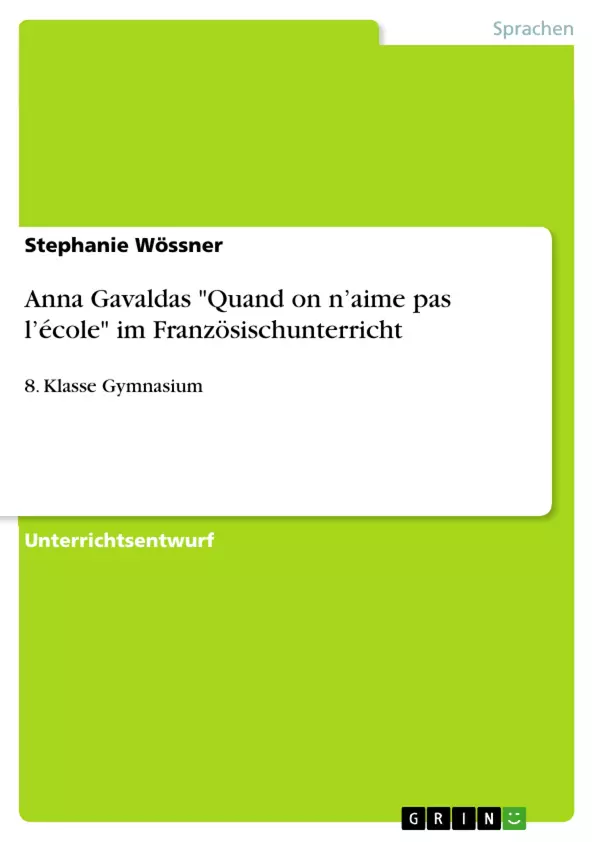Dieser Entwurf zu "Quand on n'aime pas l'école" von Anna Gavaldas liefert inhaltliche und methodisch-didaktische Überlegungen für den Französischunterricht in der 8. Klasse am Gymnasium. Zudem werden Anreize für einen möglichen Unterrichtsverlauf sowie ein Tafelbild zur Verfügung gestellt.
Ì Inhaltliche Überlegungen
Der Bildungsplan fordert, dass Schülerinnen im Fach Französisch am Ende der achten Klasse zunehmen fähig sind, Tex te selbständig zu erschließen und durch Leitfragen gelenkt zum Textverständnis zu kommen. Zudem sollen sie an den kreativen Umgang mit Tex ten herangeführt werden. Diese Forderung seitens des Bildungsplans bedarf einer behutsamen Annäherung der Schülerinnen an die französische Literatur, so dass sie zum einen langsam die zur Lektüre und Textarbeit notwendigen Arbeitstechniken erlernen ohne jedoch den Spaß an der Literatur von vorne herein zu verlieren, da auch adaptierte Texte zu Beginn ungewohnt sind und für die Schülerinnen durch ihre Länge und Komplexität in Bezug auf Vokabular und Grammatik unbezwingbar erscheinen. Die Beschäftigung mit Anna Gavaldas Quand on n’aime pas l’école soll einen ersten Schritt in diese Richtung darstellen, immer in Anbetracht der teils noch recht großen sprachlichen Unzulänglichkeiten der Schülerinnen.
Es handelt sich bei dieser Stunde um die achte Stunde der Einheit über Literatur. Zu Beginn der Einheit wurde allgemein über Bücher gesprochen und Vokabular zur Beschreibung von Buchcovern vermittelt. Im Anschluß daran wurde der Text Vite aux Lutins (Découvertes 3, Lektion 5) unter verschiedenen Aspekten (Hörverstehen, Leseverstehen, kreative Textarbeit) gelesen. In Zusammenhang damit lernten die Schülerinnen die Verben auf -Indre, sowie die Adverbien auf -ammentZ-emment kennen. Auch wurde die indirekte Rede wiederholt und um die concordance des temps bei einleitendem Verb in der Vergangenheit erweitert. Diese neuen Grammatikphänomene wurde nach ihrer Einführung durch vertiefende Übungen gefestigt. In den beiden der Lehrprobenstunde vorangehenden Stunden wurde grundlegend besprochen, was eine Nacherzählung ist und in wie fern sie sich von der Inhaltsangabe unterscheidet. Die Nacherzählung wurde anhand des Textes L’lle aux Lutins mündlich erarbeitet. Die Schülerinnen erhielten zudem ein Blatt mit Strukturelementen, welche sie bei der Erfindung einer eigenen Geschichte bzw. eines Märchens einsetzen können. Als Hausaufgabe bekamen sie die Erfindung einer eigenen Geschichte und die schriftliche Nacherzählung des Textes L'lle aux Lutins auf. Da in dieser Woche jedoch die frz. Austauschschülerinnen in II. sind, die Hausaufgabe ziemlich zeitaufwendig ist und ich unbedingt erreichen wollte, daß sich alle Schülerinnen genügend Zeit nehmen, um sie zu erledigen, beschloss ich, die Hausaufgabe auf nach den Ferien aufzugeben. Auch wollte ich vermeiden, dass zum einen die Zeit mit den Austausch Schülern Innen stark beschnitten wird, und zum anderen die Austauschschülerinnen die Hausaufgaben der deutschen Schülerinnen erledigen, da die Aufgabe auf den ersten Blick recht schwierig erscheinen dürfte.
Schließlich erwarte ich mir davon, daß die Schülerinnen ihrer Phantasie freien Lauf lassen und natürlich - in Anbetracht der Tatsache, dass ihr Ausflug nicht ganz wie geplant stattfinden kann - nicht durch die Hausaufgabe noch frustrierter in die Lehrprobenstunde kommen.
II Methodisch-didaktische Überlegungen
Bei der Materialwahl für die Lehrprobenstunden standen mir lediglich das Buch, die Folien und die CD des Lehrwerkes Découvertes 3 zur Verfügung. Jedoch waren die Folien im Hinblick auf meine Stunde nicht besonders hilfreich und die CD enthielt den Text der Lehrprobenstunde nicht. Gerne hätte ich zumindest ansatzweise die auf der Lehrersoftware Profi Prof oder auf der zum Lehrwerk gehörigen DVD zu findenden Videoclips zurückgegriffen, jedoch ist weder das eine noch das andere am Gymnasium H. verfügbar, sodass ich mich auf die vorhandenen Medien beschränken musste.
Der Einstieg durch einen Bildimpuls bietet gegenüber der abstrakteren Konfrontation der Schülerinnen mit dem Satz « Quand on n’aime pas l’école » auch den schwächeren Schülerinnen die Möglichkeit, sich am anschließenden Unterrichtsgespräch zu beteiligen, da die Frage, weshalb der Junge die Schule nicht mag und die Aufforderung, mögliche Gründe zu nennen, in Verbindung mit dem Bild einfacher zu verstehen sind als die abstraktere Version. Dies ist in dieser achten Klasse unbedingt notwendig, um nicht bereits zu Anfang einen Teil der Schülerinnen zu verlieren.
Es war mir bei der Konzipierung der Stunde sehr wichtig im Sinne der Begeisterung der Schülerlnnnen für Literatur so viele Sinne wie möglich anzusprechen, da Literatur erlebt und nicht nur gelesen werden sollte. Daher auch die doppelte Präsentation des Textes durch die Hörverständnisübung und das anschließende Leseverständnis. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bewusst das laute Lesen des Textes durch die Schülerinnen ausgeklammert, da die Klasse allgemein sehr mit der französischen Aussprache kämpft und ich vermeiden wollte, dass meine ständige Korrektur der Aussprache dazu führt, dass der Spaß am Lesen von Literatur verloren geht. Ich habe vor, in den kommenden Monaten ca. zwei bis drei Wochen auf Aussprache- und Leseübungen zu verwenden. Dort wird auch der verwendete Text zum Zuge kommen. Die unterschiedlichen Hör- bzw. Leseaufträge dienten zur Binnendifferenzierung, da ich es zwar den schwächeren Schülerinnen ermöglichen wollte, zumindest einen Großteil der Aufgaben lösen zu können, es den guten Schülerinnen jedoch nicht verwehren wollte, auch anspruchsvollere Aufgaben zu erhalten. Aus diesem Grunde habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, einige der besseren Schülerinnen bei der Besprechung verschiedener Aufgaben aktiv einzubinden, indem sie die Lösungen auf Folie schreiben und mit der Klasse besprechen bzw. die Lösungen der Leseverständnisaufgabe an die Tafel schreiben. Eine Vokabeleinführung der neuen Wörter ist bei diesem Text nicht notwendig, da die Beantwortung der Hörverstehensaufgaben auch ohne die Kenntnis der im Buch angegebenen Vokabeln möglich ist und ein Berg von neuen Vokabeln zu Beginn recht demotivierend sein kann. Beim Leseverständnis können die Schülerinnen dann die in den Fußnoten angegebenen Vokabeln zur Rate ziehen. Sollten noch weitere Wörter unbekannt sein - wovon ich nicht ausgehe - so werde ich sie während der Lektüre an die Tafel schreiben.
In Hinblick auf den Transfer und die kreative Arbeit mit dem gelesenen Text wären mehrere Aufgaben denkbar gewesen, so zum Beispiel ein Rollenspiel zwischen Grégoire und seinen Freunden oderseinen Eltern. Dies hätte ebenso einen Perspektivenwechsel mit sich gebracht, wie die Hot Chair-Methode. Jedoch fiel meine Wahl letztendlich auf die Hot Chair-Methode, da es für die Schülerinnen einfacher ist, sich in die Lage von Grégoire zu versetzen als in die von z.B. seinen Eltern. Außerdem hätte ein Rollenspiel weitaus zu viel Zeit in Anspruch genommen, um es noch in der Stunde unterzubringen. Dies wäre natürlich in einer Doppelstunde wunderbar zu machen gewesen. Die Vorentlastung der Aufgabe des « Publikums » durch eine kurze Ideensammlung an Lösungsvorschlägen gibt auch den schwächeren Schülerinnen eine Chance, sich zu beteiligen. Die Entscheidung, Aaron als Grégoire vor die Klasse zu stellen, liegt darin begründet, dass es sich bei Aaron um den besten Schüler der Klasse handelt und er daher zum einen ohne weiteres dazu fähig ist, entsprechend spontan auf Lösungsvorschläge zu reagieren, zum anderen auch in größerem Maße als die anderen Schülerinnen gefordert werden muss.
Ursprünglich hatte ich vor, die Schülerinnen nach der Lektüre des Textes und in Anschluß an die beiden vorangehenden Stunden, in denen über Nacherzählungen und Inhaltsangaben gesprochen wurde und die Schülerinnen selbst eine Geschichte erfinden sollten, wiederholen zu lassen, wie eine Inhaltsangabe geschrieben wird. Sie hätten dann diese Kenntnisse auf den vorliegenden Text anwenden sollen. Da ich jedoch in besagten Stunden bereits bemerkte, dass sich gut zwei Drittel der Schülerinnen sehr schwer mit Nacherzählungen und Geschichtenschreiben tun, habe ich beschlossen, diese Arbeitstechniken nach den Ferien noch einmal ausführlich zu behandeln, um zu erreichen, daß auch schwache Schülerinnen danach in der Lage sein werden, Nacherzählungen und Inhaltsangaben, sowie selbsterfunde Geschichten niederzuschreiben. Da ich bereits bei der letzten Lektion des Buches angelangt bin, habe ich sowieso noch genügend Zeit, um auf Schwierigkeiten ausführlich einzugehen. So vermeide ich zusätzlich, den Schülerinnen durch zu schwierige Aufgaben den Spaß an der Literatur zu nehmen.
Statt dem Vorhaben, die Schülerinnen eine Inhaltsangabe verfassen zu lassen, habe ich mich also dazu entschlossen, ein fiktives Weblog von Grégoire zu verfassen, für das die Schülerinnen einen Kommentar verfassen sollen. So werden die den Schülerinnen bekannten und eventuell sogar von ihnen benutzen neuen Medien integriert, was motivierend wirken dürfte. Außerdem kommt auch das Training der Schreibkompetenz auf diese Weise nicht zu kurz, während es die freie Aufgabenstellung jedem Schüler bzw. jeder Schülerin erlaubt, den eigenen Fähigkeiten entsprechend einen Text zu verfassen. Sollte nach dem Hot Chair keine Zeit mehr sein, diese Aufgabe zu erledigen, so erhalten die Schülerinnen die Aufgabe, diesen Teil des Arbeitsblatts über die Ferien zu erledigen.
Prinzipiell habe ich mich dafür entschieden, bewußt keine Hausaufgabe zu geben - es sei denn es bleibt nicht mehr genügend Zeit für den kurzen Kommentar auf Grégoires Weblog - da es sich zum einen um die letzte Stunde vor den Ferien handelt, zum anderen, da die Schülerinnen für die Lehrprobe bereits ein großes Opfer bringen mussten und sich eine Belohnung verdient haben. Hätte es sich um eine reguläre Stunde gehandelt, hätten die Schülerinnen die Aufgabe bekommen, über das Wochenende eine Fortsetzung der Geschichte zu schreiben und einen typischen Tag in Grégoires Leben zu beschreiben.
Mit ist des Weiteren bewusst, dass ein Großteil dieser Stunde auf einem Wechsel von Einzel- bzw. Partnerarbeitsphasen und Plenumsphasen besteht, was recht einseitig wirken kann. Jedoch habe ich nach nunmehr knapp sechs Monaten in dieser Klasse gelernt, dass Gruppenarbeit relativ unproduktiv ist und die Schülerinnen am meisten aus einer Stunde mitnehmen, in der sie Aufgaben allein oder in Partnerarbeit erledigen, die dann im Plenum besprochen werden. Um einer zu großen Monotonie vorzubeugen, bemühe ich mich, so oft es geht in den Plenumsphasen die Schülerinnen untereinander agieren zu lassen anstatt einen Dialog zwischen mir und den Schülerinnen aufzubauen.
Die zu Stundenende verschenkten Osterhäschen aus Schokolade stellen keine direkte Belohnung für die Lehrprobenstunde dar, sondern waren von mir seit langem zu Ostern eingeplant.
III Lernziele Die Schülerinnen ...
El ... äußern sich spontan auf einem Bildimpuls zum Thema Abneigung gegen die Schule. 0 ... sind in der Lage, sowohl globale als auch selektive Hörverständnisfragen zu einem neuen Text zu beantworten.
- ... lesen den neuen Text und beantworten eine selektive Leseverstehensfrage.
- ... gehen kreativ mit einem Text um und leisten einen Perspektivenwechsel 0 ... finden Lösungsansätze für das im Text erörterte Problem und konfrontieren den auf dem heißen Stuhl sitzenden « Grégoire ».
- ... schreiben einen Kommentar zu Grégoires Weblog
- ... gewinnen Spaß am Umgang mit literarischen Texten, die sie in Bezug zu ihrer Lebenswirklichkeit setzen können (nur bedingt und auf lange Sicht überprüfbar)
IV Materialien
Büdungsplan Baden-Württemberg 2004, S. 133-136. Découvertes 3. Schülerbuch.
Google Bildersuche.
V Geplanter Unterrichtsverlauf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
VI Geplanter Tafelanschrieb
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie kann man Anna Gavaldas Texte im Französischunterricht einsetzen?
Die Lektüre „Quand on n’aime pas l’école“ eignet sich besonders für die 8. Klasse, um Schüler durch kreative Aufgaben und Hörverstehen an Literatur heranzuführen.
Was ist die „Hot Chair-Methode“ im Sprachunterricht?
Dabei schlüpft ein Schüler in die Rolle der Hauptfigur (Grégoire) und beantwortet Fragen der Klasse, was das empathische Verständnis und die Sprechfertigkeit fördert.
Warum wird im Entwurf auf lautes Lesen verzichtet?
Um Frustration durch Aussprachefehler zu vermeiden und den Fokus auf den Spaß an der Geschichte und das Textverständnis zu legen.
Welche kreativen Schreibaufgaben werden vorgeschlagen?
Die Schüler können beispielsweise einen Kommentar für ein fiktives Weblog der Hauptfigur verfassen, was moderne Medien in den Unterricht integriert.
Wie erfolgt die Binnendifferenzierung in dieser Unterrichtseinheit?
Durch unterschiedliche Hör- und Leseaufträge sowie die Einbindung leistungsstärkerer Schüler in die Moderation von Lösungen wird auf verschiedene Lernniveaus eingegangen.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Wössner (Autor:in), 2008, Anna Gavaldas "Quand on n’aime pas l’école" im Französischunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138107