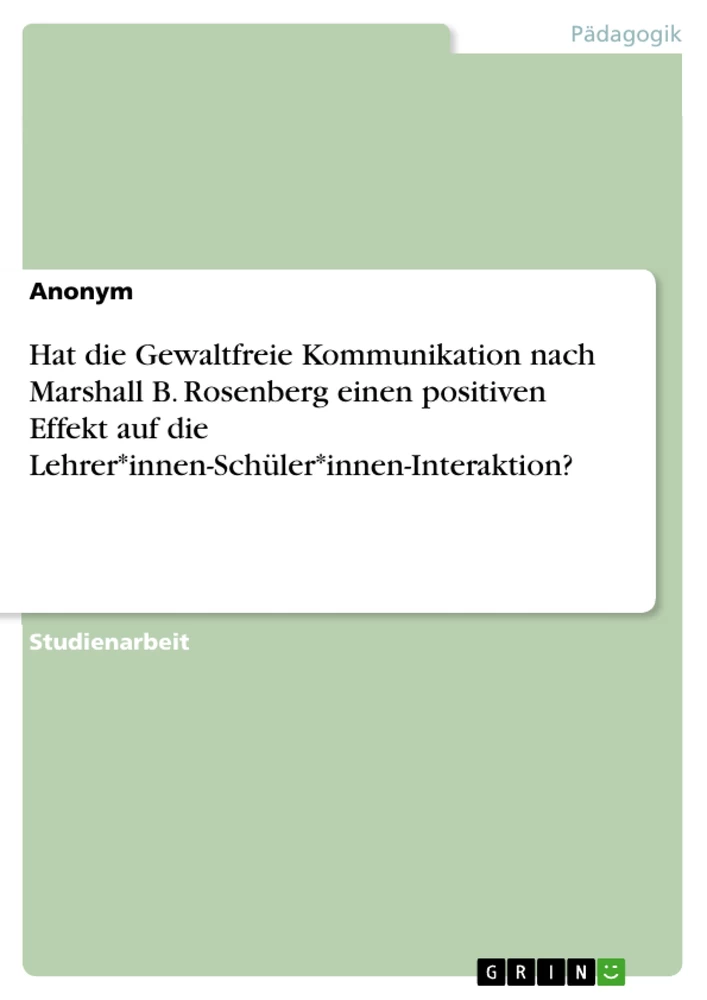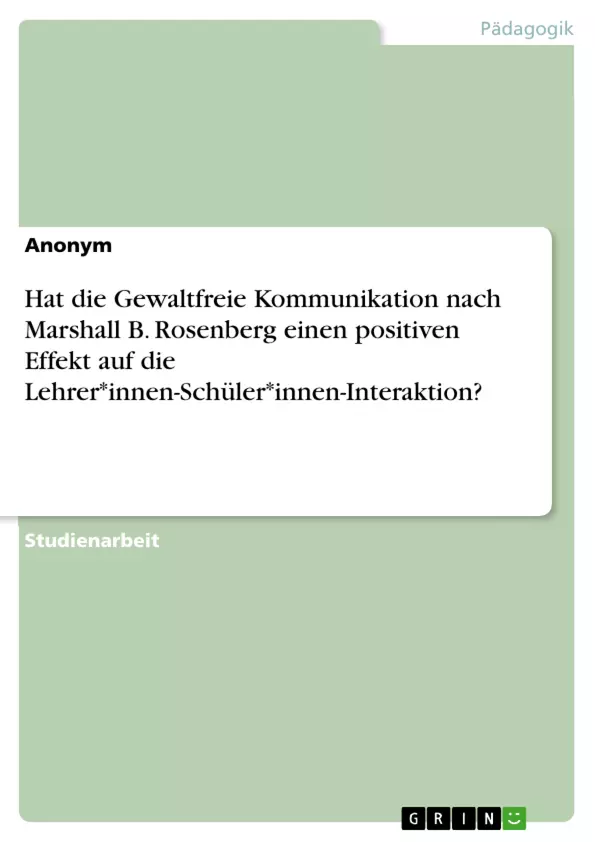Die vorliegende theoretische Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg einen positiven Effekt auf die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion hat. Hierfür wird zunächst das Modell der Gewaltfreien Kommunikation dargestellt und im Anschluss mit Eigenschaften der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung in Verbindung gesetzt. Ebenso beleuchtet werden Forschungsergebnisse bezüglich der Gewaltfreien Kommunikation, sowie einige Kritikpunkte hinsichtlich des Modells. Die Ausarbeitung kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Gewaltfreie Kommunikation einen insgesamt positiven Einfluss auf die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion hat.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Gewaltfreie Kommunikation
- 2.1 Marshall B. Rosenberg und die Entstehung der Gewaltfreien Kommunikation
- 2.2 Grundannahmen der Gewaltfreien Kommunikation
- 2.2.1 Beobachtungen ohne Bewertung
- 2.2.2 Gefühle ohne Interpretation
- 2.2.3 Bedürfnisse
- 2.2.4 Bitten statt Forderungen
- 2.2.5 Empathisches Erfragen & aktives Zuhören
- 2.3 Haltung / Menschenbild der Gewaltfreien Kommunikation
- 2.4 Eigenschaften in der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung
- 2.5 Forschung
- 3 Kritik / Reflexion
- 4 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Facharbeit befasst sich mit dem Einfluss der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall B. Rosenberg auf die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion. Sie untersucht, ob die Anwendung der GfK zu einer positiveren und konstruktiveren Interaktion zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen führen kann.
- Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg
- Die Grundannahmen der GfK und deren Anwendung in der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung
- Empirische Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit der GfK in pädagogischen Kontexten
- Kritische Reflexion der GfK und ihrer möglichen Grenzen
- Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bedeutung der GfK für die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Kommunikationsprobleme im schulischen Kontext dar und führt das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) ein. Es wird die Fragestellung der Arbeit erläutert und der Aufbau der Facharbeit skizziert.
- Gewaltfreie Kommunikation: Dieses Kapitel erläutert das Modell der GfK nach Marshall B. Rosenberg und beleuchtet seine Entstehung. Es werden die vier Grundannahmen der GfK – Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten – detailliert dargestellt und anhand von Beispielen aus der Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion veranschaulicht. Zudem werden die Haltung und das Menschenbild der GfK sowie deren Eigenschaften in der Beziehung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen beleuchtet. Schließlich wird auf die Forschungslage zur Wirksamkeit der GfK eingegangen.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation, Marshall B. Rosenberg, Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion, Kommunikation, Bedürfnisse, Empathie, Konfliktlösung, pädagogische Psychologie, Forschung, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GfK)?
Ein von Marshall B. Rosenberg entwickeltes Kommunikationsmodell, das auf Empathie, dem Ausdruck von Bedürfnissen und dem Verzicht auf Bewertungen basiert.
Welche vier Schritte umfasst das GfK-Modell?
Die Schritte sind: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühl (ohne Interpretation), 3. Bedürfnis und 4. Bitte (statt Forderung).
Verbessert GfK die Lehrer-Schüler-Beziehung?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass GfK einen positiven Effekt hat, da sie Konflikte entschärft und ein wertschätzendes Miteinander fördert.
Gibt es Kritik an der Gewaltfreien Kommunikation?
Ja, Kritiker bemängeln oft die künstliche Sprache des Modells oder die Schwierigkeit, es in stressigen Alltagssituationen konsequent anzuwenden.
Was ist „empathisches Erfragen“?
Es ist eine Technik des aktiven Zuhörens, bei der man versucht, die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers wertfrei zu erfassen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2023, Hat die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg einen positiven Effekt auf die Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382111