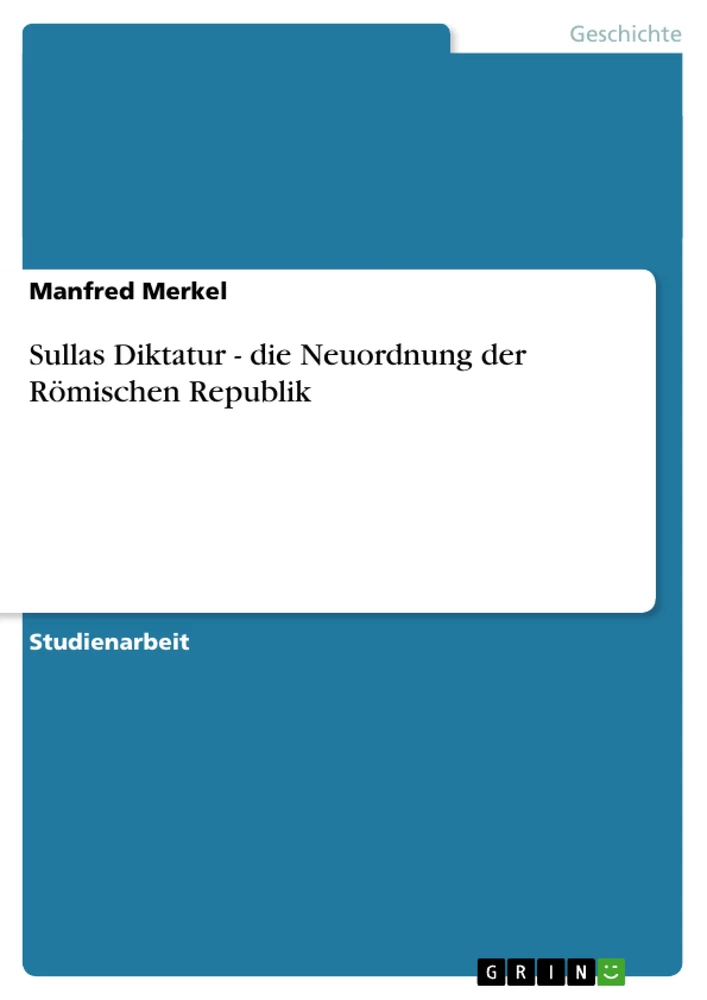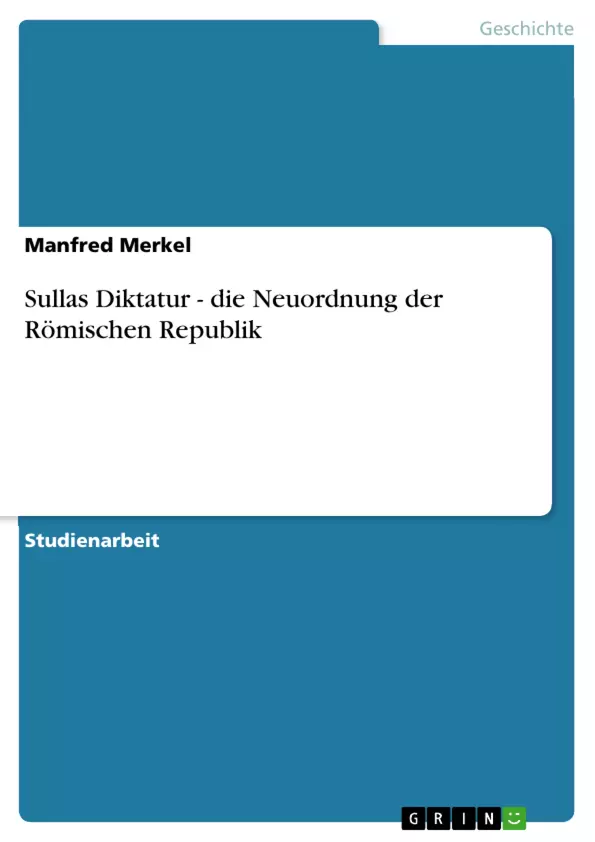Die vorliegende Arbeit soll einen geschichtlichen Überblick zu Sullas politischem Wirken in den Jahren 83 - 79 v. Chr. geben. Im Mittelpunkt stehen Sullas Rückkehr nach Italien im Jahr 83 v.Chr., der darauf folgende Bürgerkrieg, Sullas Machtübernahme in Rom, die Proskriptionen und vor allem Sullas Diktatur mit der damit verbundenen Restauration und Reformierung des römischen Staates. Die in der geschichtswissenschaftlichen Forschung kontroverse Diskussion zur sullanischen Neuordnung des römischen Staates und die schwierige Bewertung und Interpretation von Sullas Absichten ( und seinen politischen Motiven) soll in ihren Grundzügen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lucius Cornelius Sulla Felix (138-78 v.Chr.) - Kurzbiographie bis ins Jahr 83 v.Chr.
- Sullas Rückkehr nach Italien und der Bürgerkrieg 83-81 v.Chr.
- Sulla crudelis: die Proskriptionen und die Unterwerfung der letzten Gegner
- Dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae - Die Neuordnung des römischen Staates
- Die Reform der Magistraturen (Volkstribunat, Quaestur, Prätoren, Cursus Honorum)
- Volkstribunat - tribuni plebis
- Lex Cornelia de magistratibus
- Lex Cornelia de praetoribus octo creandis
- Die Senatsreform (Einschränkung der Censoren)
- Die Neuordnung der Provinzverwaltung
- Die Reform der Rechtsprechung - neue juristische Institutionen
- Die Luxus- und Moralgesetzgebung
- Reformen auf dem Bereich des Religiösen (lex de sacerdotis)
- Die Entmilitarisierung Italiens
- Die Reform der Magistraturen (Volkstribunat, Quaestur, Prätoren, Cursus Honorum)
- Sullas Rücktritt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen geschichtlichen Überblick über Sullas politisches Wirken zwischen 83 und 79 v. Chr. Der Fokus liegt auf seiner Rückkehr nach Italien, dem darauffolgenden Bürgerkrieg, seiner Machtübernahme, den Proskriptionen und insbesondere seiner Diktatur mit der damit verbundenen Restauration und Reform des römischen Staates. Die kontroverse wissenschaftliche Diskussion um Sullas Neuordnung und die Interpretation seiner Absichten werden ebenfalls behandelt.
- Sullas Rückkehr nach Italien und der Bürgerkrieg
- Die sullanischen Proskriptionen und ihre Folgen
- Die Reformen der römischen Magistraturen und des Senats unter Sulla
- Die Neuordnung der Provinzverwaltung und des Rechtssystems
- Sullas Rücktritt und das Erbe seiner Diktatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht Sullas politische Tätigkeit von 83-79 v. Chr., insbesondere seine Rückkehr nach Italien, den Bürgerkrieg, die Machtübernahme, die Proskriptionen und seine Diktatur mit den damit verbundenen Reformen. Sie beleuchtet die kontroverse wissenschaftliche Debatte über Sullas Maßnahmen und seine Motive.
Lucius Cornelius Sulla Felix (138-78 v.Chr.) - Kurzbiographie bis ins Jahr 83 v.Chr.: Diese kurze Biographie skizziert Sullas Werdegang bis 83 v. Chr., um seine Person und seine Motive für seine späteren Handlungen besser zu verstehen. Sie zeigt seinen Aufstieg innerhalb der römischen Gesellschaft, seine militärischen Erfolge und seine zunehmenden politischen Konflikte, die letztendlich zu seinem Marsch auf Rom führten.
Sullas Rückkehr nach Italien und der Bürgerkrieg 83-81 v.Chr.: Dieses Kapitel beschreibt Sullas Rückkehr nach Italien nach seinen Erfolgen im Krieg gegen Mithridates, den Ausbruch des Bürgerkriegs gegen seine politischen Gegner, und seinen letztendlichen Sieg. Es beleuchtet die militärischen Strategien und die politischen Manöver, die zu Sullas Triumph führten und den Weg für seine Diktatur ebneten. Die Beschreibung des Bürgerkriegs hebt die Brutalität der Kämpfe und die weitreichenden Folgen hervor, die Sullas Herrschaft prägten.
Sulla crudelis: die Proskriptionen und die Unterwerfung der letzten Gegner: Dieses Kapitel behandelt die brutalen Proskriptionen, die Sulla zur Eliminierung seiner Gegner einsetzte. Es analysiert die politischen und sozialen Folgen dieser Maßnahmen, die das römische Leben tiefgreifend veränderten und das Bild Sullas als grausamer Diktator prägten. Die detaillierte Darstellung der Proskriptionen veranschaulicht den Umfang des Terrors und verdeutlicht die Methoden der Unterdrückung und die daraus resultierenden Veränderungen im römischen Staat.
Dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae - Die Neuordnung des römischen Staates: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit den Reformen Sullas während seiner Diktatur. Es analysiert die Veränderungen im Bereich der Magistraturen, des Senats, der Provinzverwaltung, des Rechtssystems, der Moralgesetzgebung und der religiösen Institutionen. Die Reform der Magistraturen wird detailliert dargestellt, wobei die Auswirkungen auf das politische System hervorgehoben werden. Die Senatsreform und die Neuordnung der Provinzverwaltung werden als wichtige Bestandteile der sullanischen Politik dargestellt, die das Gleichgewicht der Macht im römischen Staat verschieben sollten. Die Reformen des Rechtssystems und die moralischen Gesetze werden im Kontext der sullanischen Zielsetzung erörtert. Es wird die Bedeutung der religiösen Reformen für die Stabilität des Staates diskutiert, sowie die Auswirkungen auf die Militärstruktur Italiens.
Schlüsselwörter
Sulla, Diktatur, Römische Republik, Bürgerkrieg, Reformen, Proskriptionen, Magistraturen, Senat, Provinzverwaltung, Rechtsprechung, Moralgesetzgebung, Militär, Optimaten, Popularen, Mithridates, Hellenismus, Restauration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sulla und die Neuordnung des römischen Staates
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das politische Wirken des Lucius Cornelius Sulla zwischen 83 und 79 v. Chr. Der Fokus liegt auf seiner Rückkehr nach Italien, dem anschließenden Bürgerkrieg, seiner Machtübernahme, den berüchtigten Proskriptionen und insbesondere seiner Diktatur mit den damit verbundenen Reformen des römischen Staates. Die Arbeit beleuchtet auch die kontroverse wissenschaftliche Diskussion um Sullas Maßnahmen und die Interpretation seiner Absichten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert Sullas Rückkehr nach Italien und den Bürgerkrieg, die sullanischen Proskriptionen und ihre Folgen, die Reformen der römischen Magistraturen und des Senats unter Sulla, die Neuordnung der Provinzverwaltung und des Rechtssystems sowie Sullas Rücktritt und das Erbe seiner Diktatur. Es werden auch Sullas Kurzbiografie bis 83 v. Chr. und seine Reformen im Bereich des Religiösen, der Luxus- und Moralgesetzgebung und die Entmilitarisierung Italiens behandelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kurzbiografie Sullas bis 83 v. Chr., Sullas Rückkehr nach Italien und der Bürgerkrieg (83-81 v. Chr.), Die Proskriptionen und die Unterwerfung der letzten Gegner, Die Neuordnung des römischen Staates (Reformen der Magistraturen, des Senats, der Provinzverwaltung, des Rechtssystems, der Moralgesetzgebung und der religiösen Institutionen), und Sullas Rücktritt.
Welche Reformen Sullas werden behandelt?
Die Arbeit analysiert umfassend Sullas Reformen während seiner Diktatur. Im Einzelnen werden die Veränderungen in den Magistraturen (Volkstribunat, Quaestur, Prätoren, Cursus Honorum), im Senat, in der Provinzverwaltung, im Rechtssystem, in der Moralgesetzgebung und in den religiösen Institutionen behandelt. Die Auswirkungen dieser Reformen auf das politische System und das Machtgleichgewicht im römischen Staat werden detailliert untersucht.
Wie wird die wissenschaftliche Debatte um Sulla behandelt?
Die Arbeit thematisiert die kontroverse wissenschaftliche Diskussion um Sullas Neuordnung des römischen Staates und die Interpretation seiner Absichten. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und analysiert die verschiedenen Interpretationen seiner Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant zusammenfassen, sind: Sulla, Diktatur, Römische Republik, Bürgerkrieg, Reformen, Proskriptionen, Magistraturen, Senat, Provinzverwaltung, Rechtsprechung, Moralgesetzgebung, Militär, Optimaten, Popularen, Mithridates, Hellenismus, Restauration.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle gedacht, die sich für die römische Geschichte, insbesondere die Zeit der späten Republik, interessieren und detaillierte Informationen über das Leben und Wirken Sullas sowie seine Reformen suchen. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke und die Analyse historischer Themen.
- Arbeit zitieren
- Manfred Merkel (Autor:in), 2003, Sullas Diktatur - die Neuordnung der Römischen Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13823