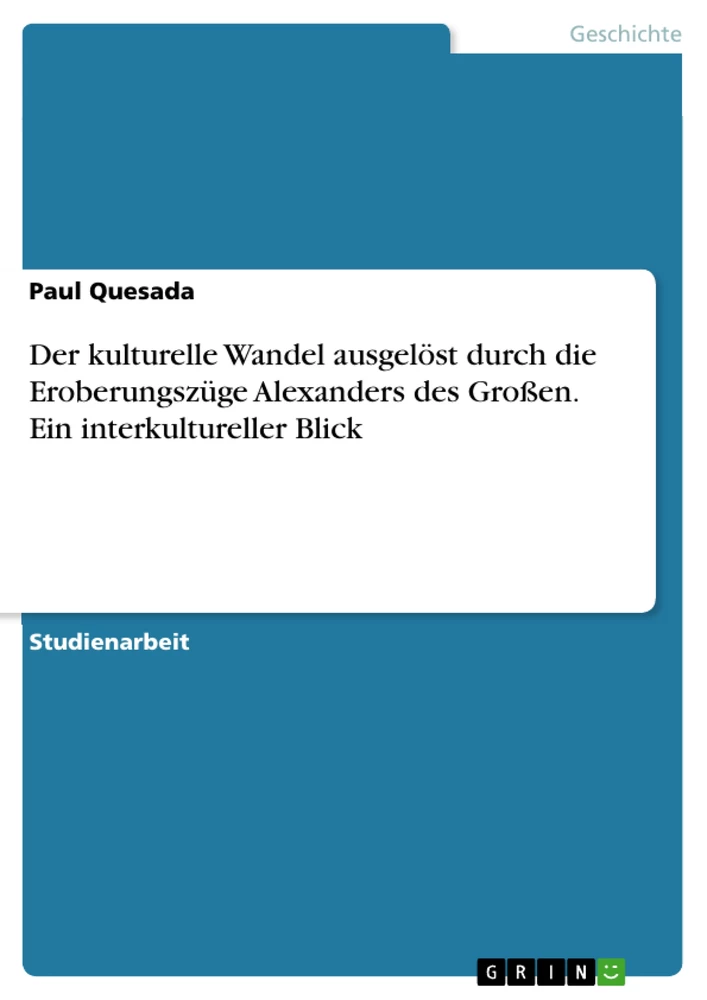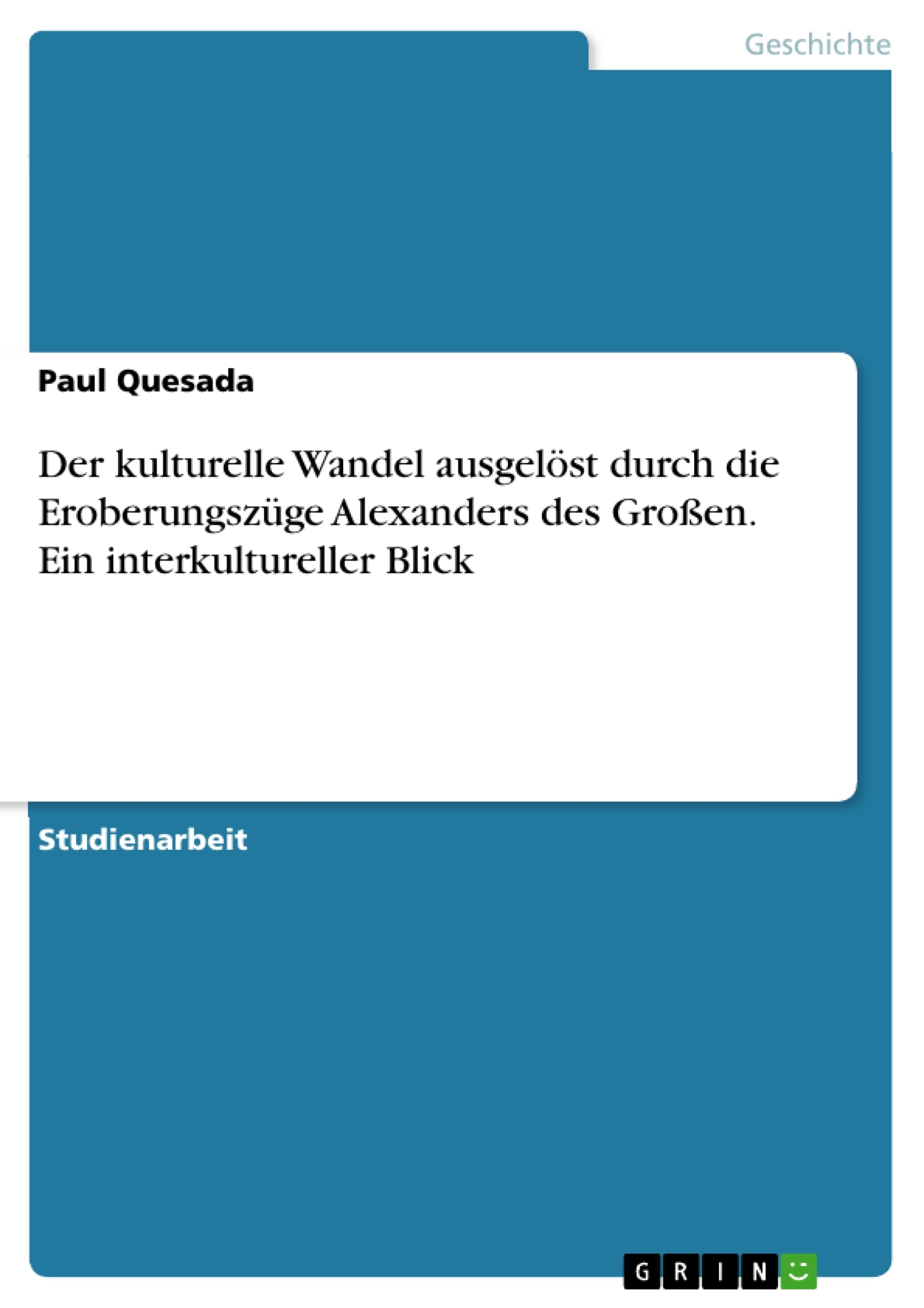Die Arbeit erforscht den durch die Eroberungszüge Alexanders des Großen ausgelöste kulturellen Wandel.
Stellt man heutzutage die Frage, was die Kultur eines Menschen ist, so verführt es einen wohl intuitiv zu einer Beantwortung, die den Begriff in Zusammenhang mit einer Nationalität oder Ethnie setzt. Diese Applikation des Kulturbegriffs auf ein bestimmtes Kollektiv ruft die Möglichkeit der Abgrenzbarkeit hervor , indem sich beispielsweise die französische Kultur von der deutschen unterscheidet. Erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts, mit der Entstehung des Nationalismus in Deutschland, wurde der Begriff zur Distinktion von anderen Staaten verwendet, während sich "Kultur" zuvor eher auf den Einzelmenschen bezog. Mit dem 20. Jahrhundert erweiterte sich die Perspektive und bezog nunmehr die "historische Spezifität der Lebensweise" mit ein. Der Kulturbegriff ließe sich nun, so der Kulturtheoretiker Stefan Rieger mit Herder, auf Gruppierungen jeglicher Größenordnungen applizieren und diene zur Definition charakteristischer Handlungsvorgänge sowie Formen der Lebensgestaltung, unter der Prämisse, dass jede Gruppe ihre eigene besitzt.
Dass Kultur nicht als derart abgeschlossenes Konstrukt verstanden werden kann, wie es diese Definitionsversuche nahelegen, soll in dieser Arbeit anhand des ausgelösten kulturellen Wandels durch die Eroberungszüge Alexanders des Großen im 4. Jh. v. Chr. gezeigt werden. Dazu soll dieser Komplex im Lichte der interkulturellen Forschung betrachtet werden, um die Frage zu beantworten, ob das, was man heutzutage als eine partikuläre Kultur annimmt, nur ein Produkt aus früheren kulturellen Vermischungen ist. Dazu soll in einem ersten theoretischen Teil die Forschung rund um Interkulturalität, Postkolonialismus und die Manifestation kulturellen Austauschs näher erläutert werden, um gemachte Beobachtungen auf das Kernthema um Alexander zu applizieren. Dieses soll zunächst damit eröffnet werden, den Charakter des Alexanders und seine Motivationen näher zu erläutern, welche als Grundstein für die stattgefundenen kulturellen Wechselwirkungen fungierten. Konkretisierungen seines Einflusses werden in einem Passus zur Münzprägung näher erläutert, die Auskunft darüber liefert, wie das Herrschervorbild des makedonischen Königs noch lange nach seiner Zeit rezipiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kultur als pluraletantum? - Interkulturalität
- 3. Wechselseitige Wirkung von Macht
- 4. Alexander der Große: Zwischen Eroberung und Erkundung
- 5. Der Beginn des kulturellen Wandels
- 6. Numismatik
- 7. Der frühe Buddhismus
- 8. Firdausis Schahnameh-Rezeption nach 1000 Jahren
- 9. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den kulturellen Wandel, der durch die Eroberungszüge Alexanders des Großen im 4. Jh. v. Chr. ausgelöst wurde. Der Fokus liegt dabei auf der interkulturellen Perspektive, um zu analysieren, ob heutige Kulturen lediglich Produkte früherer kultureller Vermischungen sind.
- Interkulturalität und der Wandel des Kulturbegriffs
- Die Rolle von Macht und Einfluss in der interkulturellen Interaktion
- Alexander der Große als Katalysator für kulturellen Austausch
- Numismatik als Spiegel der kulturellen Integration
- Der Einfluss Alexanders auf den frühen Buddhismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung erläutert die Problematik des Kulturbegriffs im Kontext von Nationalität und Ethnie und beleuchtet dessen historische Entwicklung. Sie führt den kulturellen Wandel durch Alexanders Eroberungen als Kern der Arbeit ein und skizziert den Forschungsansatz mit Fokus auf interkulturelle Zusammenhänge.
- Kapitel 2: Kultur als pluraletantum? - Interkulturalität: Dieses Kapitel problematisiert essentialistische Sichtweisen auf Kultur und stellt den Begriff der Multikulturalität in Frage. Es argumentiert für eine dynamische und prozessorientierte Betrachtung von Kultur im Kontext interkulturellen Austauschs.
- Kapitel 3: Wechselseitige Wirkung von Macht: Dieses Kapitel analysiert die Wechselwirkungen zwischen Macht und Kultur im Kontext interkultureller Beziehungen. Es untersucht, wie Machtstrukturen den kulturellen Austausch prägen und beeinflussen.
- Kapitel 4: Alexander der Große: Zwischen Eroberung und Erkundung: Dieses Kapitel stellt Alexander den Großen als zentrale Figur des kulturellen Wandels vor. Es beleuchtet seine Motivationen und Strategien und zeigt, wie er die kulturelle Landschaft des Mittelmeerraums beeinflusste.
- Kapitel 5: Der Beginn des kulturellen Wandels: Dieses Kapitel untersucht die konkreten Veränderungen, die durch Alexanders Eroberungen ausgelöst wurden. Es beleuchtet die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Kultur, wie zum Beispiel Sprache, Religion und Kunst.
- Kapitel 6: Numismatik: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Münzprägung im Kontext des kulturellen Wandels. Es zeigt, wie Alexanders Münzen als Mittel zur kulturellen Integration und zur Verbreitung seines Herrschervorbildes fungierten.
- Kapitel 7: Der frühe Buddhismus: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss Alexanders auf den frühen Buddhismus. Es analysiert, wie griechische Riten und Bräuche den Buddhismus beeinflussten und wie dieser Einfluss auf die Verbreitung der Religion wirkte.
- Kapitel 8: Firdausis Schahnameh-Rezeption nach 1000 Jahren: Dieses Kapitel betrachtet die Rezeption des Alexandermythos im Werk des persischen Dichters Firdausis. Es analysiert, wie Firdausis „Schahnameh“ die Alexandergeschichte mit arabischen Traditionen hybridisierte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Interkulturalität, kultureller Wandel, Alexander der Große, Eroberungen, Numismatik, Buddhismus, Firdausis Schahnameh, Macht, Einfluss, Geschichte und Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte Alexander der Große die Kultur des Mittelmeerraums?
Durch seine Eroberungszüge wirkte er als Katalysator für kulturelle Wechselwirkungen, die zur Vermischung griechischer und orientalischer Traditionen führten.
Welche Rolle spielt die Numismatik bei der Erforschung dieses Wandels?
Münzprägungen liefern wichtige Hinweise darauf, wie das Herrschervorbild Alexanders rezipiert wurde und wie kulturelle Integration durch wirtschaftliche Mittel stattfand.
Wie beeinflusste Alexander den frühen Buddhismus?
Die Arbeit analysiert, wie griechische Riten und Bräuche in den buddhistischen Kontext einflossen und die religiöse Praxis sowie Kunst beeinflussten.
Was bedeutet Interkulturalität im Kontext dieser Arbeit?
Interkulturalität wird hier als dynamischer Prozess verstanden, der zeigt, dass Kulturen keine abgeschlossenen Konstrukte, sondern Produkte früherer Vermischungen sind.
Was ist die „Schahnameh-Rezeption“?
Es handelt sich um die Verarbeitung des Alexandermythos im Werk des persischen Dichters Firdausi, der die Geschichte mit arabischen Traditionen hybridisierte.
- Arbeit zitieren
- Paul Quesada (Autor:in), 2023, Der kulturelle Wandel ausgelöst durch die Eroberungszüge Alexanders des Großen. Ein interkultureller Blick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1382898