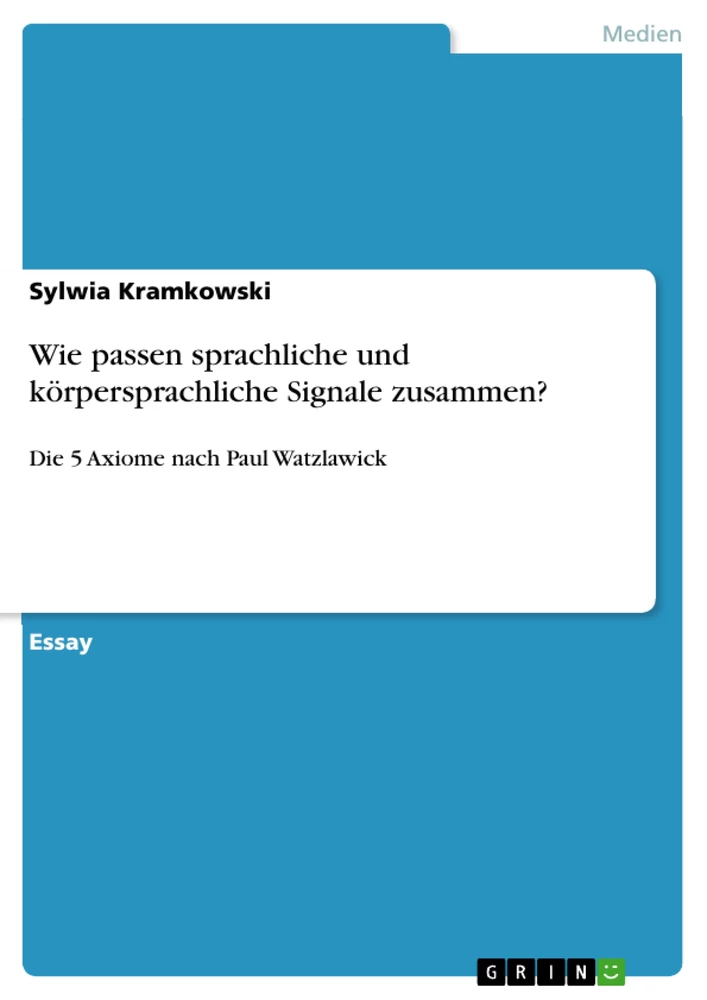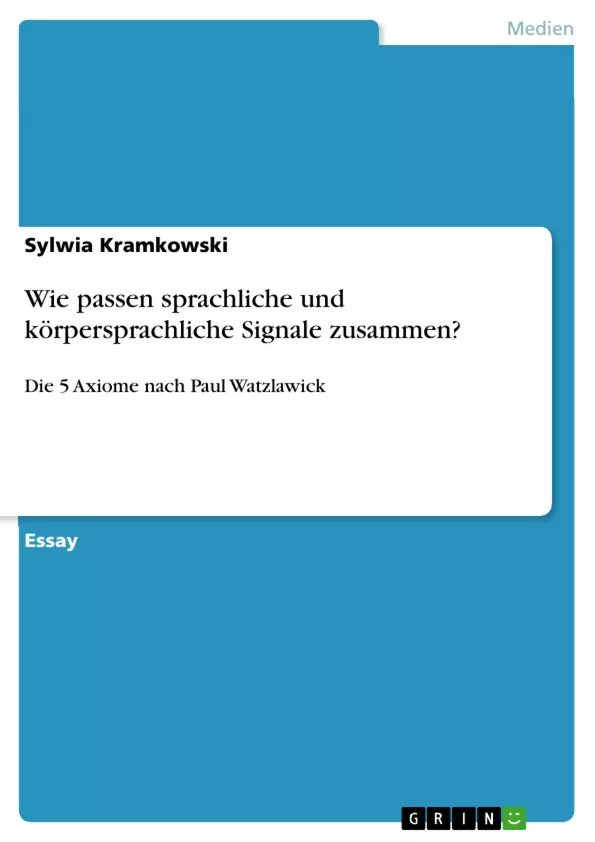Kommunikation erfolgt nicht lediglich über Sprache. Wesentlich älter als die Sprache ist die Körpersprache. Sie ist das älteste uns bekannte Kommunikationsmittel. Alte Ausprägungen der Körpersprache sind stark instinktgeleitet. Sie sind angeborene oder hoch automatisierte, überwiegend reaktionsgeleitete Verhaltensweisen. Beispielsweise wird ein vom Gegner angegriffener Boxer sehr wahrscheinlich in eine Schutzgeste, ein Zurückprallen verfallen. Über solche Dinge haben wir oft wenig Kontrolle, allerdings kann man auch hier Verhalten lernen und antrainieren: Beispielsweise wird in Frauenselbstverteidigungskursen den Frauen beigebracht, in bedrohlichen Situationen mit gewaltbereiten Männern nicht das "natürliche" Angst- und Opferverhalten zu zeigen, sondern selbstbewusst aufzutreten. Andere körpersprachliche Ausdruckselemente sind ähnlich wie Sprachzeichen festgelegt und müssen daher ähnlich wie Sprache gelernt werden. Ein Kopfschütteln oder Kopfnicken kann dann in jeweils verschiedenen Kulturen auch unterschiedliche Bedeutungen haben. So sind z. B. Begrüßungsgesten wie Händeschütteln oder Wangenküsse ebenfalls künstlich festgelegte bzw. „abgesprochene“ körpersprachliche Zeichen.
Den Hauptteil meines Essays möchte ich gerne mit einer Frage einleiten, die ich dann in den folgenden Abschnitten „Grundannahmen über Kommunikation“ sowie „Die 5 Axiome nach Watzlawick“ versuche zu beantworten. Das Fazit und meine während der thematischen Auseinandersetzung gewonnenen persönlichen Erkenntnisse runden schließlich die theoretische Darstellung ab und markieren gleichzeitig den Schlusspunkt der vorliegenden Arbeit.
1. Einführung
1.1 Einleitung zur Kommunikation
Kommunikation erfolgt nicht lediglich über Sprache.
Wesentlich älter als die Sprache ist die Körpersprache. Sie ist das älteste uns bekannte Kommunikationsmittel.
Alte Ausprägungen der Körpersprache sind stark instinktgeleitet. Sie sind angeborene oder hoch automatisierte, überwiegend reaktionsgeleitete Verhaltensweisen.
Beispielsweise wird ein vom Gegner angegriffener Boxer sehr wahrscheinlich in eine Schutzgeste, ein Zurückprallen verfallen.
Über solche Dinge haben wir oft wenig Kontrolle, allerdings kann man auch hier Verhalten lernen und antrainieren:
Beispielsweise wird in Frauenselbstverteidigungskursen den Frauen beigebracht, in bedrohlichen Situationen mit gewaltbereiten Männern nicht das "natürliche" Angst- und Opferverhalten zu zeigen, sondern selbstbewusst aufzutreten.
Andere körpersprachliche Ausdruckselemente sind ähnlich wie Sprachzeichen festgelegt und müssen daher ähnlich wie Sprache gelernt werden. Ein Kopfschütteln oder Kopfnicken kann dann in jeweils verschiedenen Kulturen auch unterschiedliche Bedeutungen haben.
So sind z. B. Begrüßungsgesten wie Händeschütteln oder Wangenküsse ebenfalls künstlich festgelegte bzw. „abgesprochene“ körpersprachliche Zeichen.
1.2 Übersicht
Den Hauptteil meines Essays möchte ich gerne mit einer Frage einleiten, die ich dann in den folgenden Abschnitten „Grundannahmen über Kommunikation“ sowie „Die 5 Axiome nach Watzlawick“ versuche zu beantworten.
Das Fazit und meine während der thematischen Auseinandersetzung gewonnenen persönlichen Erkenntnisse runden schließlich die theoretische Darstellung ab und markieren gleichzeitig den Schlusspunkt der vorliegenden Arbeit.
2. Hauptteil
2.1 Fragestellung
Wie passen sprachliche (verbale) und körpersprachliche (nonverbale) Signale zusammen?
Kann man diese unabhängig voneinander sehen oder stehen sie in einem ständigen Zusammenhang zueinander?
2.2 Grundannahmen über Kommunikation
Die Grundannahmen (Axiome) über das Gelingen und über Störungen in der Kommunikation sind nach Paul Watzlawick vorläufige Formulierungen, die aus sich selbst heraus verständlich sind.
Sie stellen die Wichtigkeit der Beziehungsebene in der Kommunikation dar. Auch zeigen sie, dass die Partner in der Regel in konstruierten, von ihnen selbst "erdachten" Wirklichkeiten leben und auf welch verschiedenen Arten Kommunikation abläuft.
Unter Kommunikation versteht Watzlawick nicht nur den reinen Austausch von Informationen, sondern auch das Miteinander in Verbindung treten, Sich- verständigen sowie Sich -verstehen.
Das bedeutet, dass Kommunikation nicht nur etwas mit Inhalten, sondern ebenso mit Appellen und Beziehungen zu tun hat.
Paul Watzlawick hat fünf Vorannahmen, so genannte Axiome, über Kommunikation(-sabläufe) aufgestellt.
2.3 Die fünf Axiome der menschlichen Kommunikation
1. Axiom: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“
Mit dieser Aussage drückt Watzlawick aus, dass es nicht möglich ist, sich dem Umgang mit dem anderen, der Kommunikation als solcher zu entziehen. Selbst wenn jemand die Kommunikation verweigert, findet dennoch eine Kommunikation statt.
Kommunikation hat laut Watzlawick zwei Grundaufgaben - zum einen die Bezeichnung eines Wissensgebietes und zum anderen die Benennung einer Verhaltenseinheit.
Dabei differenziert und definiert er diese Verhaltenseinheit genauer, indem er sagt: ,,Eine einzelne Kommunikation heißt Mitteilung, ein wechselseitiger Ablauf von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen wird als Interaktion bezeichnet." (vgl. Watzlawick 1996, S. 50 f.)
Zur Kommunikation gehört jedes Verhalten, das in zwischenmenschlichen Situationen Mitteilungscharakter hat. Dazu zählen nicht nur Worte, sondern auch paralinguistische Phänomene (Tonfall, Schnelligkeit, Pausen, Lachen, Seufzen), Körperhaltung, Körpersprache, Schweigen, Nichthandeln etc..
Bereits im ersten Axiom ist erkennbar, dass verbale und nonverbale Kommunikation nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. Beide stehen immer in Beziehung zueinander.
2. Axiom: Der Inhalts- und Beziehungsaspekt der Kommunikation
Bei der Betrachtung einer Mitteilung sind zwei Dinge erkennbar - zum einen der Inhaltsaspekt, der reine Informationen übermittelt, und zum anderen der Beziehungsaspekt.
Der Beziehungsaspekt in der Kommunikation zeigt, wie der Inhalt zu verstehen ist (Watzlawick 1996, S. 55). Das bedeutet, dass, selbst wenn wir lediglich über Sachverhalte sprechen, unsere Beziehung zu der anderen Person in Form einer Metakommunikation ausgedrückt wird (Watzlawick 1996, S. 56). Dabei drückt die Art und Weise wie wir mit der anderen Person sprechen unsere Einstellung zu ihr aus.
Wenn eine Beziehung spontan und „gesund“ ist, dann tritt die Gewichtung des Beziehungsaspekts eher in den Hintergrund.
Ist sie jedoch konfliktreich und „krank“, scheint der Beziehungsaspekt in dem Maße an Einfluss zu gewinnen, in dem der Inhaltsaspekt an Bedeutung verliert, und zwar stark.
Das 2. Axiom verstehe ich als Ergänzung zum 1. Axiom. Der Beziehungsaspekt wird nicht unbedingt verbal ausgedrückt, sondern vielmehr durch die bereits im ersten 1. Axiom genannten paralinguistischen Phänomene, Körperhaltung, Körpersprache, Schweigen etc..
So könnte z. B. Sympathie gegenüber einer Person durch eine zugewandte Körperhaltung und ein Lächeln ausgedrückt werden.
Wogegen Antipathie eher durch eine abgewandte Körperhaltung und einen starren Gesichtsausdruck ausgedrückt werden könnte.
3. Axiom: ,,Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt."
Dieses Axiom bezieht sich auf den Teil der Kommunikation, den Watzlawick als Interaktion definiert. Als unvoreingenommener Beobachter nehmen wir Kommunikation als einen ,,ununterbrochenen Austausch von Mitteilungen" (vgl. Watzlawick 1996, S. 57) wahr, bei der die jeweilige Mitteilung an den anderen sowohl Reaktion, Reiz als auch Verstärkung ist. Man könnte also sagen, dass die zwischenmenschliche Kommunikation kreisförmig verläuft.
Die Kommunizierenden selbst legen jedoch der Kommunikation eine Struktur zu Grunde. Für sie gibt es eine Gewichtung darauf, ,,wer angefangen hat" und ,,wer Schuld ist/hat". Sie gliedern die Ereignisse ihrer Interaktion somit in aller Regel kausal (ursächlich) und linear (geradlinig/temporär). Sie üben also eine Interpunktion von Ereignisfolgen aus, welche dadurch immer auch ein wichtiger Bestandteil von Beziehung und Kommunikation ist, da sie die Verhaltensweisen ordnet, organisiert und strukturiert. Die Interpunktions-weise ist oft kulturell überliefert und reguliert somit ,,Richtiges".
Zum Problem kann es werden, wenn den Kommunikationspartnern im Laufe der Interaktion die lineare oder kausale Struktur verloren geht.
4. Axiom: Digitale und analoge Kommunikation
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, in denen etwas dargestellt und damit zum Gegenstand von Kommunikation werden kann. Es läßt sich entweder analog (lat.: einem anderen vergleichbar) bezeichnen oder digital, also durch eine Gleichartigkeit übersetzen. Übertragen auf die menschliche Kommunikation entspricht laut Watzlawick die non-verbale Kommunikation der analogen und die verbale Sprache der digitalen Übertragungsweise. Beide Arten haben ihre Vorzüge.
analog = nonverbale Kommu.
digital = verbale Sprache
Die analoge Kommunikation hat eine allgemeinere Gültigkeit. Durch ihren direkten Ausdruck, z.B. über Kleidung, Gestik, Mimik, Stimmfall, Geruch usw., hat sie viel Aussagekraft, allerdings mangelt es ihr dafür an Eindeutigkeit. Wir können sie im gesunden Zustand mit all unseren Sinnen wahrnehmen und empfangen.
Digitale Kommunikation ist komplex, vielseitig und abstrakt, aber in Bezug auf die Mitteilung von Beziehungsaussagen eher unkonkret.
>> Überall, wo die Beziehung zum zentralen Thema der Kommunikation wird, erweist sich die verbale Kommunikation als fast bedeutungslos. << (vgl. Watzlawick 1996, S. 64)
Deshalb behauptet Watzlawick, dass der Beziehungsaspekt einer Mitteilung analog, der Inhaltsaspekt digital übermittelt wird.
analog = nonverbale Kommu. = Beziehung
digital = verbale Sprache = Inhalt
Im 4. Axiom betont Watzlawick die Bedeutsamkeit der nonverbalen Kommunikation. Durch diese wird die Beziehungsebene ausgedrückt, die wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Inhaltsebene hat.
5. Axiom: Symmetrische und komplementäre Interaktionen
Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär.
Beziehungsformen die symmetrisch sind, beruhen auf Gleichheit, z.B. zwischen Freunden, Kollegen, Liebespaaren usw.. Das Verhalten beider Personen spielt sich auf der gleichen Ebene, sinnbildlich gesehen also auf gleicher Augenhöhe ab. Hierbei verhalten sie sich spiegelbildlich. Symmetrische Beziehungen zeichnen sich folglich durch Streben nach Gleichheit und Verminderung von Unterschieden zwischen den Partnern aus (Watzlawick 1996, S. 69).
Komplementäre Beziehungsformen beruhen dagegen auf Ungleichheit, z.B. Eltern-Kind, Lehrer-Schüler, Chefin-Angestellter usw.. Hier gibt es zwei verschiedene Positionen: Ein Partner nimmt die sogenannte superiore, primäre Stellung ein, der andere die inferiore, sekundäre (Watzlawick 1996, S. 69). Dies ist jedoch keine Wertung hinsichtlich der unterschiedlichen Qualität der Positionen, denn die herrschenden Unterschiedlichkeiten ergänzen sich in ihrem Verhalten gegenseitig.
Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind also symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Ungleichheit beruht.
3. Schlussteil
3.1 Fazit
Die Antwort auf meine eingangs gestellte Frage, wie sprachliche und körpersprachliche Signale zueinander passen und ob man diese unabhängig voneinander sehen kann, finden sich vor allem in Watzlawicks 2. und 4. Axiom wieder.
In diesen wird laut Watzlawick der Sprache eine gewisse inhaltliche Wichtigkeit zugeschrieben wohingegen der Körpersprache, sowie anderen analogen Ausdrucksmitteln, wie z.B. die Satzmelodie und das Sprechtempo, eine fundamentale Wichtigkeit zugeteilt wird, die ganz besonders die Beziehungsebene zwischen zwei Personen erkennbar werden lässt.
Allgemein wird der Zusammenfall von sprachlicher und körpersprachlicher Aussage (d.h., entweder sind beide Botschaften gleich oder sie widersprechen sich zumindest nicht) als authentische Aussage angesehen.
Die Ausnahmen sind antrainierte körpersprachliche Signale, die dem Gegenüber den Eindruck von Authentizität suggerieren sollen.
Watzlawicks 5. Axiome stehen in einem engen Zusammenhang zueinander und dürfen nicht separat voneinander gesehen werden.
3.2 Schlusswort
Ich für meinen Teil ziehe aus diesen Erkenntnissen hinsichtlich meiner zukünftigen Arbeit in der Erwachsenenbildung folgendes.
Im Umgang mit anderen Menschen werde ich mich dazu anhalten, so authentisch wie möglich zu sein und nicht nur zu scheinen. Das heißt, dass sich meine verbale Kommunikation mit meiner nonverbalen decken bzw. diese ergänzen sollte, und umgekehrt. Es gilt, Widersprüche zwischen Gesagtem und Körpersprache weitestgehend zu vermeiden, denn nur so kann theoretisches Wissen wirklich glaubhaft vermittelt werden.
4. Quellen
Literatur:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text behandelt das Thema Kommunikation, insbesondere die Verbindung zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Er untersucht die Axiome der menschlichen Kommunikation nach Paul Watzlawick und deren Bedeutung für zwischenmenschliche Beziehungen.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind: Einleitung zur Kommunikation, Grundannahmen über Kommunikation, die fünf Axiome der menschlichen Kommunikation nach Watzlawick (Man kann nicht nicht kommunizieren; Inhalts- und Beziehungsaspekt der Kommunikation; Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt; Digitale und analoge Kommunikation; Symmetrische und komplementäre Interaktionen) und die Bedeutung von Authentizität in der Kommunikation.
Was sind die fünf Axiome der menschlichen Kommunikation nach Watzlawick?
Die fünf Axiome sind:
- Man kann nicht nicht kommunizieren.
- Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.
- Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.
- Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten.
- Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär.
Was bedeutet das Axiom "Man kann nicht nicht kommunizieren"?
Dieses Axiom bedeutet, dass jede Verhaltensweise in einer zwischenmenschlichen Situation als Kommunikation interpretiert werden kann, selbst wenn man sich bewusst nicht äußert oder zu entziehen versucht.
Was ist der Unterschied zwischen dem Inhalts- und Beziehungsaspekt der Kommunikation?
Der Inhaltsaspekt bezieht sich auf die reine Information, die vermittelt wird, während der Beziehungsaspekt ausdrückt, wie der Inhalt zu verstehen ist und welche Beziehung die Kommunikationspartner zueinander haben.
Was bedeutet "Interpunktion der Kommunikationsabläufe"?
Die Interpunktion bezieht sich darauf, wie die Kommunikationspartner den Kommunikationsablauf strukturieren und interpretieren, insbesondere wer "angefangen hat" oder "Schuld hat". Unterschiedliche Interpunktionen können zu Konflikten führen.
Was ist der Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation?
Digitale Kommunikation bezieht sich auf verbale Sprache, während analoge Kommunikation nonverbale Ausdrucksformen wie Körpersprache, Mimik und Tonfall umfasst. Der Beziehungsaspekt wird hauptsächlich durch analoge Kommunikation vermittelt, während der Inhaltsaspekt digital übermittelt wird.
Was sind symmetrische und komplementäre Interaktionen?
Symmetrische Interaktionen basieren auf Gleichheit zwischen den Partnern, während komplementäre Interaktionen auf Ungleichheit basieren, wobei ein Partner eine übergeordnete und der andere eine untergeordnete Position einnimmt.
Was ist die Schlussfolgerung des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass verbale und nonverbale Signale eng miteinander verbunden sind und nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Authentizität in der Kommunikation ist wichtig, und Widersprüche zwischen Gesagtem und Körpersprache sollten vermieden werden.
Welche Quelle wird im Text zitiert?
Die Quelle, die im Text zitiert wird, ist: Watzlawick, Paul; u.a.: Menschliche Kommunikation. Bern 1996
- Quote paper
- Sylwia Kramkowski (Author), 2007, Wie passen sprachliche und körpersprachliche Signale zusammen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138304