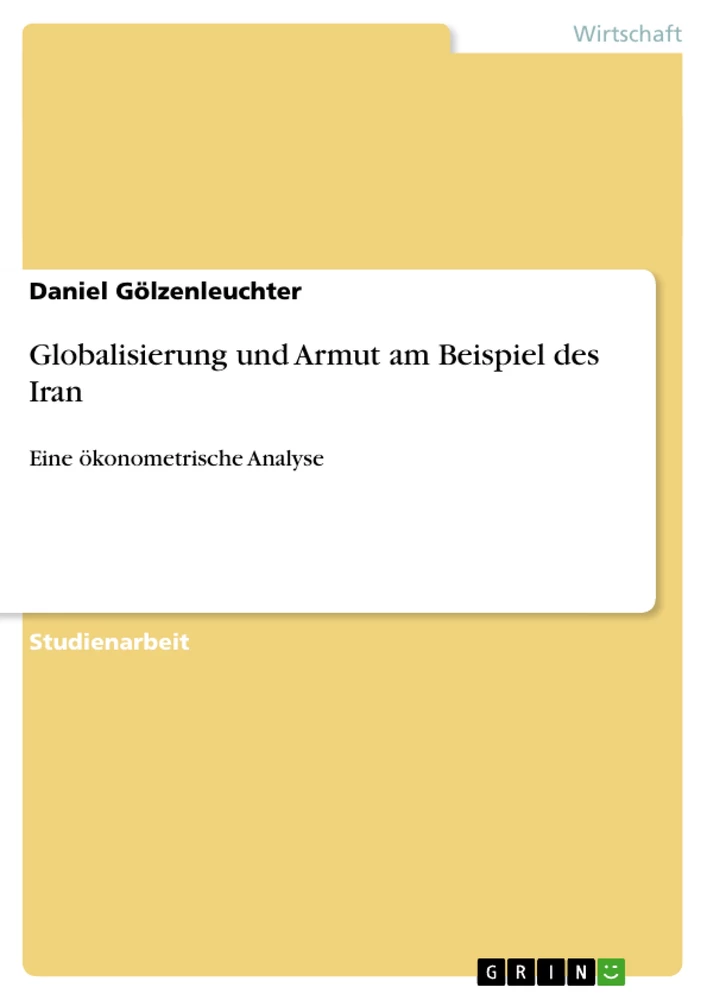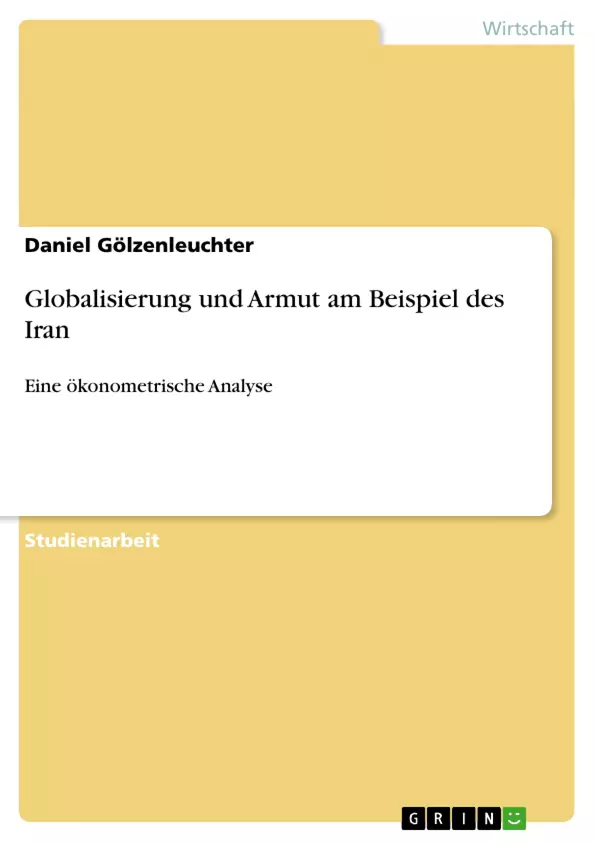Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Frage nach den Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensverteilung des Irans. Führte die Globalisierung zu steigender Ungleichheit zwischen
den Einkommensschichten oder trug sie zur Konvergenz der Einkommensniveaus bei? Die vermehrte internationale Verflochtenheit kann fallweise die Armut bzw. Umverteilung der Einkommen begünstigen. Dies tritt ein, wenn nicht alle Einkommensklassen in gleichem Maße von dem weltweiten Handel profitieren. Den nachstehenden Untersuchungen zufolge ist Armut bzw. Ungleichheit ein Produkt verschiedener Einflussfaktoren. Welche Variablen Armut hervorgerufen und welche sie verringert haben, soll in der folgenden Ausarbeitung untersucht werden.
Sohrab Behdad (1989) kam zu dem Resultat, dass die Umverteilungspolitik in den ersten Jahren der Revolution (1979-1981) die Einkommensungleichheit zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung reduzierte. Erst als sich die politische Situation im Land 1981 normalisierte, kehrte sich dieser Trend um, so dass die Ungleichheit wieder zunahm. Die vor der Revolution versprochenen (...) Ausmaß an wie kurz vor der Revolution.
Dagegen ist B.H. Zonooz (2005) der Auffassung, dass die positiven Grundgedanken der islamischen Revolution nicht konsequent umgesetzt wurden. Verteilungspolitische Maßnahmen zugunst8 (...) welche der Armut mit einem geringen Wirtschaftswachstum, höherer Inflation und steigender Arbeitslosigkeit Herr werden will.
Folgt man der WTO-Studie (2000)(...) Rechtsform und Sozialpolitik zielstrebig durchgeführt werden.
Die vorliegende Ausarbeitung gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst erläutert der zweite Abschnitt intensiv die Grundzüge der iranischen Wirtschaft und zeigt wichtige Entwicklungslinien auf. Ausgehend von theoretischen Erkenntnissen und Merkmalen der
Globalisierung stellt der dritte Abschnitt die für die Untersuchung notwendigen Daten vor. Mit Hilfe von zwei ökonometrischen Modellen untersucht der darauf folgende Abschnitt, in welchem Maße ein Zusammenhang zwischen Globalisierung und Armut besteht. Abschnitt fünf stellt das verwendete Messverfahren kurz vor. Im weiteren Verlauf werden die Schätzergebnisse inhaltlich diskutiert, kritisch hinterfragt und auf Robustheit sowie Zuverlässigkeit untersucht. Abschließend erfolgt im sechsten Abschnitt eine kurze Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Armut, Einkommensverteilung und Globalisierung
3. Datenverfügbarkeit
3.1 Globalisierungsvariablen
3.2 Nichtglobalisierungsvariablen
4. Ökonometrisches Modell
4.1 Ökonometrisches Modell für den AQI
4.2 Ökonometrisches Modell für den SPG
5. Ergebnisse
5.1 Ergebnisse des AQI – Modells
5.2 Ergebnisse des SPG - Modells
6. Schlussfolgerungen
7. Literatur
1. Einleitung
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Frage nach den Auswirkungen der Globalisierung auf die Einkommensverteilung des Irans. Führte die Globalisierung zu steigender Ungleichheit zwischen den Einkommensschichten oder trug sie zur Konvergenz der Einkommensniveaus bei? Die vermehrte internationale Verflochtenheit kann fallweise die Armut bzw. Umverteilung der Einkommen begünstigen. Dies tritt ein, wenn nicht alle Einkommensklassen in gleichem Maße von dem weltweiten Handel profitieren. Den nachstehenden Untersuchungen zufolge ist Armut bzw. Ungleichheit ein Produkt verschiedener Einflussfaktoren. Welche Variablen Armut hervorgerufen und welche sie verringert haben, soll in der folgenden Ausarbeitung untersucht werden.
Sohrab Behdad (1989) kam zu dem Resultat, dass die Umverteilungspolitik in den ersten Jahren der Revolution (1979-1981) die Einkommensungleichheit zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung reduzierte. Erst als sich die politische Situation im Land 1981 normalisierte, kehrte sich dieser Trend um, so dass die Ungleichheit wieder zunahm. Die vor der Revolution versprochenen Maßnahmen, wie die Schaffung von Gleichberechtigung und Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen für die Armen, verpufften im Zuge des Iran-Irak Krieges. Nach Sohrab Behdad (1989) wurden die Reichen reicher und die Armen ärmer. Die Kluft zwischen dem oberen und unteren Dezil der Einkommensverteilung nahm wieder annährend identisches Ausmaß an wie kurz vor der Revolution.
Dagegen ist B.H. Zonooz (2005) der Auffassung, dass die positiven Grundgedanken der islamischen Revolution nicht konsequent umgesetzt wurden. Verteilungspolitische Maßnahmen zugunsten der armen Bevölkerung wurden erfolglos durchgeführt. Die utopischen Strategien der iranischen Regierung mündeten vielmehr in einer ineffizienten Wirtschaftführung – gelenkt durch eine korrupte, islamisch orientierte, reiche Oberschicht, welche der Armut mit einem geringen Wirtschaftswachstum, höherer Inflation und steigender Arbeitslosigkeit Herr werden will.
Folgt man der WTO-Studie (2000), ist die Handelsliberalisierung eine bedeutende Komponente bei der Erhöhung des Wirtschaftswachstums und der Armutsbekämpfung. Allerdings ist ein liberaler Handel nicht allein fähig die Ungleichheit im Iran zu vermindern, vielmehr müssten gezielte Reformen in den Bereichen Infrastruktur, Ausbildung, Landverteilung, Rechtsform und Sozialpolitik zielstrebig durchgeführt werden.
Die vorliegende Ausarbeitung gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst erläutert der zweite Abschnitt intensiv die Grundzüge der iranischen Wirtschaft und zeigt wichtige Entwicklungslinien auf. Ausgehend von theoretischen Erkenntnissen und Merkmalen der Globalisierung stellt der dritte Abschnitt die für die Untersuchung notwendigen Daten vor. Mit Hilfe von zwei ökonometrischen Modellen untersucht der darauf folgende Abschnitt, in welchem Maße ein Zusammenhang zwischen Globalisierung und Armut besteht. Abschnitt fünf stellt das verwendete Messverfahren kurz vor. Im weiteren Verlauf werden die Schätzergebnisse inhaltlich diskutiert, kritisch hinterfragt und auf Robustheit sowie Zuverlässigkeit untersucht. Abschließend erfolgt im sechsten Abschnitt eine kurze Schlussbetrachtung.
2. Armut, Einkommensverteilung und Globalisierung
Nach der Bundesagentur für Außenwirtschaft (2007/2008) ist die iranische Wirtschaft durch eine enge und kaum durchschaubare Verknüpfung von halbstaatlichen Institutionen, Staatsbürokratie und Privatwirtschaft gekennzeichnet. Sie vereint plan- und marktwirtschaftliche Elemente. Ihre wichtigsten Wirtschaftsakteure sind die traditionellen sowie neuen Unternehmensgruppen, die Beauftragten des Staatssektors und die religiöse Oberschicht. Die iranische Regierung ist sehr bestrebt, den privaten Anteil an Unternehmen im Land spürbar zu erhöhen. Das Misstrauen privater Unternehmer ist das bedeutendste Hindernis im Privatisierungs- und Entwicklungsprozess. Um dem Misstrauen abzuhelfen, muss der Staat der Privatwirtschaft sowie den ausländischen Investoren mehr Sicherheiten und Perspektiven als bisher bieten.
Die höchsten Einnahmen generiert der Iran durch seine Ölexporte, etwa 25% des BIPs fallen auf den Öl- und Gassektor zurück. Gemessen an den Exporten machen die Ölausfuhren ca. 80% aus (vgl. bfai 2007/2008). Durch dauerhaft hohe Öleinnahmen ist auch in Zukunft das Funktionieren des Systems gesichert.
Grafik 1 zeigt die Preisentwicklung des Rohöls der letzten 38 Jahre. Die großen Schwankungen sind überwiegend auf politische Geschehnisse zurückzuführen. In den Jahren vor den Ölkrisen (1973 und 1978) ist der Ölpreis tendenziell gefallen, im Gegensatz dazu kehrte sich der Abwärtstrend nach den Krisenjahren um, zu beobachten ist ein stetig steigender Ölpreis. Während die Phase sinkender Rohölpreise (Mitte der 80er Jahre) den Globalisierungsprozess weltweit stark voran trieb, war sie für den Iran, dessen Hauptwirtschaftszweig in der Erdölausfuhr liegt, allerdings eher wachstumshemmend. Aufgrund von innenpolitischen Auseinandersetzungen und vor allem infolge des ausbrechenden Krieges mit dem Irak, brachen die Öleinnahmen ein. Geplante Subventionen zugunsten der ländlichen Bevölkerung, fielen auf Kosten des Krieges weg. Der Umverteilungsprozess kam zum erliegen, was sich besonders negativ auf die unteren Einkommensschichten auswirkte. Für den steigenden Rohölpreis (Ende der 90er Jahre) ist hauptsächlich der niedrige Preis der Vergangenheit verantwortlich (vgl. bpb 2006). Der verhältnismäßig niedrige Rohölpreis begünstigte den internationalen Handel und führte zu steigenden Wachstumsraten, was mit einer höheren Ölnachfrage stark wachsender Länder einherging.
Grafik 1: Ölpreis pro Barrel 1970 - 2007 zu konstanten Preisen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Base 1973=100 Based on weighted average index of currency exchange rates of the countries set forth in the modified Geneva I Agreement (see section on definitions). Source: OPEC.org
In Anbetracht des hohen Potenzials der iranischen Wirtschaft und den enormen Rohrstoffvorkommen, scheint der Markt für ausländische Investoren potentiell lukrativ zu sein. Allerdings konnten die vorhandenen Investitionsanreize die Unsicherheiten der letzten Jahrzehnte nicht wettmachen. Fehlende Rechtssicherheit, ein hoher Grad an Korruption und eine schlecht ausgebaute Infrastruktur hielten mögliche Investoren fern.
Um zu verstehen, warum der Iran heutzutage wachsende Ungleichheit und annähernd unveränderte Pro-Kopf-BIP Werte im Vergleich zu den Jahren vor der Revolution verzeichnet, dürfen die wirtschaftshistorischen Geschehnisse nicht außer Acht gelassen werden. Am deutlichsten lassen sich die krisenbehafteten Jahre und die dadurch herbeigeführte Umverteilung bzw. Einkommensminderung aller Schichten anhand des Pro-Kopf-BIPs veranschaulichen. In den Jahren vor der islamischen Revolution verzeichnete der Iran ein BIP Wachstum von über 6%, der Lebensstandard schien dauerhaft und ungebremst anzusteigen (vgl. Maddison Datensatz). Das Schah-Regime hatte versucht, das Land durch gestiegene Öleinnahmen und mit Hilfe der westlichen Welt in einen modernen Industriestaat zu verwandeln. Die späteren politischen Ungleichgewichte fegten wie eine Katastrophe über das Land hinweg und machten alle Bestrebungen zunichte.
Grafik 2 zeigt den Aufstieg und Fall des Pro-Kopf BIPs im Zeitraum von 1970 - 2000. Djavad Salehi-Isfahani (2006) sieht den wirtschaftlichen Niedergang des Irans in mindestens zwei eng verbundenen Phasen. Auf der einen Seite löste die islamische Revolution von 1978 zahlreiche Unruhen aus, sie veränderte die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände derart, dass nach kurzer Zeit die Wirtschaft fast zum Erliegen kam. Zahlreiche große Unternehmen, sowie Banken und Versicherungen wurden verstaatlicht. Ausländische Investoren zogen sich zurück und mieden das Land, weiterhin wurde der Außenhandel auf ein Minimum reduziert. Auf der anderen Seite folgte im Jahr der Revolution die irakische Invasion und eine damit verbundene achtjährige Zerstörung der Wirtschaft und Infrastruktur. Der Ölpreisabsturz im Jahr 1986 sorgte zu guter letzt dafür, dass die Einnahmen aus dem wichtigsten Exportgut einbrachen. Das Pro-Kopf BIP war nur noch halb so groß wie in den Jahren vor der Revolution. Mit Ausnahme von 1996, befindet sich das Pro-Kopf-BIP seit 1989 auf einem Wachstumspfad, der ständige Wechsel von Aufschwung, Krise und Niedergang scheint ein Ende gefunden zu haben.
Grafik 2: Pro-Kopf BIP von 1970 - 2000
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Datenquelle: Sala-i-Martin Einkommenstabelle. Angabe in PPP bereinigten USD
Grafik 3 zeigt die Einkommensverteilung nach Sala-i-Martin (2005) für 1970, 1980, 1990 und 2000 mit einer Einkommensgrenze von 1.097 $ pro Jahr (entspricht 3$ pro Tag). Im Jahr 1970 lag ein geringer Teil der Verteilung auf der linken Seite, steigende BIP Wachstumsraten bedeuteten höhere Einkommen und sinkende Ungleichheit. Aufgrund politischer Unruhen und den darauf folgenden Kriegsjahren verschob sich die Kurve weiter nach links - Einkommensungleichheit und die Anzahl der Menschen unterhalb der Armutsgrenze stiegen drastisch an. Erst ab 1990 ist eine Rechtsverschiebung der Kurve zu beobachten, was auf eine Erholung der Einkommen hindeutet. Allerdings scheint die ungleiche Einkommensverteilung annähernd gleich zu bleiben, die Anzahl der Bevölkerung mit höheren Einkommen hat im Verhältnis zu den Armen entsprechend stark zugenommen. Einen weiteren Punkt stellt der zweite Hügel dar: Quah (1996) stellte fest, dass durch Verschiebung der Pro-Kopf-Einkommen sich eine sogenannte „Twin-Peaks“ Verteilung herausbildet. Die Einkommen haben sich polarisiert und es sind zwei Hügel entstanden. Der linke Hügel umfasst die Bevölkerung unteren bzw. mittleren Einkommens. Der sich im Zeitverlauf immer stärker herausbildende rechte Hügel, impliziert die Herausbildung einer neuen reichen Oberschicht. Welche Auswirkung diese Verschiebung zugunsten der wohlhabenden Bevölkerung hatte, wird später noch genauer erläutert.
Grafik 3: Einkommensverteilung nach Sala-i-Martin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Einkommensdaten aus dem Sala-i-Martin Datensatz. Eigene Darstellung. Armutsgrenze Worldbank
Um eine zuverlässige Aussage über die Armut- bzw. die Einkommensverteilung machen zu können, muss zwischen zwei Phasen differenziert werden. Zum einen die Zeit vor und zum anderen nach der islamischen Revolution. Grafik 4 zeigt die Entwicklung des Gini- Koeffizienten über den Zeitraum von 1970 bis 2002. Die größte Verschiebung der Einkommensverteilung, zugunsten der armen Bevölkerung, ist in den Jahren vor der islamischen Revolution zu beobachten (vgl. WDI Daten). Gestiegene Ölpreise und die daraus resultierenden höheren Einnahmen, führten zu enormen Umverteilungsprozessen. Die im Zuge der Revolution durchgeführten verteilungspolitischen Interventionen hatten bis 1981 dazu geführt, dass es zu einer Angleichung der Einkommensschichten kam (vgl. Sohrab Behdad 1989 S. 327 ff.), was als Folge die Kluft schmälerte. Aus der Grafik 4 ist dies jedoch nicht ersichtlich, zwischen 1974 und 1981 stieg der Gini - Koeffizient von 0,438 auf 0,44, wobei der Unterschied in den WDI Daten noch stärker ausfällt. Entgegen der Untersuchung von Sohrab Behdad (1989) deutet dies auf eine gestiegene Ungleichheit hin. Während den Kriegsjahren blieb der Gini - Koeffizient annähernd konstant auf seinem hohen Niveau. Folgt man den WDI Daten, scheint die Phase niedriger Ölpreise (Mitte der 80er Jahre) die Ungleichheit vermindert zu haben. An dieser Stelle lässt sich eine wage Vermutung äußern. Es scheint so, als ob Phasen sinkender Rohölpreise mit Phasen sinkender Ungleichheit einhergehen oder zumindest bleibt die Ungleichheit unverändert auf ihrem Niveau bestehen. Ob dieser Zusammenhang bestätigt oder entkräftet werden kann, behandelt der 5. Abschnitt.
Grafik 4: Gini - Index von 1970 - 2002
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkung: Aufgrund von unplausiblen Ergebnissen aus dem Sala-i-Martin Datensatz wurden zusätzlich die Daten aus folgenden Quellen herangezogen: World Income Inequality Database V2.0c May 2008 und Worldbank.org. Die Daten beruhen auf Schätzungen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich die Globalisierung auf die Armut im Iran aus?
Die Auswirkungen sind komplex; internationale Verflechtung kann Armut verringern oder begünstigen, je nachdem, welche Einkommensschichten vom Handel profitieren.
Welche Rolle spielen die Öleinnahmen für die iranische Wirtschaft?
Ölexporte machen ca. 80 % der Exporte und etwa 25 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus und sichern das Funktionieren des Systems.
Was behindert private Investitionen im Iran?
Fehlende Rechtssicherheit, hohe Korruption, eine intransparente Staatsbürokratie und eine schlecht ausgebaute Infrastruktur schrecken Investoren ab.
Wie entwickelte sich die Einkommensungleichheit nach der Revolution 1979?
Anfänglich reduzierte die Umverteilungspolitik die Ungleichheit, doch ab 1981 kehrte sich dieser Trend um, und die Kluft zwischen Arm und Reich nahm wieder zu.
Kann Handelsliberalisierung allein die Armut im Iran besiegen?
Laut WTO-Studien ist sie wichtig, muss aber durch Reformen in der Ausbildung, Landverteilung und Sozialpolitik ergänzt werden.
- Arbeit zitieren
- Daniel Gölzenleuchter (Autor:in), 2009, Globalisierung und Armut am Beispiel des Iran, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138367