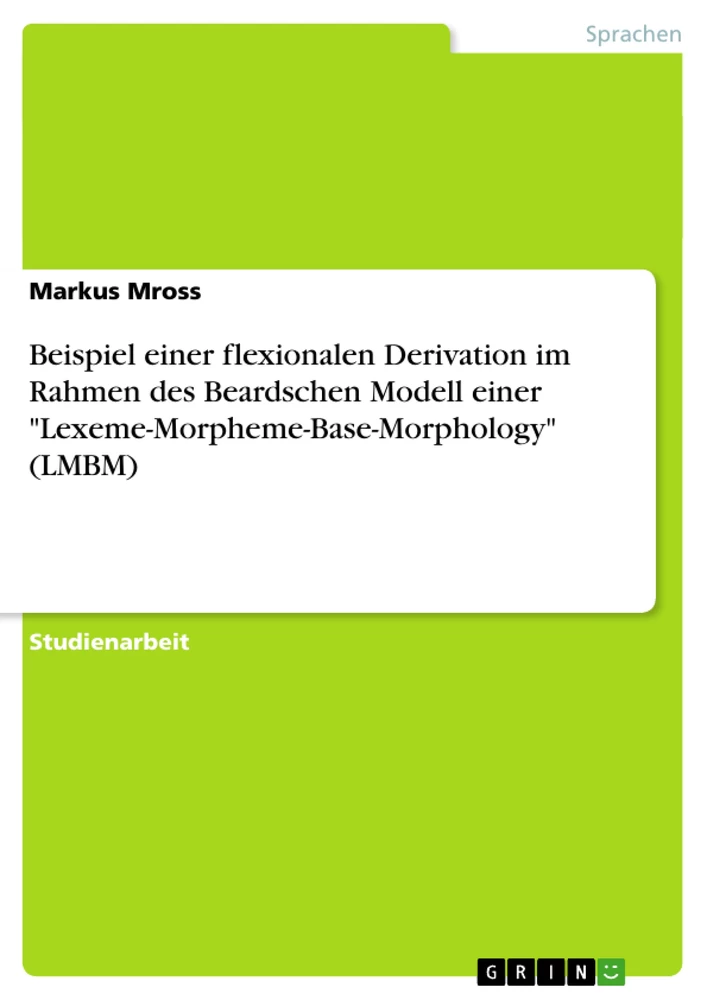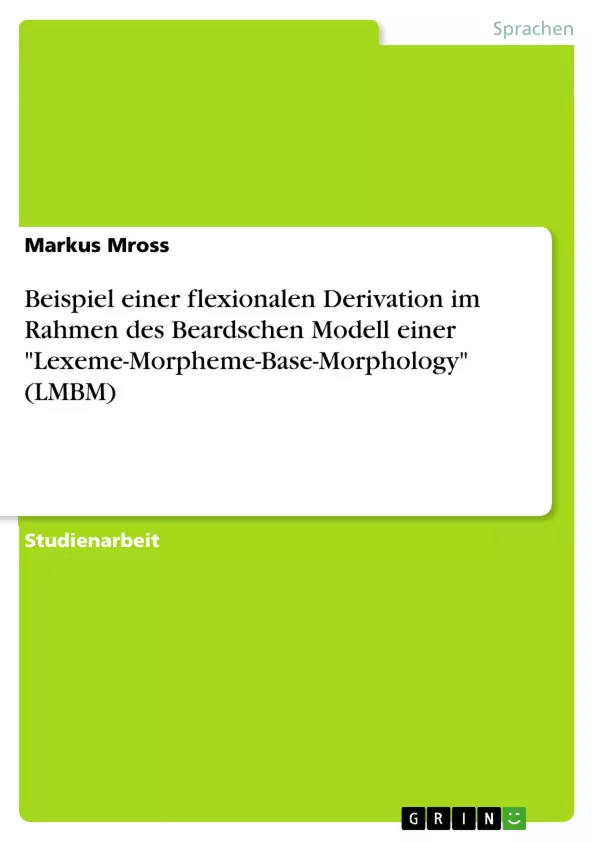Ich werde im folgenden die Derivation des französischen Satzes „Pierre chantera
cette chanson“ innerhalb des von Beard (1995) vorgeschlagenen LMBM-Modells
aufzeigen. Den zentralen Punkt meiner Darstellung bildet dabei die Derivation der
Form des flektierten Verbes „chantera“. Weiterhin werde ich versuchen, das Zusammenwirken
der autonomen grammatischen Module bei der Derivation dieses
Satzes innerhalb des Beardschen LMBM-Modells schrittweise dazustellen.
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise dieser autonomen grammatischen
Module im Beardschen LMBM-Modell halte ich es für notwendig, auf die Basisprinzipien
einzugehen, auf welche sich Beard bei der Konzeption dieser grammatischen
Module stützt. Daher werde ich eingangs die Ableitung des Aufbaus der
grammatischen Module von den grundlegenden Basisprinzipien kurz umreißen.
Ich werde auf die Konsequenzen, welche sich aus den Basisprinzipien für Beards
Konzeption der grammatischen Module in seinem LMBM-Modell ergeben, bei
der schrittweisen Derivation des Satzes „Pierre chantera cette chanson“ differenzierter
eingehen. Die Basisprinzipien, auf die Beard sein LMBM-Modell gründet, sind die „Separation
Hypothesis“, die „Split Morphology Hypothesis“ („Lexicalist Hypothesis“/
„Lexical Integrity Hypothesis“) sowie die von Beard selbst definierten fünf Grundprinzipien.
Ich werde im folgenden auf diese beiden Hypothesen sowie auf zwei
seiner Grundprinzipien eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Basisprinzipien des Beardschen LMBM-Modells
- Die Separationshypothese
- Das erste Grundprinzip Beards
- Die „Split-Morphology-Hypothesis“
- Das vierte Grundprinzip Beards
- Die Derivation der Form des flektierten Verbes „chantera“ innerhalb des Beardschen LMBM-Modells
- Die Merkmalsmatrix der Form des flektierten Verbes „chantera“
- Beards Konzeption von Flexion als syntaktischem Interpretationsmechanismus von morpholexikalischen Kategoriemerkmalen
- Beards Unterteilung von grammatischen Kategorien in lexikalische und flexionale Kategorien
- Die flexionale Kategorie „Agreement“ als syntaktischer Interpretationsmechanismus von morpholexikalischen Merkmalen
- Die graphische Darstellung von Agreementfunktionen und flexionalen Kategoriemerkmalen in der Syntax
- Die Tilgung von syntaktischen Klammern und Verbanhebung durch die MS-Komponente
- Die Spelling-Operationen der MS-Komponente
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Derivation des französischen Verbs „chantera“ im Rahmen des von Beard entwickelten Lexeme-Morpheme-Base-Morphology (LMBM)-Modells. Das Ziel ist es, die Funktionsweise der autonomen grammatischen Module innerhalb dieses Modells anhand dieses Beispiels zu veranschaulichen und die Zusammenhänge zwischen den Basisprinzipien des Modells und der konkreten Derivation aufzuzeigen.
- Das Beardsche LMBM-Modell und seine Basisprinzipien
- Die Separationshypothese und die Unterscheidung zwischen Derivation und morphologischem Spelling
- Die Anwendung des Modells auf die Derivation des Verbs „chantera“
- Die Rolle der MS-Komponente im morphologischen Spelling
- Die Interaktion der verschiedenen grammatischen Module
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Derivation des französischen Satzes „Pierre chantera cette chanson“ im LMBM-Modell, insbesondere die Derivation von „chantera“. Sie begründet die Notwendigkeit, die Basisprinzipien des Modells vor der detaillierten Analyse zu erläutern, um ein besseres Verständnis der Funktionsweise der grammatischen Module zu gewährleisten. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die schrittweise Darstellung des Zusammenwirkens der autonomen Module.
2. Die Basisprinzipien des Beardschen LMBM-Modells: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien des LMBM-Modells, auf denen Beards Modell basiert. Es beschreibt die Separationshypothese, die eine strikte Trennung zwischen der Derivation grammatischer Merkmale und deren Markierung durch grammatische Morpheme postuliert. Die Morphological Spelling (MS)-Komponente wird als eigenständiges Modul eingeführt, welches unabhängig von Derivationsregeln auf den Output der Merkmalsderivation operiert. Weiterhin wird Beards erstes Grundprinzip vorgestellt, welches Lexeme als wechselseitig implizierte phonologische, grammatische und semantische Repräsentationen definiert, im Gegensatz zu grammatischen Morphemen, die als kontextabhängige Mittel der Referenz beschrieben werden. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die theoretischen Grundlagen des Modells detailliert darstellt.
Schlüsselwörter
Lexeme-Morpheme-Base-Morphology (LMBM), Separationshypothese, Split-Morphology-Hypothesis, Morphologisches Spelling, MS-Komponente, Derivation, Flexion, grammatische Morpheme, Lexem, französische Grammatik, „chantera“
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Derivation des Verbs „chantera“ im LMBM-Modell
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Derivation des französischen Verbs „chantera“ im Rahmen des Lexeme-Morpheme-Base-Morphology (LMBM)-Modells von Beard. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der Funktionsweise der autonomen grammatischen Module dieses Modells anhand dieses konkreten Beispiels und der Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Basisprinzipien des Modells und der Derivation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Basisprinzipien des Beardschen LMBM-Modells, insbesondere die Separationshypothese und die Unterscheidung zwischen Derivation und morphologischem Spelling. Im Detail wird die Anwendung des Modells auf die Derivation von „chantera“ analysiert, wobei die Rolle der MS-Komponente und die Interaktion der verschiedenen grammatischen Module im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit erläutert auch Beards Konzeption von Flexion als syntaktischen Interpretationsmechanismus morpholexikalischer Kategoriemerkmale und die Unterteilung grammatischer Kategorien in lexikalische und flexionale Kategorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Basisprinzipien des LMBM-Modells (einschließlich Separationshypothese, Beards Grundprinzipien und der „Split-Morphology-Hypothesis“), ein Kapitel zur Derivation von „chantera“ innerhalb des LMBM-Modells (mit detaillierter Analyse der Merkmalsmatrix, Agreementfunktionen und der Rolle der MS-Komponente) und eine Bibliographie.
Was sind die zentralen Prinzipien des LMBM-Modells, die in der Arbeit erläutert werden?
Die Arbeit erklärt die Separationshypothese, die eine strikte Trennung zwischen der Derivation grammatischer Merkmale und deren Markierung durch grammatische Morpheme postuliert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beschreibung der MS-Komponente als eigenständiges Modul, das unabhängig von Derivationsregeln auf den Output der Merkmalsderivation operiert. Schließlich werden Beards Grundprinzipien erläutert, insbesondere die Definition von Lexemen als wechselseitig implizierte phonologische, grammatische und semantische Repräsentationen im Gegensatz zu grammatischen Morphemen als kontextabhängige Mittel der Referenz.
Welche Rolle spielt die MS-Komponente?
Die MS-Komponente im LMBM-Modell ist ein eigenständiges Modul, das für das morphologische Spelling verantwortlich ist. Sie operiert unabhängig von den Derivationsregeln und verarbeitet den Output der Merkmalsderivation, um die Oberflächenform des Wortes zu erzeugen. In der Analyse von „chantera“ werden die Spelling-Operationen der MS-Komponente detailliert beschrieben, einschließlich der Tilgung von syntaktischen Klammern und Verbanhebung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Lexeme-Morpheme-Base-Morphology (LMBM), Separationshypothese, Split-Morphology-Hypothesis, Morphologisches Spelling, MS-Komponente, Derivation, Flexion, grammatische Morpheme, Lexem, französische Grammatik, „chantera“.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise der autonomen grammatischen Module innerhalb des LMBM-Modells anhand der Derivation des Verbs „chantera“ zu veranschaulichen und die Zusammenhänge zwischen den Basisprinzipien des Modells und der konkreten Derivation aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Markus Mross (Auteur), 1997, Beispiel einer flexionalen Derivation im Rahmen des Beardschen Modell einer "Lexeme-Morpheme-Base-Morphology" (LMBM), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13840