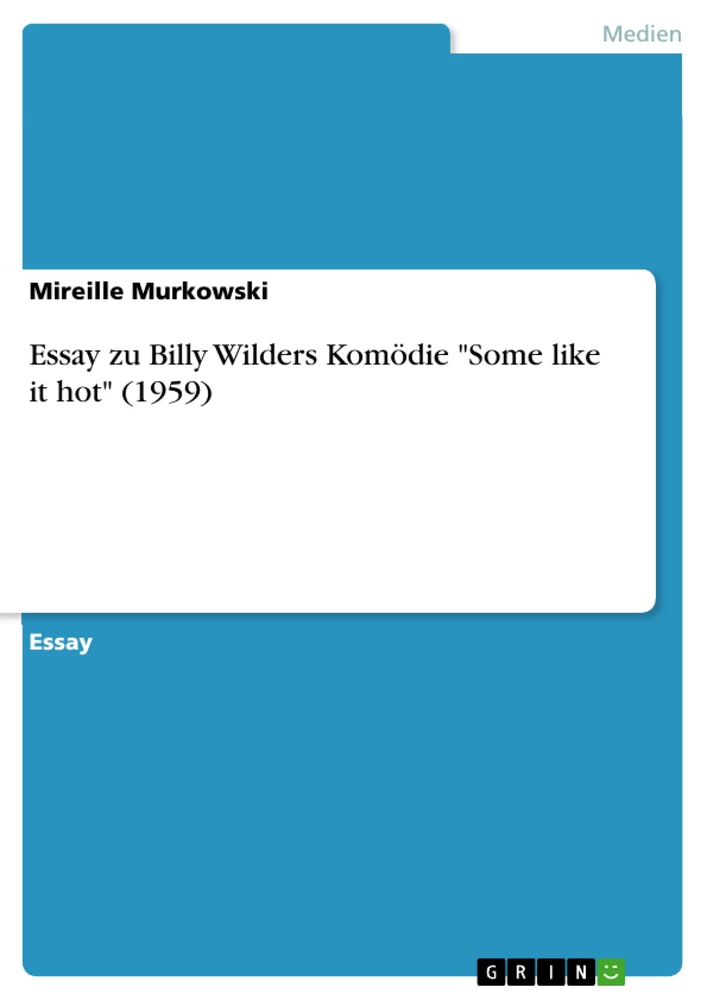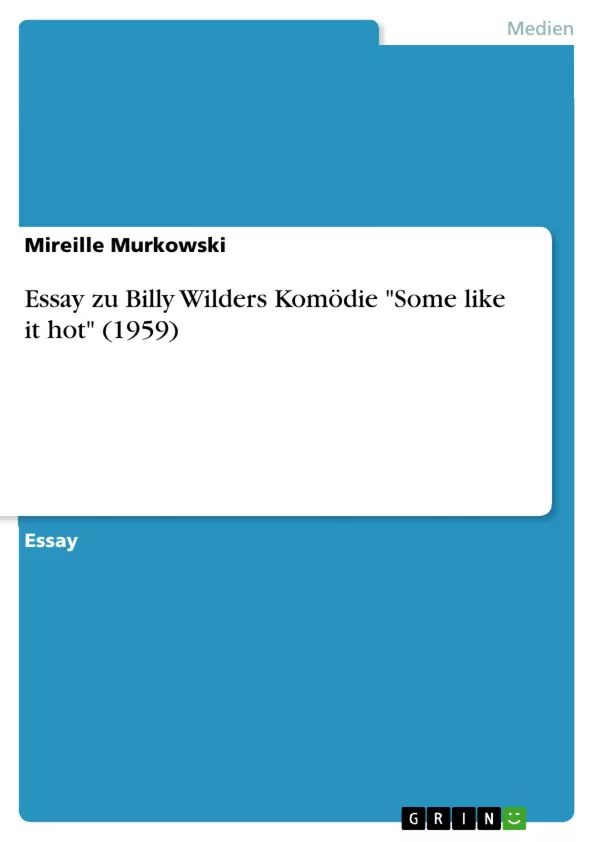Wie die Sexcomedy der 50iger Jahre, die sich zunehmend dem Production Code mit seinen moralischen Restriktionen widersetzte, spielt Billy Wilders Travestiekomödie "Some like it hot"
auf eine heitere frech-frivole Art ihr Spiel mit sexuellen Differenzen, mit romantischen Fantasien und deren Spannung zwischen Begehren und Erfüllung und der dabei durch
unfreiwilligen Rollentausch ins Wanken geratenden Geschlechterordnung. Die Komik entsteht dabei nicht nur durch das Rollenspiel und seine unvermeidliche, für den Zuschauer vorhersehbare Enttarnung, sondern auch über den mehrdeutigen Wort-und Sprachwitz und die Parodie sexueller Stereotypen.
Filmische Gestaltungsmittel wie Schnitt und Montage oder die Musik als narratives Element ordnen sich ganz dem Kontinuitätsprinzip Hollywoods unter, um den narrativen Fluss der Handlung nicht zu unterbrechen.
Some like it hot (Billy Wilder, 1959)
Wie die Sexcomedy der 50iger Jahre, die sich zunehmend dem Production Code mit seinen moralischen Restriktionen widersetzte, spielt Billy Wilders Travestiekomödie Some like it hot auf eine heitere frech-frivole Art ihr Spiel mit sexuellen Differenzen, mit romantischen Fantasien und deren Spannung zwischen Begehren und Erfüllung und der dabei durch unfreiwilligen Rollentausch ins Wanken geratenden Geschlechterordnung.
Eingebettet in die Prohibitionszeit von 1929, werden die Hauptfiguren Joe und Jerry, zwei mittellose Musiker auf eine Reise geschickt, die vielmehr eine Flucht vor Chicagoer Gangstern darstellt. Als einzige Chance diesen zu entkommen, nehmen Joe und Jerry als Damen verkleidet das Engagement in einer, mit ausschliei3lich weiblichen Mitgliedern besetzten Jazzband an. Die unweigerlich auftretenden Spannungen zwischen der eigenen, jetzt verborgenen sexuellen Identität und der völlig konträren nach aui3en verkörperten Geschlechterrolle werden auf der linearen Narrationsebene an den aufeinander folgenden Orten während der Zugfahrt nach Florida und im dortigen Hotel thematisiert. In dieser Damenband treffen nun Joe, als die Saxofon spielende Josephine und Jerry als die Bassgeige Daphne auf Sugar, die sich ebenfalls auf der Flucht befindet. Jedoch vor Saxofonisten, um in Florida nur ein Ziel zu verfolgen, den netten Millionär mit eigener Yacht zu finden, in welche Rolle Joe nun zusätzlich schlüpft. Gleichzeitig werden Josephine und Daphne nun mit den anzüglichen Annäherungsversuchen ihrer Geschlechtsgenossen konfrontiert und ihr Rollenspiel damit konterkariert.
Die Komik entsteht dabei nicht nur durch das Rollenspiel und seine unvermeidliche, für den Zuschauer vorhersehbare Enttarnung, sondern auch über den mehrdeutigen Wort- und Sprachwitz und die Parodie sexueller Stereotypen. Sowohl das rohe Maskuline, verkörpert von den Chicagoer Gangstern mit ausgeprägtem Hang zur Gewalt, als auch das vermeintlich dumme „Blondchen“ werden klischéehaft augenzwinkernd in Szene gesetzt.
Eine spannungsaufbauende Erzählstruktur wird dabei durch den Wechsel von Etablierung einer Ordnung und dem sich anschliei3enden Chaos erreicht. Während die Flucht der beiden Musiker vor den Chicagoer Gangstern zunächst mit dem Rollentausch und dem Unterschlupf in einer Damenband beendet scheint, entwickelt sich gleichzeitig eine neue, jedoch sehr instabile Ordnung, die von ständiger Aufdeckung der männlichen Identität bedroht ist und durch das erneute Auftauchen der Gangster wieder zur Flucht und zum Chaos ffihrt. Eine Auflösung dieser narrativen Spannung wird schließlich nur teilweise angeboten, da sich die Figuren, noch immer auf der Flucht, durch das Lösen von ihren romantischen Fantasien bereits wieder in eine neue chaotische Ordnung zu begeben scheinen, Sugar mit dem mittellosen Saxofonspieler Joe und Jerry mit einem echten Millionär als „unperfektes“ Paar.
Die filmischen Gestaltungsmittel ordnen sich dabei ganz dem Kontinuitätsprinzip Hollywoods unter. Um den narrativen Fluss der Handlung nicht zu unterbrechen, sind Schnitt und Montage kaum spfirbar, verschwinden ffir den Zuschauer hinter der Erzählung.
Dabei erhält die OFF- Musik sowohl eine narrative als auch die Szenen einleitende und verknfipfende Funktion. So ist beispielsweise während der Zugfahrt beim Blick auf die sich im Takt bewegenden und dampfenden Zugräder bereits die Jazzmusik aus dem OFF zu hören, welche sich dann als ON-Musik der Bandprobe im Zugabteil fiber einen establishing shot präsentiert. Per Achsensprung wird dem Zuschauer zur Orientierung der Blick auf die dirigierende Sweet Sue aus Sicht der spielenden Band gezeigt, um auf den Dialog zwischen ihr und den neuen Bandmitgliedern vorzubereiten. Die Dialoge werden sowohl mit overshoulder- Blick als auch im Schuss-Gegenschuss- Verfahren realisiert, dabei schaffen sanfte Zooms bis zur Nahaufnahme eine intime Nähe und lassen die Mimik der Figuren deutlicher hervortreten sowie durch ein zusätzliches Gegenlicht Sugars Haar heller leuchten. Eine subjektive Perspektive der Figuren Josephine und Daphne wird dabei fiber eyeline matches suggeriert, welche die männlich intendierte Sicht von Joe oder Jerry offenbaren, dabei Detailaufnahmen, wie Sugars im Strumpfband verschwindende Whiskyflasche oder die sich wie Göttespeise bewegenden Beine zeigen.
Über die Musik als narratives Element sind den einzelnen Figuren jeweils charakterisierende musikalische Motive zugeordnet, die sich je nach Handlungsverlauf variierend wiederholen. Joe und Jerry werden dabei von einem dominierenden Saxofon, Sugar von einer Jazztrompete begleitet. In parallel verlaufendes aber räumlich getrenntes Geschehen wird der Zuschauer spannungssteigernd fiber cross- cuttings einbezogen, kann beide Paare scheinbar gleichzeitig verfolgen, sowohl Sugar und Joe auf der Yacht als auch den mit Osgood tanzenden Jerry. Der dabei entstehende kontinuierliche Handlungsverlauf fesselt den Zuschauer und lässt die technische Gestaltung in den Hintergrund treten.
Quelle:
Das Hollywood - Kino 1900-2000, Kapitel VI American Comedy, Kapitel II Narration http://online-media.uni-marburg.de/medienwissenschaft/digitale-medien/hollywood/06_comedy/einstieg.html
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Billy Wilders „Some like it hot“?
Die Travestiekomödie spielt auf frech-frivole Weise mit sexuellen Differenzen und Geschlechterrollen, was zur Zeit der Entstehung 1959 den moralischen Production Code herausforderte.
Wie entsteht die Komik im Film?
Die Komik resultiert aus dem Rollenspiel (Männer als Frauen), dem mehrdeutigen Wortwitz und der Parodie sexueller Stereotypen wie dem „dummen Blondchen“ oder dem „rohen Gangster“.
Welche Rolle spielt die Musik in diesem Essay?
Musik wird als narratives Element analysiert: Einzelnen Figuren sind Motive zugeordnet (z.B. Saxofon für Joe/Jerry, Jazztrompete für Sugar), die die Handlung untermalen.
Was versteht man unter dem Kontinuitätsprinzip Hollywoods?
Es bedeutet, dass Schnitt und Montage so unauffällig gestaltet sind, dass der Zuschauer den Erzählfluss als natürlich wahrnimmt und die technische Gestaltung in den Hintergrund tritt.
Wie wird die männliche Perspektive filmisch umgesetzt?
Durch Techniken wie Eyeline Matches wird die subjektive, oft sexuell intendierte Sicht der als Frauen verkleideten Protagonisten auf ihre Kollegin Sugar suggeriert.
- Quote paper
- BA Mireille Murkowski (Author), 2006, Essay zu Billy Wilders Komödie "Some like it hot" (1959), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138461