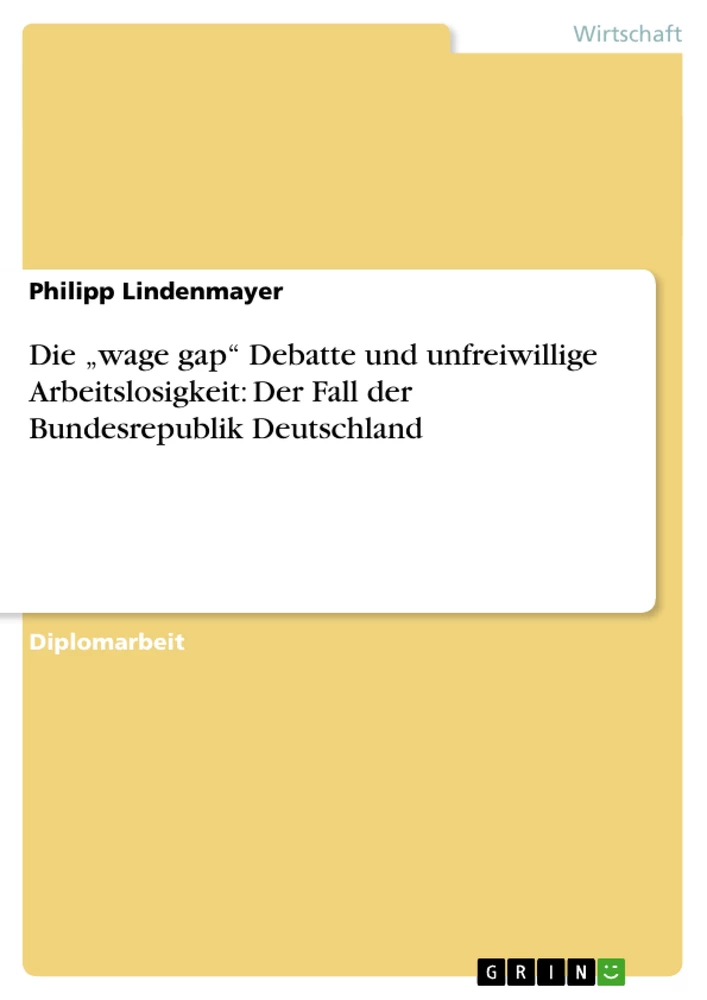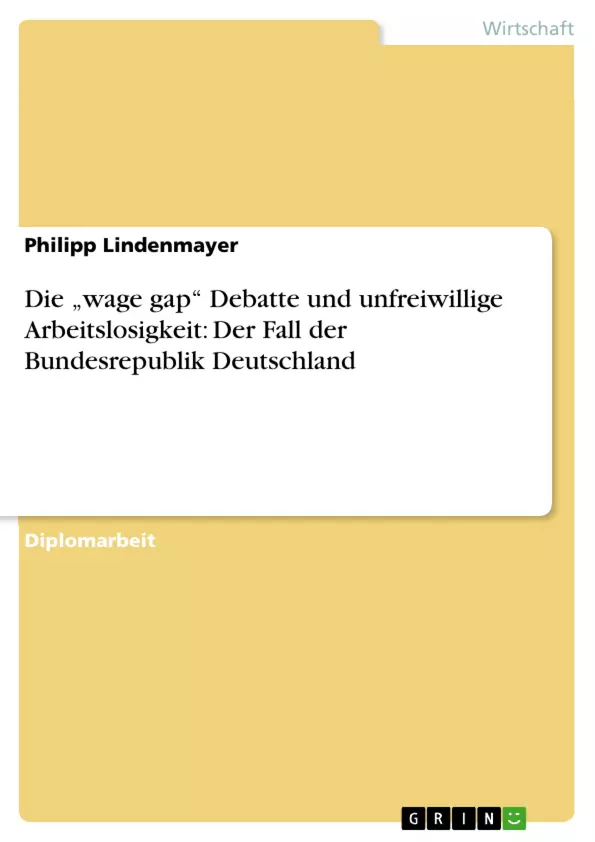„Are the growing US inequality and the growing European unemployment different sides of the same coin?”
Diese Frage stellt den Leitfaden dieser Arbeit, die in 5 Abschnitte gegliedert ist, dar. Zunächst gehe ich in Abschnitt 2 auf die Erklärung und Wirkung der „wage gap“ ein, um die schon angedeuteten populärsten Ursachen und ihre Wirkung etwas näher zu be-trachten. Dabei werden allerdings nur Punkte beleuchtet, die für die spätere Analyse des deutschen Beschäftigungsproblems von Relevanz sein könnten.
Um überhaupt an die Fragestellung heran zu gehen, müssen zunächst die Eigenschaften des deutschen Arbeitsmarktes und ihre Auswirkungen auf die nachfolgende Analyse untersucht werden. Dies geschieht in Teil 3. Die Struktur der Arbeitslosigkeit (3.2) wird dabei ebenso betrachtet wie die Rahmenbedingungen (3.1), die, wie sich noch herausstellen wird, von entscheidender Bedeutung für meine Argumentation sein werden. Im 4. Abschnitt unternehme ich den Versuch, die deutsche Arbeitslosigkeit mit Hilfe eines integrierten Ansatzes zu erklären. Dabei wird ein Insider – Outsider-Modell als Ausgangspunkt gewählt, das später mit den institutionellen deutschen Rahmenbedingungen und qualifikatorischen Nachfrageverschiebungen verknüpft wird. Dies soll dazu dienen, qualifikationsspezifische Arbeitslosigkeit modelltheoretisch zu begründen, um diese dann in Teil 5 aus empirischer Sicht auf ihren Erklärungsgehalt für die gesamte deutsche Arbeitslosigkeit zu überprüfen.
Schließlich beendet Abschnitt 6 mit einigen Schussfolgerungen die Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Aufbau der Arbeit
- Erklärung und Wirkung der „wage gap“
- Grundsätzliche Aspekte
- Zwei populäre Ursachen und ihre Wirkung
- Technologischer Fortschritt (SBTC)
- Globalisierung bzw. Internationaler Handel
- Empirische Untersuchungen zur Relevanz von SBTC und Globalisierung
- Der deutsche Arbeitsmarkt
- Institutionelle Rahmenbedingungen des deutschen Arbeitsmarktes
- Das deutsche Berufsausbildungssystem
- Gewerkschaften und Tarifverträge
- Staatliche Intervention
- Lohnkosten
- Konsequenzen für die Analyse des dt. Arbeitsmarktes
- Die Struktur der Arbeitslosigkeit
- Qualifikation als Strukturmerkmal
- Alter als Strukturmerkmal
- Dauer als Strukturmerkmal
- Arbeitslosigkeit im Osten
- Institutionelle Rahmenbedingungen des deutschen Arbeitsmarktes
- Erklärungsversuch der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Der Interessenskonflikt zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen bei individuellen Lohnverhandlungen
- Der Interessenskonflikt zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen bei kollektiven Lohnverhandlungen
- Erklärung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit
- Empirischer Erklärungsgehalt der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit für die unfreiwillige Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „wage gap“-Debatte und deren Zusammenhang mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in Deutschland. Ziel ist es, die Ursachen und Auswirkungen der Lohnlücke zu analysieren und deren Rolle im Kontext des deutschen Arbeitsmarktes zu beleuchten. Dabei werden insbesondere institutionelle Rahmenbedingungen und qualifikationsspezifische Aspekte der Arbeitslosigkeit berücksichtigt.
- Analyse der „wage gap“ und ihrer Ursachen
- Der Einfluss des technologischen Fortschritts und der Globalisierung auf die Lohnlücke
- Institutionelle Rahmenbedingungen des deutschen Arbeitsmarktes und ihre Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit
- Qualifikationsspezifische Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Erklärungsansätze für unfreiwillige Arbeitslosigkeit im deutschen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Aufbau der Arbeit: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand – die Verbindung zwischen der „wage gap“ und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in Deutschland – und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die Forschungsfrage und die Methodik, um den Leser auf die nachfolgende Analyse vorzubereiten. Der Aufbau dient als Wegweiser durch die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte, die systematisch auf die Beantwortung der Forschungsfrage abzielen.
Erklärung und Wirkung der „wage gap“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „wage gap“ und untersucht dessen Ursachen und Auswirkungen. Es werden grundlegende Aspekte der Lohnlücke erläutert und zwei einflussreiche Faktoren, nämlich der technologische Fortschritt (SBTC) und die Globalisierung, detailliert analysiert. Die Wirkung dieser Faktoren auf die Lohnentwicklung wird anhand empirischer Studien belegt und diskutiert, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Erklärung, wie diese Faktoren zu Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt beitragen.
Der deutsche Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel liefert einen detaillierten Überblick über den deutschen Arbeitsmarkt. Es analysiert die institutionellen Rahmenbedingungen, darunter das Berufsausbildungssystem, die Rolle von Gewerkschaften und Tarifverträgen sowie staatliche Interventionen und Lohnkosten. Die Konsequenzen dieser institutionellen Gegebenheiten für die Analyse des deutschen Arbeitsmarktes werden diskutiert und die Struktur der Arbeitslosigkeit wird anhand von Merkmalen wie Qualifikation, Alter und Dauer der Arbeitslosigkeit untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der spezifischen Charakteristika des deutschen Arbeitsmarktes und deren Relevanz für die Arbeitslosigkeitsentwicklung.
Erklärungsversuch der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit in Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erklärung der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit in Deutschland. Es untersucht Interessenskonflikte zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen sowohl bei individuellen als auch bei kollektiven Lohnverhandlungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit und wie diese zum Gesamtbild der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit beiträgt. Die Analyse bezieht verschiedene sozioökonomische Faktoren ein und zielt darauf ab, die Mechanismen hinter diesem wichtigen Aspekt des deutschen Arbeitsmarktes zu verstehen.
Empirischer Erklärungsgehalt der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit für die unfreiwillige Arbeitslosigkeit in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert empirische Befunde, die den Erklärungsgehalt der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit für die unfreiwillige Arbeitslosigkeit in Deutschland belegen. Es stützt sich auf Datenanalysen und statistische Methoden, um die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Phänomenen aufzuzeigen und die vorherigen theoretischen Überlegungen zu überprüfen. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der komplexen Dynamik auf dem deutschen Arbeitsmarkt bei.
Schlüsselwörter
Wage gap, unfreiwillige Arbeitslosigkeit, Deutschland, technologischer Fortschritt, Globalisierung, institutionelle Rahmenbedingungen, Arbeitsmarkt, Qualifikation, Lohnverhandlungen, Gewerkschaften, Tarifverträge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Wage Gap" und unfreiwillige Arbeitslosigkeit in Deutschland
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der "Wage Gap" (Lohnlücke) und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen der Lohnlücke und deren Rolle im Kontext des deutschen Arbeitsmarktes, unter Berücksichtigung institutioneller Rahmenbedingungen und qualifikationsspezifischer Aspekte der Arbeitslosigkeit.
Welche Aspekte der "Wage Gap" werden behandelt?
Die Arbeit definiert den Begriff "Wage Gap" und untersucht dessen Ursachen und Auswirkungen. Besonders werden der technologische Fortschritt (SBTC) und die Globalisierung als einflussreiche Faktoren detailliert analysiert, inklusive empirischer Belege für deren Wirkung auf die Lohnentwicklung und die Entstehung von Ungleichheiten.
Wie wird der deutsche Arbeitsmarkt in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit bietet einen detaillierten Überblick über den deutschen Arbeitsmarkt, analysiert die institutionellen Rahmenbedingungen (Berufsausbildungssystem, Gewerkschaften, Tarifverträge, staatliche Interventionen, Lohnkosten) und deren Konsequenzen für die Arbeitslosigkeitsentwicklung. Die Struktur der Arbeitslosigkeit wird anhand von Qualifikation, Alter, Dauer und regionalen Unterschieden (Osten) untersucht.
Welche Erklärungsansätze für unfreiwillige Arbeitslosigkeit werden präsentiert?
Die Arbeit untersucht Interessenskonflikte zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen bei individuellen und kollektiven Lohnverhandlungen als Erklärung für unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit und deren Beitrag zum Gesamtbild der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit.
Welche Rolle spielt die qualifikationsspezifische Arbeitslosigkeit?
Die Arbeit untersucht den empirischen Erklärungsgehalt der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit für die unfreiwillige Arbeitslosigkeit in Deutschland. Datenanalysen und statistische Methoden werden eingesetzt, um die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Phänomenen aufzuzeigen und die theoretischen Überlegungen zu überprüfen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wage Gap, unfreiwillige Arbeitslosigkeit, Deutschland, technologischer Fortschritt, Globalisierung, institutionelle Rahmenbedingungen, Arbeitsmarkt, Qualifikation, Lohnverhandlungen, Gewerkschaften, Tarifverträge.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Erklärung der "Wage Gap", zum deutschen Arbeitsmarkt, zu Erklärungsansätzen für unfreiwillige Arbeitslosigkeit, zur empirischen Untersuchung qualifikationsspezifischer Arbeitslosigkeit und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Navigation.
Welche Forschungsfrage wird beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist, wie die "Wage Gap" mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in Deutschland zusammenhängt und welche Faktoren dazu beitragen.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, Analyse institutioneller Rahmenbedingungen und empirischen Datenanalysen, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften, sowie für alle, die sich für den deutschen Arbeitsmarkt, Lohnungleichheiten und Arbeitslosigkeit interessieren.
- Arbeit zitieren
- Philipp Lindenmayer (Autor:in), 2002, Die „wage gap“ Debatte und unfreiwillige Arbeitslosigkeit: Der Fall der Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138505