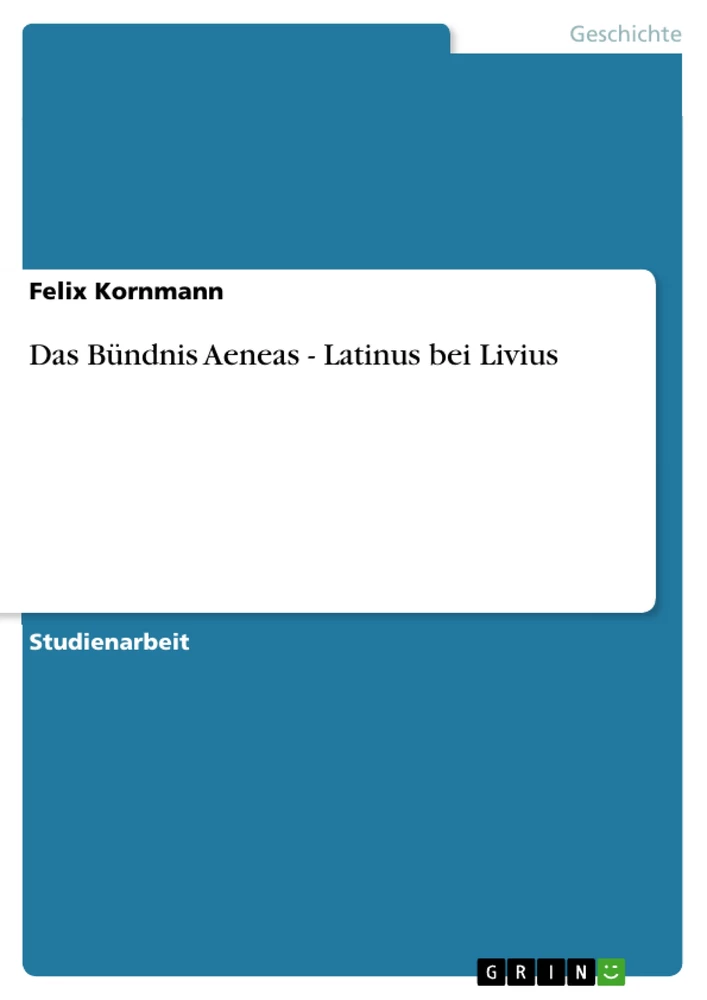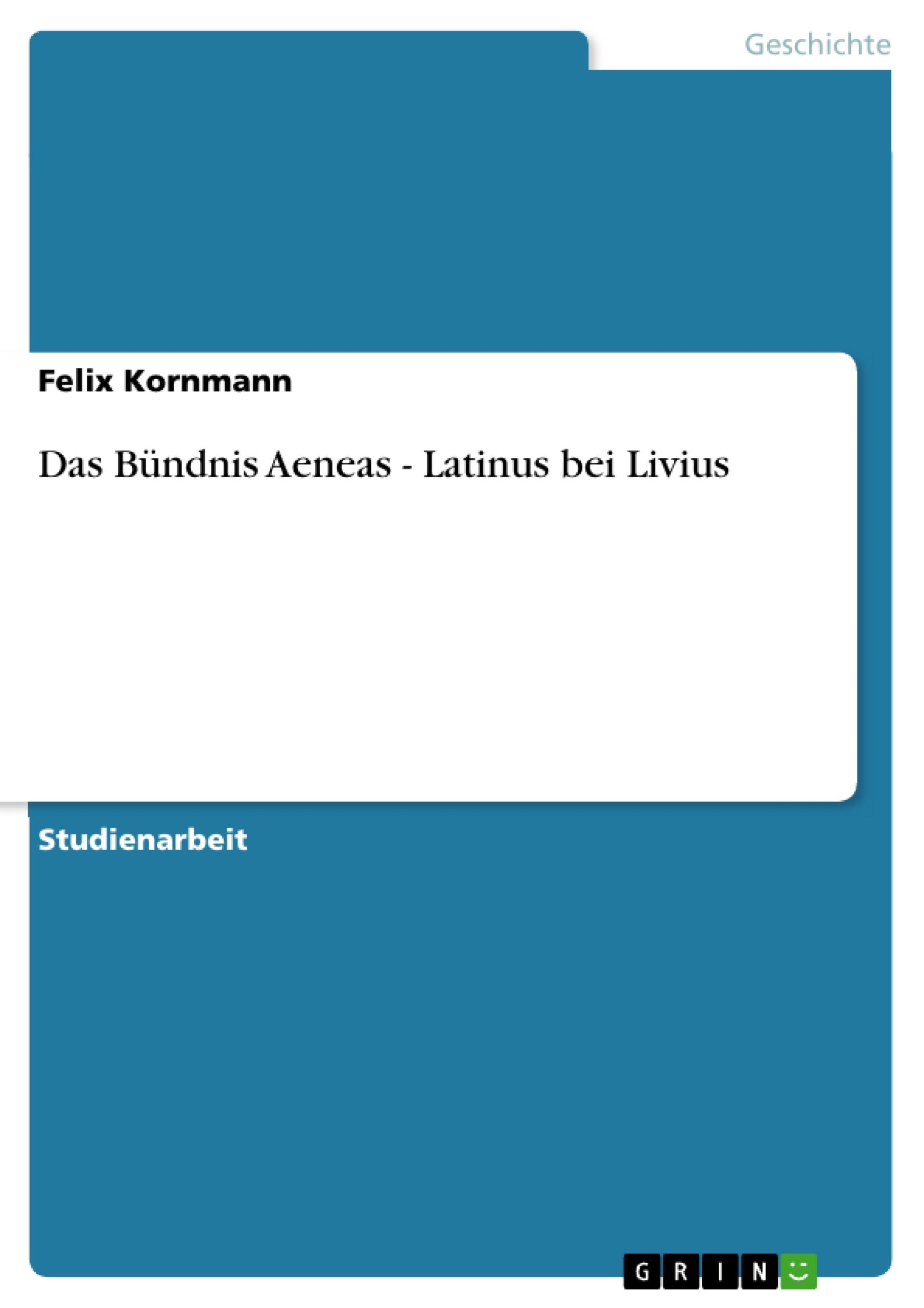Obwohl er niemals Sympathie zeigte für das von Kaiser Augustus errichtete imperiale Reich, so wurde der römische Geschichtsschreiber Titus Livius doch ein Freund von diesem. Augustus, dem im Jahr 27 v. Chr. der höchste Ehrentitel den der römische Staat vergeben konnte, den des Vater des Vaterlandes, verliehen wurde, feierte dies mit der Einweihung eines Forums das sich gegenüber dem Forum Caesars nach Osten hin erstreckte. Im Tempel, anhand von Bildern, wurde er als Vollender der Geschichte Roms dargestellt, wie dies auch Titus Livius in seinem Geschichtswerk „Ab urbe condita“, welches zur selben Zeit im Begriff war zu erscheinen, tat.
Die vorgelegte Proseminararbeit wird sich mit dem genannten ersten Buch „Ab urbe condita“ von Titus Livius beschäftigen. An diesem fand er denkbar den meisten Wohlgefallen, da er in ihm, die zu seiner eigenen Zeit geltenden und gerade wieder überführten Grundwerte des römischen Staates und Volkes darlegen konnte. Im Speziellen soll auf das Treffen beziehungsweise die Bündnisse von Aeneas und Latinus in Latium bei Livius eingegangen werden.
Zuerst wird ein kurzer Überblick über das Leben Livius‘ und sein Werk gegeben. Aus welchen Verhältnissen stammt er? Wie wurde er zum Geschichtsschreiber? Mit welchem Ziel verfasste er seine Bücher? Dann wird das zu beantwortende Problem der historischen Wahrheit bearbeitet, da schon den ältesten römischen Historikern nur klägliche Informationen über die ältere Geschichte Roms zur Verfügung standen , ist davon auszugehen, dass Livius die, in seinen Büchern hervorgehobenen Geschichten und Tatsachen, dichterisch ausschmückte und subjektiv einfärbte. Darüber hinaus ist zu erfragen, welches Verhältnis Livius und Augustus hatten und inwiefern es sich bei Livius‘ Arbeit um eine Verbeugung vor diesem handelte? Wer, eigentlich, gab die Werke in Auftrag? Aus welchen Quellen speisen sich die zur Geschichte verarbeiteten Informationen und wo hatte Livius sie her?
Inhaltsverzeichnis
1. Fragestellung:
2. Livius und seine Werke
3. Die Bündnisse Aeneas-Latius in Latium bei Livius
4. Augustus und Livius
5. Quellen des Livius
6. Die historische Wahrheit des Werkes
7. Fazit
Literaturverzeichnis:
1. Fragestellung:
Obwohl er niemals Sympathie zeigte für das von Kaiser Augustus errichtete imperiale Reich, so wurde der römische Geschichtsschreiber Titus Livius doch ein Freund von diesem. Augustus, dem im Jahr 27 v. Chr. der höchste Ehrentitel den der römische Staat vergeben konnte, den des Vater des Vaterlandes, verliehen wurde, feierte dies mit der Einweihung eines Forums das sich gegenüber dem Forum Caesars nach Osten hin erstreckte.[1] Im Tempel, anhand von Bildern, wurde er als Vollender der Geschichte Roms dargestellt, wie dies auch Titus Livius in seinem Geschichtswerk „Ab urbe condita“, welches zur selben Zeit im Begriff war zu erscheinen, tat.
Die vorgelegte Proseminararbeit wird sich mit dem genannten ersten Buch „Ab urbe condita“ von Titus Livius beschäftigen. An diesem fand er denkbar den meisten Wohlgefallen, da er in ihm, die zu seiner eigenen Zeit geltenden und gerade wieder überführten Grundwerte des römischen Staates und Volkes darlegen konnte.[2] Im Speziellen soll auf das Treffen beziehungsweise die Bündnisse von Aeneas und Latinus in Latium bei Livius eingegangen werden.
Zuerst wird ein kurzer Überblick über das Leben Livius‘ und sein Werk gegeben. Aus welchen Verhältnissen stammt er? Wie wurde er zum Geschichtsschreiber? Mit welchem Ziel verfasste er seine Bücher? Dann wird das zu beantwortende Problem der historischen Wahrheit bearbeitet, da schon den betagtesten römischen Historikern nur klägliche Informationen über die ältere Geschichte Roms zur Verfügung standen[3], ist davon auszugehen, dass Livius die, in seinen Büchern hervorgehobenen Geschichten und Tatsachen, dichterisch ausschmückte und subjektiv einfärbte. Darüber hinaus ist zu erfragen, welches Verhältnis Livius und Augustus hatten und inwiefern es sich bei Livius‘ Arbeit um eine Verbeugung vor diesem handelte? Wer, eigentlich, gab die Werke in Auftrag? Aus welchen Quellen speisen sich die zur Geschichte verarbeiteten Informationen und wo hatte Livius sie her?
2. Livius und seine Werke
Da Livius sich gegen das Einschlagen einer politischen Laufbahn entschied und sich mit Äußerungen was seine Person, Arbeit und Gegenwartsbezüge betrifft in Zurückhaltung übte, können keine chronologischen Fixpunkte durch die Jahresangaben der Magistraturen gemacht werden, so sind die Nachrichten über sein Leben und sein Schaffen von beträchtlicher Dürftigkeit gezeichnet.[4]
Dennoch nimmt man an, dass Titus Livius 59 v. Chr. in Patavium, dem heutigen Padua geboren, wurde und auch dort 17 n. Chr. starb. Gleichwohl ist auf Eintragungen des Kirchenvaters Hieronymus zurückzuführen, das Livius‘ Geburtsjahr auf 64 v. Chr. vordatiert und sein Todesjahr auf 12 n. Chr. verlegt werden muss.[5] Was das Gesamtwerk von Titus Livius angeht sind beide Annahmen möglich und so bleibt die Frage offen.
Wie über sein Leben, so ist auch kaum etwas über die Familie bekannt der er entstammte. Wenn sie zur Aristokratie Pataviums gehörte, dann bekleidete jedoch niemand aus der Verwandtschaft ein Amt in Rom. Den Großteil seines Lebens verbrachte Livius in seiner Heimatstadt. Er konnte von dort die Wirren der Revolution und Bürgerkriege, die Selbstzerstörung der Republik und deren Festigung durch Augustus miterleben. Die früheren Epochen Roms im Geiste ebenso gewahr, wie der gegenwärtige Zustand, vermochte Livius sein geschichtskundiges Auge vergleichend und beurteilend schweifen lassen. Ohne Erfahrungen militärischer oder politischer Natur machte er sich daran zu beschreiben was vorgefallen war und stellt damit ein Novum in der Geschichte dar.[6]
Um dies möglich zu machen, war natürlich eine fundierte philosophische und vor allem rhetorische Bildung nötig. Diese erlangte er ebenfalls in Padua, einer der reichsten Städte im römischen Reich, wo es an Bildungsstätten und Lehren nicht gefehlt hatte. Livius erhielt ein breites Wissen unteranderem wurde er auch in die Grundzüge römischer Geschichte und in die Lektüre griechischer Autoren eingeführt.[7] Zwischenzeitlich wechselte Livius seinen Aufenthalt zwischen der Hauptstadt Rom und seiner Heimatstadt Padua. Er heiratete und bekam mit seiner Frau zwei Söhne und eine Tochter.[8]
Wann er genau begann sein Geschichtswerk aufzuschreiben ist nur auf Vermutungen zurück zuführen. Gewiss ist aber, dass er ein erstaunliches Pensum an den Tag legte. Sein Œuvre, welches zu einem Viertel erhalten ist, umfasst 142 Bücher über die römische Geschichte von ihren Anfängen bis zum Tod des Drusus.[9]
Genau 35 Bücher aus diesem immensen Fundus sind bewahrt, darüberhinaus Auszüge, zahlreiche Fragmente und Inhaltsangaben einzelner Bücher. Die Anfänge Roms bis kurz vor Ende des 3. samnitischen Kriegs im Jahr 293 werden in den Büchern 1-10 abgehandelt und der Beginn des 2. punischen Kriegs 218 bis zum Sieg über König Perseus von Makedonien im Jahr 167 ist in den Büchern 21-45 nachzulesen. Die Periochae zeigen, dass die Bücher 1-133 die Anfänge Roms bis zu den Bürgerkriegen und die restlichen die Herrschaft von Augustus beschreiben.[10]
In seinem ersten Buch „Ab urbe condita“ schildert Livius mit der Verkörperung der Kampfesleistung großer Männer in der Schlacht, den Werdegang des populus Romanus. So wird der Aufstieg Roms bestimmt durch kämpferische Gewandtheit, welche sich neben sittliche und religiöse Werte stellt.[11]
Der geschlossene Charakter des ersten Buches, von den Erzählungen der sagenhaften Anfänge Roms bis zum Ende der Königszeit, bildet eine besondere Einheit. Auch ist die Sprache die Livius verwendet mit Nichten die, die man von einem Mann wie ihm – feinsinnig, äußerst gebildet und schaffenskräftig – erwartet. Seine Sprache entspricht nicht der von Cicero oder anderen, eher nach Klarheit sinnenden, Stilisten und Linguisten. Eher ist sie gezeichnet von einem unbekümmerten Übermut in ihrer Durchmischung aus Umgangssprache, hohem dichterischen Ausdruck und der Neigung zu Gräzismen.[12]
Diese Abwendung vom Klassischen – nimmt man Cicero als Referenzpunkt dessen – zeigt die Lebendigkeit und Anziehungskraft, die von Livius‘ Werk ausging und dadurch wohl auch positive Resonanz erzielte, was wiederum dazu beigetragen haben könnte den großen Plan der nächsten Bücher in Angriff zu nehmen.[13]
3. Die Bündnisse Aeneas-Latius in Latium bei Livius
Nachdem Sieg der Griechen und der Einnahme Troias begibt sich der Sohn Anchises und der Göttin Venus Aeneas auf mehrere Irrfahrten. Nur für ihn und Antenor verzichteten die Achiver auf das Kriegsrecht. Gegen die Übrigen Troianer wurde grausam vorgegangen. Sowohl dem alten Recht auf Gastfreundschaft, ihrem Beharren auf Frieden als auch den Bemühungen um die Rückgabe der Helena hatten Aeneas und Antenor zu verdanken verschont worden zu sein. (Vers 1,1,1)
Antenor kommt mit einer führerlosen Schar Enetern über Umwege in die entlegenste Bucht des Adriatischen Meers vertreibt dort ansässige Eugeneer und besetzte das Land, dessen Volk nun Veneter genannt wird. (Vers 1,1,2 – 1,1,3)
Aeneas aber ist bestimmt durch ein höheres Schicksal zur Gründung eines größeren Staatswesens. Zuerst gelangt er nach Makedonien, dann verschlägt es ihn auf der Suche nach Wohnsitzen nach Sizilien bis er später mit seiner Flotte das Gebiet Laurentum oder Latium erreicht. (Vers 1,1,4) Gezeichnet von der langen Irrfahrt und mit nichts mehr an Bord als Waffen, gingen die dort gelandeten Troianer an Land, um auf diesem Gebiet Beute zu machen. In diesem Moment kommen die Ureinwohner und deren König Latinus bewaffnet aus der Stadt und dem Land angelaufen. (Vers 1,1,6)
Die Tradition weist hier nun zwei Versionen auf: So wird berichtet, dass Latinus besiegt wurde, sich aber mit Aeneas verwandtschaftlich verbündete und Frieden schloss. (Vers 1,1,6) Die andere Version besagt, dass schon die Schlachtreihen geordnet standen und nur noch das Signal zum Angriff ertönen musste. Doch König Latinus trat hervor und rief den Anführer der Eindringlinge heraus. Latinus erfragte den Grund warum sie hier seien, wer sie sind und was sie vorhaben. (Vers 1,1,8) Als der König herausfand, wen er da vor sich hatte, nämlich eine Schar Troianer mit ihrem vornehmen Kopf Aeneas, der gleichermaßen für Krieg oder Frieden bereit war, stieß er seine volle Bewunderung aus. (Vers 1,1,9) So dass es zum ersten Bündnis kam, dem Bündnis zwischen den Führen, und sich die Heere die Hände reichten zum Bündnis der Völker. Mit Gastfreundschaftlichkeit überhäuft von Latinus wurde gleich noch ein Bündnis vor den heimischen Göttern geschlossen. Aeneas bekam Latinus‘ Tochter Lavinia zu Frau, (Vers 1,1,10) nach der er auch eine Stadt benannte Lavinium. (Vers 1,1,11) Nun keimte große Hoffnung bei den Troianern auf, endlich einen festen Ort gefunden zu haben, (Vers 1,1, 10) da aus der Verbindung von Aeneas und Lavinia mit Ascanius schnell ein Nachkomme das Licht der Welt erblickte. (Vers 1,1,11)
[...]
[1] Bellen, Heinz: Grundzüge der römischen Geschichte. Erster Teil. Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat. Darmstadt 1994, S. 176.
[2] Feger, Robert: Livius. Ab urbe condita. Stuttgart 1981, S. 228-229.
[3] Heuß, Alfred: Römische Geschichte. In: Bleicken, Jochen; Dahlheim, Werner und Gehrke, Hans-Joachim (Hrsg.). Paderborn 1998, S. 537.
[4] Burck, Erich: Das Geschichtswerk des Titus Livius. Heidelberg 1992, S. 1.
[5] Ebenda
[6] Feger: S. 227-228.
[7] Burck: S. 2.
[8] Ebenda: S. 2-3.
[9] Heuß: S. 537.
[10] Burck: S. 7.
[11] Fries, Jutta: Der Zweikampf. Historische und literarische Aspekte seiner Darstellung bei T. Livius. In: Heitsch, Ernst; Merkelbach, Reinhold und Zintzen, Clemens (Hrsg.): Beiträge zur klassischen Philologie. Königsstein 1985, S. 3.
[12] Feger: S. 234.
[13] Burck: S. 8.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt das Werk "Ab urbe condita" von Titus Livius?
Es beschreibt die Geschichte Roms von den sagenhaften Anfängen bis in die Zeit des Kaisers Augustus.
Was ist das Besondere am Bündnis zwischen Aeneas und Latinus?
Es markiert den friedlichen Zusammenschluss der trojanischen Flüchtlinge mit den Ureinwohnern Latiums und die Grundlegung der römischen Ahnenlinie durch die Heirat mit Lavinia.
Wie verlässlich ist Livius als historische Quelle?
Da Livius nur wenige Informationen über die Frühzeit Roms hatte, schmückte er seine Erzählungen oft dichterisch aus und färbte sie subjektiv ein, um moralische Werte zu vermitteln.
Welches Verhältnis hatte Livius zu Kaiser Augustus?
Obwohl Livius kein Anhänger des imperialen Reichs war, verband ihn eine Freundschaft mit Augustus. Sein Werk stützte indirekt die von Augustus proklamierten Grundwerte.
Welche Sprache verwendet Livius in seinen Büchern?
Seine Sprache ist eine Mischung aus Umgangssprache, hohem dichterischem Ausdruck und Gräzismen, was sich vom klassischen Stil Ciceros unterscheidet.
Warum legte Livius Wert auf die Darstellung "großer Männer"?
Er wollte durch die Kampfesleistung und die sittlichen Werte bedeutender Persönlichkeiten den Aufstieg und die Identität des römischen Volkes (populus Romanus) erklären.
- Arbeit zitieren
- Felix Kornmann (Autor:in), 2009, Das Bündnis Aeneas - Latinus bei Livius, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138598