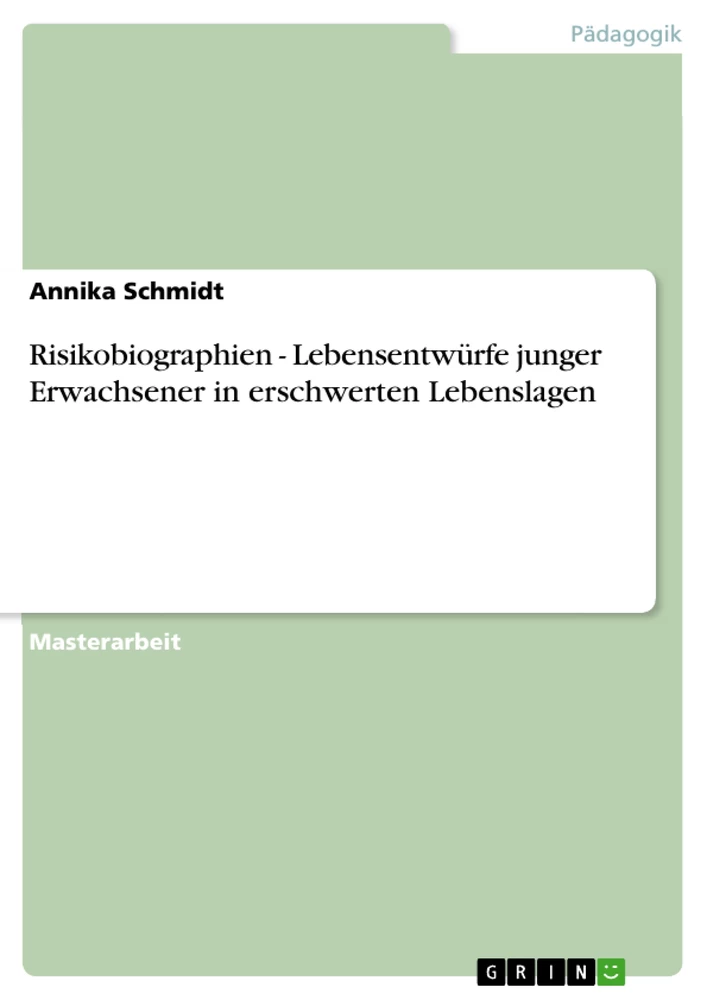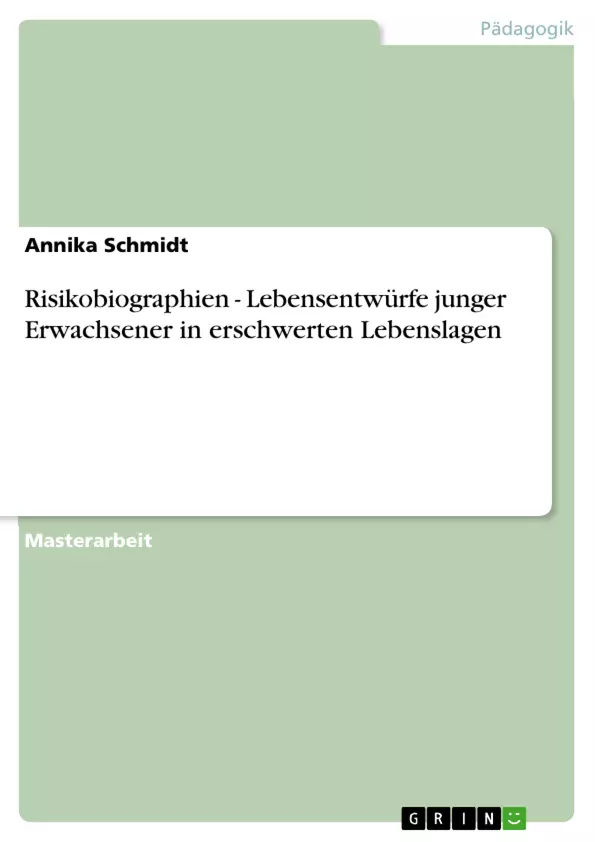Die vorliegende Masterarbeit stellt sich das Ziel, Lebensentwürfe von jungen Erwachsenen in „erschwerten Lebenslagen“ anhand exemplarischer Beispiele zu analysieren.
Im Fokus der Untersuchung stehen zentrale Antizipationsinhalte in den Lebensbereichen Ausbildung, Beruf und Einkommen; Freizeit, Wohnen, Familie und soziale Beziehungen sowie Lebensstandard und -zufriedenheit im Ganzen. Hierzu werden die Antizipationen mit den individuellen Voraussetzungen, Intentionen, Motiven, Wünschen und Zielen unter den Bedingungen, Anforderungen und Optionen der Umwelt untersucht. Dies bildet die Voraussetzung für die Analyse subjektiver Bedeutungsstrukturen, individuell wahrgenommener Handlungsmöglichkeiten und Problemlöseversuche der Betroffenen. Dabei ist herauszuarbeiten, wie der sozial - gegenständliche Kontext für die Identitätsbildung und Integration in das gesellschaftliche Ganze beschaffen ist und welche Gestaltungsspielräume junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen imstande sind, für sich zu erschließen.
(…)
Gegenstandsbereich meiner Arbeit ist daher die Frage, wo sich junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen sehen und inwieweit sie ihre eigene Lage wahrnehmen. Informationen über die Sicht und Bewertung der eigenen Situation sind u. a. auch deshalb aufschlussreich, weil damit grundlegende Orientierungen, Interessen und Lebensperspektiven einhergehen. Daher interessieren auch die Erfahrungen und Bewältigungsformen junger Menschen, die auf eine Art von Ausgrenzung in einem oder mehreren Lebensbereichen betroffen bzw. bedroht sind. Wie erfährt und verarbeitet der Biographieträger (negative) Ereignisverkettungen im Lebenslauf?
Die Aufmerksamkeit gilt folglich der Haltung, die der junge Erwachsene als Träger seiner Biographie gegenüber diesen Gegebenheiten und Ereignissen in seinem Leben einnimmt und zum Ausdruck bringt. Im Fokus steht das Erleben und die Bewältigung dieser Ereignisse, auf welche Hilfen oder Ressourcen dabei zurückgegriffen werden kann, unter welchen Umständen und Modalitäten, welcher Aufwand und welche Gefühle möglicherweise mit deren Bewältigung verknüpft sind. Jede Lebenswelt bietet dabei einen bestimmten Umkreis von Entfaltungsmöglichkeiten an, andere werden ausgeschlossen oder versperrt. Von Interesse ist hierbei, ob und wie es jungen Menschen gelingt, behindernde Einschränkungen und Widerstände zu überwinden, Benachteiligungen aufzuheben und neue Bewegungsräume für sich zu erschließen.
(...)
Inhalt
Einleitung
1 Der gesellschaftliche Wandel - neue Herausforderungen an Individuen
1.1 Die Entwicklung von Lebensentwürfen unter dem Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
1.2 Die Bedeutsamkeit zentraler Lebensbereiche
1.2.1 Arbeit in der Risikogesellschaft - vom Beruf auf Lebenszeit zur Lebensabschnittstätigkeit
1.2.2 Bedeutung und Funktionen von Freizeit
1.2.3 Wohnen
1.2.4 Strukturwandel in Partnerschaft und Familie
2 Biographiearbeit und Individuation
2.1 Die junge Generation auf der Suche nach Orientierung und Identität
2.2 Über die Notwendigkeit von Biographiearbeit
3 Die Analyse exemplarischer Lebensentwürfe junger Erwachsener in erschwerten Lebenslagen
3.1 Das methodische Vorgehen
3.1.1 Ableiten von Fragestellungen für die empirische Untersuchung
3.1.2 Die Bestimmung der Zielgruppe
3.1.3 Die Gewinnung der Interviewpartner
3.1.4 Die Datenerhebung
3.1.5 Die Datenaufbereitung und -auswertung
3.2 Ergebnisse der Einzelfallanalysen
3.2.1 Herr S.
3.2.2 Herr B.
3.2.3 Herr L.
3.3 Interpretation der Ergebnisse
4 Abschließendes Resümee und Anregungen für weitere empirische Forschungen
5 Anhänge
5.1 Kurzfragebogen zur Erfassung der personenbezogenen Daten
5.2 Gesprächsleitfaden für das halbstrukturierte Interview
6 Literaturverzeichnis
Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit stellt sich das Ziel, Lebensentwürfe von jungen Erwachsenen in „erschwerten Lebenslagen“ anhand exemplarischer Beispiele zu analysieren. Den Hintergrund des Forschungsinteresses bildet meine 2 ½ - jährige Tätigkeit vom 01.08.05 bis 31.12.07, zunächst als Standortleiterin, später als Projektkoordinatorin, im EQUAL - Projekt „NAVIGATOR“, welches sich das arbeitsmarktpolitische Ziel stellte, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit verschiedenen Benachteiligungskonstellationen, die sich überwiegend aus Schul- und Ausbildungsabbrecher/innen, Hauptschüler/innen und Jugendlichen mit Lernbehinderung zusammensetzten, an der ersten Schwelle zur Arbeitswelt gescheitert und daher in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen waren, mit Hilfe niederschwelliger Angebote zu einer stabilen Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen.
Im Fokus der Untersuchung stehen zentrale Antizipationsinhalte in den Lebensbereichen Ausbildung, Beruf und Einkommen; Freizeit, Wohnen, Familie und soziale Beziehungen sowie Lebensstandard und -zufriedenheit im Ganzen. Hierzu werden die Antizipationen mit den individuellen Voraussetzungen, Intentionen, Motiven, Wünschen und Zielen unter den Bedingungen, Anforderungen und Optionen der Umwelt untersucht. Dies bildet die Voraussetzung für die Analyse subjektiver Bedeutungsstrukturen, individuell wahrgenommener Handlungsmöglichkeiten und Problemlöseversuche der Betroffenen. Dabei ist herauszuarbeiten, wie der sozial - gegenständliche Kontext für die Identitätsbildung und Integration in das gesellschaftliche Ganze beschaffen ist und welche Gestaltungsspielräume junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen imstande sind, für sich zu erschließen.
Die Aktualität meines Themas ergibt sich aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Phänomene: In diesem Zusammenhang sind gesellschaftliche Entwicklungen zu nennen, welche zunehmend einen adäquaten Umgang mit Diskontinuitäten im Biographieverlauf abverlangen. Die sich vertiefende Dynamik des gesellschaftlichen Wandels und die damit verbundene Ausweitung psycho - sozialer Risikokonstellationen erfordern von den Subjekten die perspektive Ausbildung einer flexiblen Lebensführung bzw. Habitus'. Das einzelne Individuum wird zu einem Schnittpunkt unterschiedlicher und teilweise divergierender Anforderungen, Erwartungshaltungen, normativer Leitbilder und institutionalisierten Regulierungsmechanismen. Die Pluralisierung als dominantes Merkmal der Gegenwart ermöglicht dabei besonders jungen Menschen die Entwicklung individueller Lebenskonzepte. Diese haben zwar einerseits neue Selbstbestimmungs-räume für die persönliche Lebensgestaltung eröffnet, stellen andererseits jedoch auch neue Herausforderungen an Heranwachsende dar, da normative Werte, die zu bestimmten vorhersehbaren Handlungen geführt haben, zunehmend einem offenen Wertesystem weichen, welches ein hohes Maß an Entscheidungskompetenz und Selbstverantwortung voraussetzt. Da in Folge immer mehr Entscheidungen auf eigenes Risiko getroffen werden müssen, sind moderne Biographien durch verschiedene Probleme der Lebensbewältigung belastet, so dass Fehlentscheidungen erhebliche Folgen nach sich ziehen können. Wenn sich aber Entscheidungen aufgrund der wachsenden Zahl von Handlungsalternativen immer schwieriger gestalten lassen, sind die Konsequenzen hinsichtlich der eigenen Zukunft langfristig kaum noch überblickbar. Die alltägliche Lebensbewältigung erweist sich damit als ein Komplex von anspruchsvollen Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen: intellektuelle Fähigkeiten, emotionale und motivationale Voraussetzungen, Selbstbewusstsein, Erfahrungen, das Eingebundensein und Erleben von Unterstützung in sozialen Netzwerken sowie materielle Ressourcen. Die Ansprüche an die biographische Kompetenz im Sinne der Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten, haben damit zugenommen. Jede besondere Konstellation, Veränderung oder Herausforderung im Verlauf der Lebensgeschichte eines Menschen kann somit als Aufgabe verstanden werden, die von ihm bearbeitet und bewältigt werden muss. Doch nicht jeder kommt mit diesen Anforderungen gleichermaßen zurecht. Gegenstandsbereich meiner Arbeit ist daher die Frage, wo sich junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen sehen und inwieweit sie ihre eigene Lage wahrnehmen. Informationen über die Sicht und Bewertung der eigenen Situation sind u. a. auch deshalb aufschlussreich, weil damit grundlegende Orientierungen, Interessen und Lebensperspektiven einhergehen. Daher interessieren auch die Erfahrungen und Bewältigungsformen junger Menschen, die auf eine Art von Ausgrenzung in einem oder mehreren Lebensbereichen betroffen bzw. bedroht sind. Wie erfährt und verarbeitet der Biographieträger (negative) Ereignisverkettungen im Lebenslauf? Die Aufmerksamkeit gilt folglich der Haltung, die der junge Erwachsene als Träger seiner Biographie gegenüber diesen Gegebenheiten und Ereignissen in seinem Leben einnimmt und zum Ausdruck bringt. Im Fokus steht das Erleben und die Bewältigung dieser Ereignisse, auf welche Hilfen oder Ressourcen dabei zurückgegriffen werden kann, unter welchen Umständen und Modalitäten, welcher Aufwand und welche Gefühle möglicherweise mit deren Bewältigung verknüpft sind. Jede Lebenswelt bietet dabei einen bestimmten Umkreis von Entfaltungsmöglichkeiten an, andere werden ausgeschlossen oder versperrt. Von Interesse ist hierbei, ob und wie es jungen Menschen gelingt, behindernde Einschränkungen und Widerstände zu überwinden, Benachteiligungen aufzuheben und neue Bewegungsräume für sich zu erschließen.
Um die Differenzierungen der Lebenswelt und die sich daraus ableitenden Handlungsmotive herauszuarbeiten, die Erfahrungen, die der Betroffene mit ihnen macht, die Art und Weise, wie er diese differenzierten Momente erlebt, deutet und für die weitere Gestaltung seines Lebens nutzt, ist die Arbeit wie folgt gegliedert:
Im theoretischen Teil werden die gesellschaftlichen Bedingungen, welche den diesbezüglichen Handlungsrahmen determinieren sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an Individuen diskutiert. Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen und Wandlungsprozessen, in denen Jugend gegenwärtig aufwächst. Daran schließt sich die Betrachtung der Bedeutsamkeit der zentralen Lebensbereiche Arbeit, Freizeit, Wohnen und Familie an, welche jene Bereiche darstellen, für die besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der Bewältigung der damit verbundenen zentralen jugendtypischen Entwicklungsaufgaben bei der für die Untersuchung relevanten Zielgruppe angenommen werden kann.
Das zweite Kapitel bezieht sich auf den Sinnbezug und Notwendigkeit von biographischer Selbstreflexion und Biographiearbeit hinsichtlich der Selbsthematisierung des Subjektes, um darauf aufbauend im dritten Teil der Arbeit Fragestellungen für die eigene empirische Untersuchung zu präzisieren, an die sich die deskriptive Darstellung der methodischen Vorgehensweise sowie der Untersuchungsergebnisse anschließt. Die Ergebnisdarstellung ist fallbezogen nach den einzelnen Lebensbereichen gegliedert. Hierauf folgen die Diskussion bzw. Interpretation der Ergebnisse und ein abschließendes Resümee sowie Anregungen für weiterführende Forschungsansätze.
1 Der gesellschaftliche Wandel - neue Herausforderungen an Individuen
1.1. Die Entwicklung von Lebensentwürfen unter dem Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
Lebensentwürfe können als Gesamtheit einer gedanklichen, als auch handelnden Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen charakterisiert werden, die Kognitionen und Emotionen unterschiedlicher Bewusstheit beinhalten, welche sowohl auf kontrollierbare als auch unkontrollierbare Ereignisse und damit in Auseinandersetzung mit der Gegenwart auf Zukünftiges gerichtet sind (vgl. Orthmann - Bless 2006, S. 9). Im Hinblick auf die eigene Person spielen u. a. die Auseinandersetzung mit individuellen Kompetenzen, persönlichen Intentionen, Erwartungshaltungen und Wünschen eine signifikante Rolle. Lebensentwürfe werden dabei freilich vor allem auch durch die gegenwärtigen Gesellschaftsbedingungen determiniert. Theorien zur Sozialstruktur moderner Gesellschaften nehmen in diesem Kontext immer wieder ein Grundmotiv auf: die Individualisierung als Kernpunkt makrosoziologischer Entwicklungen (vgl. Beck/ Beck - Gernsheim 1994, S. 11 ff.). Zu den entscheidenden Merkmalen von Individualisierungsprozessen gehört, dass sie den traditionellen Lebensrhythmus von Menschen im Sinne einer „Normalbiographie“ zunehmend in Frage stellen bzw. tendenziell auflösen (vgl. Beck - Gernsheim 1994, S. 120). Sie erlauben in Folge nicht nur eine aktive Eigenleistung von Individuen, sondern fordern sie vielmehr, da in erweiterten Optionsspielräumen sowie Entscheidungszwängen der individuelle Handlungsbedarf wächst und dadurch verstärkt Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Planungsfähigkeit sowie Flexibilität und Frustrationstoleranz nötig sind. Die Auseinandersetzung mit eigenen Kompetenzen und die Antizipation möglicher Alternativen für die zukünftige Lebensgestaltung im Sinne der Fähigkeit zur Lebensplanung werden damit zur wichtigen persönlichen Ressource. Es liegt heute folglich weitestgehend am Einzelnen selbst, wie er sein Leben gestaltet: „Das Leben und die Lebensmöglichkeiten jedes Einzelnen werden so selbst zu einem Wagnis, zu einem sozialen Risiko, zu einem individualisierten Projekt mit offenem Ausgang. Der Einzelne wird damit zur zentralen Instanz der Lebensgestaltung in Eigenverantwortung. Jeder wird vermeintlich zu „seines eigenen Lebens Schmied“ (Rauschenbach 1994, S. 91). Traditionelle Identitätsangebote verlieren somit zunehmend ihre normative Kraft zugunsten der Chance individueller Identitätsarbeit. Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Wohnort, Lebenspartner, Kinderanzahl können nicht nur, sondern müssen getroffen werden:
Die „Wahlbiographie“ wird damit zur „Bastelbiographie“ (vgl. Beck 1986, S. 216 f.). Multiple Optionen für die Lebensgestaltung und die Erarbeitung des individuellen Ichs stellen damit verstärkte Anforderungen an das einzelne Subjekt (vgl. Mägdefrau 2002, S. 172). Überall klaffen folglich Lücken zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Die Angebote an Lebensentwürfen und Entscheidungsangeboten haben sich so sehr vervielfacht, dass Lebensläufe immer weniger vorhersagbar werden und damit die Ansprüche an die eigene biographische Kompetenz als Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten, immer weiter zunehmen. Individuen sehen sich also mit einer Vielzahl konkurrierender Orientierungsmuster in der biographischen Abfolge konfrontiert, die in einen sinnhaften Lebensentwurf integriert werden müssen.
In dem sich der Einzelne als eigenständige Person entwickeln und behaupten muss, wird er gleichzeitig eingebunden in ein System von institutionellen Anforderungen, Kontrollen und Zwängen. An die Stellen traditioneller Bindungen treten verstärkt sekundäre Instanzen und Institutionen, die den Zeit- bzw. Lebenslaufrhythmus zunehmend prägen (z. B. Ein- und Austritt aus dem Bildungs- und Erwerbssystem, Abstimmung von Familien-, Bildungs- und Berufsexistenz u. Ä.) (vgl. Beck 1986, S. 210 ff.). Die individuelle Entwicklung bewegt sich folglich zwangsläufig in einem vom Staat definierten Bereich: Der Staat kontrolliert, modifiziert, vermittelt und belohnt Chancen in den verschiedenen Lebensbereichen, in dem er bspw. Bildungsabschlüsse verteilt. Gleichzeitig fördert er damit die Periodisierung von Lebensläufen, etwa durch Regeln für den Zugang zu bzw. der Nutzung von bestimmten staatlichen Leistungen und schränkt damit die Möglichkeiten der individuellen Lebensgestaltung ein. Mit der zunehmenden Komplexität und Differenziertheit einer Gesellschaft werden somit die Regelungen, welche die Teilnahme des Einzelnen am sozialen Handeln steuern, immer umfangreicher, unübersichtlich und unverbindlicher. Das Alltagsleben wird der Tendenz nach immer mehr selbst zu einem Stück Arbeit und kalkulatorischer Überlegungen: „Für die neuen Vorgaben (…) muss man etwas tun, sich aktiv bemühen. Hier muss man erobern, in der Konkurrenz um begrenzte Ressourcen sich durchzusetzen verstehen (…) Bastelbiographie ist immer zugleich „Risikobiographie“, ja „Drahtseilbiographie“, ein Zustand der (…) Dauergefährdung. Die Fassaden von Wohlstand, Konsum, Glimmer täuschen oft darüber hinweg, wie nah der Absturz ist. Der falsche Beruf oder die falsche Branche, dazu die privaten Unglücksspiralen (…) - Pech gehabt“ (Beck/ Beck - Gernsheim 1994, S. 12 f.). Die „Kunst“ besteht sodann auch darin, mit den nicht gelebten und nicht realisierbaren Möglichkeiten zurechtzukommen (vgl. Floren 2007, S. 76). Unter diesen Bedingungen sind vor allem junge Menschen permanent gezwungen, sich angesichts einer Fülle von Möglichkeiten zu entscheiden.
Bedingung ist dabei, dass sie…
- zunehmend die Folgen ihrer Entscheidungen nicht absehen können,
- tagtäglich ebenso auch mit neuen Plänen, Entwürfen und Entscheidungen anderer Menschen konfrontiert werden, die in Folge ihre Biographie mehr oder weniger nachhaltig tangieren und damit beeinflussen,
- dass es eine unüberbrückbare Lücke zwischen den theoretischen Möglichkeiten und den realen Chancen gibt, auch nur einen Teil davon zu realisieren.
Der gesellschaftliche Auftrag zur Individuation konkretisiert sich in dieser Lebensphase in Form von typischen Entwicklungsaufgaben im Zusammenhang mit Statusübergängen in den Bereichen Ausbildung, Arbeit und Beruf; Freizeit, Wohnen, Partnerschaft und Familie, dessen Bedeutung im Folgenden dargelegt wird.
1.2 Die Bedeutsamkeit zentraler Lebensbereiche
1.2.1 Arbeit in der Risikogesellschaft - vom Beruf auf Lebenszeit zur Lebensabschnittstätigkeit
Dieser Lebensbereich ist zweifelsohne durch eine enorme - sowohl gesellschaftliche, als auch individuelle - Bedeutsamkeitszuschreibung gekennzeichnet. Die Berufsrolle gilt als wesentliche im arbeitsgesellschaftlichen Leben. Arbeit dient der Sicherung der materiellen Grundlagen des Gesellschaftssystems, ist konstituierend für die gesellschaftliche Hierarchie, strukturiert zeitlich den Alltag und den gesamten Lebenslauf von Individuen. Sie verhilft dem Einzelnen zu persönlicher und finanzieller Unabhängigkeit und schafft damit die Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung. Je nach beruflicher Konfiguration bedeutet Erwerbsarbeit eine Operationalisierung und Generierung von Wissen und ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Bewusstsein der Nützlichkeit bzw. Fähigkeit, eine Leistung erbringen zu können. Der Beruf ist zudem mit der Erweiterung von Handlungsspielräumen bzw. dem Erproben eigener Fähigkeiten verknüpft und dient „zur wechselseitigen Identitätsschablone, mit deren Hilfe wir die Menschen, die ihn „haben“, einschätzen in ihren persönlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten, ihrer ökonomischen und sozialen Stellung“ (Beck 1986, S. 221). Er garantiert weiterhin grundlegende Sozialerfahrungen und kann die Öffnung zu machthaltigen Wissensnetzwerken bedeuten (Schett 2005, S. 81). Entsprechend hoch ist der Stellenwert, den Beruf und Erwerbstätigkeit für das Selbstverständnis eines Menschen einnehmen, da Anerkennung, Ansehen und Einfluss in modernen Gesellschaften in erster Linie über den Weg der Erwerbsarbeit zu erreichen sind.
Der zentralen Bedeutsamkeit dieses Lebensbereiches stehen hingegen die unter gegenwärtigen Gesellschaftsbedingungen bestehenden Teilhabechancen regelrecht konträr gegenüber: Prozesse der Technisierung und Rationalisierung haben ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage im Hinblick auf die Beschäftigungs-möglichkeiten hervorgerufen. Durch die globale Vernetzung haben sich die Arbeitsverhältnisse - und damit auch die Lebensverhältnisse der Menschen - geändert: Mobilität und Flexibilität sind die neuen Grundvoraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt geworden. Arbeitnehmer können sich also nicht mehr auf bestimmte, gleich bleibende Arbeitszeiten festlegen, sondern müssen auch örtlich flexibel und somit in der Lage sein, ihr Verhalten und Handeln schnell an die jeweiligen, neuen beruflichen Gegebenheiten anzupassen. Dies erfordert ein breites Spektrum an automatisierten und sofort abrufbaren Handlungspotentialen, als auch eine adäquate Ausstattung im Bereich des strategisch - kreativen Denkens, um sich auf immer neue Situationen einstellen zu können. Bei stärker werdendem Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt wird damit eine hohe kognitive Informationsverarbeitungskompetenz immer wichtiger (vgl. Schett 2005, S. 90). Restriktive Grundtätigkeiten und Routinearbeiten sind im Rückgang begriffen, einfache, manuelle Tätigkeiten für weniger Gebildete nehmen ab, vor allem durch die fortschreitende Automatisierung bedingt. Hinzu kommen der steigende Druck und die wachsende Belastung für den Einzelnen in der Arbeitswelt aufgrund des knapp gewordenen Jobangebotes. Arbeitskräfte sind in einem Maße freigesetzt wurden, dass eine kontinuierliche „Normalerwerbsbiographie“ in Form von Schulbildung, Berufsausbildung und lebenslanger Vollbeschäftigung im ursprünglich erlernten Beruf faktisch nicht mehr existent ist, obgleich gegenwärtig (immer) noch die allgemein geteilte Vorstellung darüber zu existieren scheint, wie eine Biographie bzw. ihre Teilverläufe (berufliche Karriere bis zu einem bestimmten Lebensalter) zu verlaufen haben. Vielmehr sind Brüche, Diskontinuitäten und sich abwechselnde Phasen von Qualifikation, befristeter (Teilzeit-) Beschäftigung, Ausschluss aus dem Beschäftigungssystem (in Form von Arbeitslosigkeit), Neu- bzw. Nachqualifizierung und erneuter Beschäftigung längst zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen geworden (vgl. Orthmann - Bless 2006, S. 34 f.). An die Stelle der ein ganzes Arbeitsleben andauernden Erwerbstätigkeit in einem Normalarbeitsverhältnis tritt verstärkt eine allgemeine Tauglichkeit für Erwerbsarbeit: “lifetime employment“ wird durch “lifetime employability“ ersetzt - die Fähigkeit und Bereitschaft, im Laufe der Zeit mehrere Berufe bzw. Tätigkeitskombinationen auszuüben. Erwerbsarbeit und Beruf als „Achse der Lebensführung“ besitzen folglich keine Sicherheits- und Schutzfunktionen mehr, da die „Norm“ lebenslanger, standardisierter Ganztagsarbeit längst durch vielfältige Formen arbeitszeitlicher Flexibilisierungen im Sinne von „Grauzonen“ zwischen (Dauer-) Arbeitslosigkeit und (Unter-) Beschäftigung aufgebrochen wurden (vgl. Beck 1986, S. 220). Die Planbarkeit eines kontinuierlichen beruflichen Lebens löst sich für immer mehr Menschen im Vergleich zu früher auf, da Beruf und Arbeitsmarkt erodieren. Das Bewusstsein lebenslanger Beschäftigung ist zunehmend der Einsicht gewichen, dass entstandardisierte und diskontinuierliche Erwerbsbiographien - hierzu zählen „atypische“ und gleichzeitig „prekäre“ Beschäftigungsverhältnisse wie Teilzeitarbeit, geringfügige bzw. sozialversicherungsfreie Beschäftigung, Leiharbeit und befristete Beschäftigung - mittlerweile aufgrund ihrer wachsenden Häufigkeit der „Normalität“ angehören und sich vor allem der Sektor der niedrig Entlohnten und prekär Beschäftigten immer weiter ausdehnt (siehe Abbildung).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Entwicklung der Erwerbstätigkeit nach Beschäftigungsformen,
Abbildung in: Floren 2007, S. 27)
1.2.2 Bedeutung und Funktionen von Freizeit
Wird Freizeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene betrachtet, dann kann die Stellung von Personen in diesem Sektor wichtige Aufschlüsse über ihre soziale und kulturelle Integration bzw. ihre Tendenz zu subkultureller Ausgrenzung und dergleichen geben.
Der Freizeitbereich stellt ein hochvalentes Feld der intrinsischen Befriedigungen und des Ausgleichs dar. Er bildet eine subjektive Sinnwelt, die Angebote und Hilfen zur Identitätsbildung und Selbstdarstellung bereitstellt. Freizeit liefert zudem die wichtigsten Möglichkeiten für Erholung, Ausgleich, Entspannung als auch Freude und Spaß. In ihr artikulieren sich zugleich wesentliche Konflikte zwischen Gruppenloyalitäten sowie Abhängigkeit und Ablösung von der Herkunftsfamilie.
Identitätsentwicklung im Freizeitbereich bedeutet herauszufinden, was man selbst mag, wie man sich selbst darstellen und sein Leben gestalten möchte. Es geht weiterhin um die Ausbildung eines Freizeitbewusstseins, zu dem die reflektierte und kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Freizeitverhalten gehört. Sich dabei bewusst zu verhalten bedeutet in diesem Zusammenhang, selbst darüber entscheiden zu können, was man innerhalb vorgegebener Freizeitbedingungen (z. B. in Form gesellschaftlicher Angebots- und Zeitstrukturen, ökonomischer Bedingungen sowie divergierender Anforderungen anderer Lebensbereiche u. Ä.) für sich in der Freizeit tun will und kann (vgl. Orthmann - Bless 2006, S. 81).
1.2.3 Wohnen
Eine Wohnung ist unter lebensweltlichen Aspekten sowohl ein räumlicher als auch zeitlicher Ausgangs- bzw. Orientierungspunkt und für das innere Gleichgewicht eines Menschen von signifikanter Bedeutung. Sie bildet ein wichtiges Refugium für die wachsende Freizeit bzw. Erholung von Arbeit und ist folglich verbunden mit einem Ort, an dem sich das Individuum geborgen und zuhause fühlt; befriedigt Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Schutz, Selbstdarstellung und Selbstbestimmung, als auch nach Kontakt und Kommunikation. Im Zuge der allgemeinen Verbesserung materieller Lebensverhältnisse hat die Sensibilität für das Umfeld der Menschen zugenommen. Die Ausstattung von Wohnverhältnissen dient der Selbstverwirklichung des Einzelnen sowie dem Ausdruck und der Stilisierung der persönlichen Lebensweise. Die Qualität und der damit in Zusammenhang stehende Lebensstandard derselben bemessen sich u. a. an der Größe, dem Preis und der Umwelt (Luftqualität, landschaftliche Schönheit, infrastrukturelle Ausstattung, welche die Voraussetzung für viele Aktivitäten darstellt).
Die Verselbständigung im Wohnen bietet für junge Menschen Möglichkeiten, eine individuelle Lebensweise zu entwickeln bzw. zu gestalten und damit Identität auszubilden. Gleichzeitig sind Wohnweise und Wohnkultur aber auch Repräsentanten der Normen einer Gesellschaft, d. h. der sozialen Zugehörigkeit eines Individuums, seiner Verfügung über materielle und kulturelle Ressourcen und damit der Integration in das gesellschaftliche Gesamt (vgl. Orthmann - Bless 2006, S. 96). Die räumliche Ablösung von der Herkunftsfamilie und die wohnmäßige Verselbständigung sind heute i. d. R. nicht mehr normativ an ein bestimmtes Lebensalter und auch nicht an den Statuserwerb in anderen Lebensbereichen gebunden. Die gesellschaftliche Tatsache, dass die Ablösung junger Menschen vom Elternhaus in erster Linie durch das Gesamt ihrer Lebensentwürfe ermöglicht oder verhindert wird und weniger eine Frage der persönlichen Wünsche ist, erlangt für junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen besonderes Gewicht. Die Betroffenen sind im Gegensatz zur Gesamtgruppe der Gleichaltrigen nicht nur in diesem Lebensbereich deutlich eingeschränkt. Deshalb sind sie in Folge in verstärktem Maße zur Mobilisierung von Bewältigungsstrategien gezwungen. Diese können bspw. in einem (freiwilligen oder erzwungenen) Aufschub von Ablösungsprozessen zugunsten des längerfristigen Verweilens im Elternhaus als abhängige Wohnform bestehen.
1.2.4 Strukturwandel in Partnerschaft und Familie
Partnerschaft, Ehe und Familie haben sich in ihren Konstellationen und ihrer Dynamik verändert, da sich der Zusammenhang von Familie und eigener Biographie gelockert hat. Familiäre Lebensformen existieren gegenwärtig in hoch ausdifferenzierter Form. Eine große Variationsbreite von familiären und außerfamiliären Formen des Zusammenlebens ist nebeneinander entstanden bzw. bleibt nebeneinander bestehen. Charakteristischerweise werden viele von ihnen (z. B. Single - Dasein, nichteheliche Lebensgemeinschaften, etc.) als verschiedene Phasen in einen Gesamtlebenslauf integriert (bzw. werden müssen). Über relativ kurze Zeitspannen lassen sich dabei Veränderungen (siehe Abbildung) feststellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland nach Lebensform, 1996 - 2005,
Abbildung auf: http://www.bib-demographie.de [Stand: 18.09.08]
So ist der Anteil von Personen, die einer ehelichen Familienform angehören, zwischen 1996 und 2005 um 13% gesunken. Im Gegenzug ist ein starker Anstieg nichtehelicher Lebensformen (mit und ohne Kinder) zu beobachten. Dies ist Ausdruck eines strukturellen Wandels, der auf die zu planende und zu realisierende Lebensgestaltung des Einzelnen Auswirkungen hat. Sowohl die Wahl einer oder aufeinander folgender verschiedener Lebensformen, als auch die inhaltliche Ausgestaltung selbiger sind in die individuelle Verantwortung gegeben: Auf der individuellen Ebene bedeutet die Pluralisierung der Lebensformen eine erhöhte Notwendigkeit für individuelle Entscheidungen bzw. individuelle Verantwortung für getroffene Entscheidungen. Entsprechend ist auch das durchschnittliche Erstheiratsalter in Deutschland zwischen 1960 und 2000 um etwa fünf Jahre gestiegen. Damals wie heute waren Männer bei ihrer ersten Eheschließung im Schnitt etwa zwei bis drei Jahre älter als Frauen (siehe Abbildung).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Durchschnittsalter bei der Erstheirat zwischen 1960 und 2005, Abbildung auf: http://www.bib-demographie.de [Stand: 18.09.08]
Die Gründe für spätere Eheschließungen sind vielfältig. Sie werden oft in äußeren Bedingungen, etwa den längeren Ausbildungszeiten, oft aber auch in individuellen Entscheidungen und Planungen gesehen. Die normativ geprägte Vorbestimmung von Lebensläufen spielt in unserer Zeit für den Einzelnen eine geringere Rolle: Vielmehr hängt es stärker von der eigenen Entscheidung ab, wann die Eheschließung am besten in den individuellen Lebensverlauf passt. Auch der Wert bzw. die Nutzenerwartungen an das Vorhandensein von Kindern haben sich gewandelt. Eine normative Verbindlichkeit, Kinder zu bekommen, besteht nicht (mehr). Die Familiengründung ist vielmehr zu einer denkens- und planungswerten Option neben anderen geworden, welche auf einen immer späteren Zeitpunkt im Lebenslauf gelegt wird.
2 Biographiearbeit und Individuation
2.1 Die junge Generation auf der Suche nach Orientierung und Identität
Die Bildungsexpansion mit der damit verbundenen Bildungsaspiration hat zweifelsohne Folgen für die veränderte gesellschaftliche Gestalt der Jugendphase gehabt, welche sich in Folge im Laufe der vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich verlängert bzw. in zwei unterschiedliche Richtungen ausgedehnt hat (siehe Abbildung).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung)
Mit der vergleichsweise längeren schulischen und beruflichen Ausbildungsdauer mehren sich einerseits die beruflichen Orientierungsmöglichkeiten in dieser Lebensphase. Des Weiteren wachsen junge Erwachsene heute im Allgemeinen „reicher“ auf als früher, was ökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen angeht und erwerben heute im Durchschnitt einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern (vgl. Ferchhoff 2002, S. 116). Sie sind dennoch gleichermaßen allerlei Armutsrisiken und Belastungen ausgesetzt und stehen mehr denn je unter dem permanenten Druck, Statusbedrohungen und Abwärtsmobilität zu vermeiden, da heutige Lebenschancen im Wesentlichen darauf beruhen, welche schulischen Bildungswege gewählt werden. Die Vermittlung, Institutionalisierung und der Erwerb von Bildung spielen in modernen Wissens- und Informationsgesellschaften eine signifikante Rolle, da gesellschaftliche Zusammenhänge immer komplexer werden und in Folge immer mehr Wissen von den Einzelnen fordern. Dies verlangt von jungen Menschen folglich neue Anpassungsleistungen, die u. a. in Jugendstudien und der „Agenda 21“ mit Begrifflichkeiten wie Problemlösungskompetenz, interdisziplinäres Denken, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit und vorausschauendes Planen bezeichnet werden. Jugendspezifische Erfahrungswelten werden somit immer komplexer und risikoreicher. Verschiedene, oftmals widersprüchliche Teilmündigkeiten und vielfältige, ambivalente Übergänge zum Erwachsenwerden konstituieren Jugend im heutigen Verständnis. „Jugendlichkeit“ ist das Leitbild fast jeden Lebensalters geworden.
Damit einher geht der Zwang, immer früher erwachsen zu sein oder zumindest zu wirken, während der reale Eintritt ins Erwachsenenleben häufig extrem verzögert wird. Die Lebensphase Jugend ist somit unüberschaubarer geworden, da sich die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsensein vermischen und zunehmend uneindeutiger werden.
Junge Erwachsene werden zunehmend auf sich selbst verwiesen und sollen als Erwachsene selbstverantwortlich entscheiden und in einer Gesellschaft handeln, die zukünftig die bereits erreichte Vielfalt an Standpunkten und Perspektiven noch weiter ausweiten wird. Das Jugend- und junge Erwachsenenalter ist damit zu einem hochgradig riskanten Lebensabschnitt erwachsen, in dem vielfältige Möglichkeitshorizonte existieren, so dass in der Kombinationsvielfalt und der Entscheidungskomplexität schon eine risikoreiche Form der Entstandardisierung und Individualisierung der Jugendphase liegt. Die erweiterten Möglichkeiten und Gestaltungsräume sowie die jugendkulturell inszenierte stilbildende Geltung, u. a. von Medien, Musik, Mode und Konsum, deuten also nicht nur auf die „Sonnenseite“ der Selbstverwirklichung hin, sondern enthalten auch Desintegrationsprozesse, da es für die Bewältigung der gesellschaftlich vorgehaltenen Optionen der Lebensgestaltung verschiedener Voraussetzungen bedarf, die für einzelne Gruppierungen variieren dürften. Es darf angenommen werden, dass junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen diesbezüglich benachteiligt sind und für sie folglich die Situation einer erhöhten Planungsnotwendigkeit bei gleichzeitig erhöhten Planungserschwernissen besteht.
2.2 Über die Notwendigkeit von Biographiearbeit
Der biographische Prozess kann als Folge von Lebensereignissen, Entwicklungsaufgaben als auch Wachstumskrisen begriffen werden. Lebensereignisse markieren in diesem Kontext wichtige Einschnitte, Veränderungen und Übergänge in der Lebensgeschichte, die eine Vorgeschichte besitzen, (weit reichende) Folgen nach sich ziehen, sich damit auf die verschiedenen Lebensbereiche auswirken und zu einer Veränderung der Lebensumstände führen können, auf die sich junge Menschen in der Gestaltung ihres Lebens einlassen müssen. Dies gilt vor allem bei kritischen Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit oder Scheidung (der Eltern) (vgl. Kraul, M./ Marotzki, W. 2002, S. 34). Biographiearbeit bezeichnet in diesem Sinne die Gestaltung des gesamten Lebens in Reflexion von Vergangenheit, auch - und vor allem - in Bezug auf das eigene Handeln, zur Gestaltung der Zukunft. Biographizität im Sinne von Arbeit des Menschen an seiner Biographie muss das Individuum angesichts einer Vielzahl von Entscheidungsalternativen leisten. Gefühle wie Interessen, Wünsche, Ängste als auch Abneigungen haben an der Gestaltung der Lebensgeschichte einen wesentlichen Anteil (Kraul, M./ Marotzki, W. 2002, S. 35). Der Biographieträger kann folglich als Organisator und Interpret des eigenen Lebens bezeichnet werden und steht als solcher sowohl in der Freiheit, als auch in der Notwendigkeit, als Akteur sein Leben zu gestalten.
Bereits im Erzählen wird Biographie konstruiert, die gebunden ist an die Individualität und Identität eines Menschen, wenn Erlebnisse erinnert werden, die in Beziehung zum Leben gesetzt werden. Identität steht in diesem Kontext für jene Leistung, sich selbst als eigenständiges und besonderes Individuum wahrzunehmen und akzentuiert die Fähigkeit, verschiedene Aspekte der Lebensgeschichte und der Lebenssituation in ein einheitliches und konsistentes Verständnis der eigenen Person zusammenzufügen. Dabei geht es nicht um eine „objektive“ Wahrheit, sondern vorrangig um das Anschauen und Verstehen der subjektiven Logik in der Gestaltung des eigenen Lebens im Sinne der Einzigartigkeit des Menschen und sein inneres Erleben, um Verstehensprozesse, die Veränderungsmöglichkeiten und Handlungspotenziale eröffnen können, als auch die Gesellschaft als gegebene Struktur bzw. Produkt menschlicher Gestaltung, die vorgefunden und erlebt wird. Die Wirksamkeit biographischen Erzählens liegt damit weniger in der Bewusstmachung von Verdrängtem als vielmehr in Sinnsetzungen, mit denen der Autobiograph sein Leben imstande ist zu sehen (vgl. Raabe 2004, S. 20). Hierin liegt natürlich auch die Grenze: Biographiearbeit kann zwar Gestaltungsräume sichtbar machen und Handlungsimpulse geben; die Entscheidungen im Leben, was zu tun bzw. zu unterlassen ist, bleibt freilich jedem selbst überlassen.
3 Die Analyse exemplarischer Lebensentwürfe junger Erwachsener in erschwerten Lebenslagen
3.1 Das methodische Vorgehen
3.1.1 Ableiten von Fragestellungen für die empirische Untersuchung
Die zentrale Intention der Forschungsarbeit im Sinne der Analyse exemplarischer Lebensentwürfe junger Erwachsener in erschwerten Lebenslagen, bezogen auf die Lebensbereiche…
- Ausbildung, Beruf und Einkommen
- Freizeit
- Wohnen
- Familie und soziale Beziehungen
- Beurteilung der eigenen sozialen Lage - Lebensstandard und -zufriedenheit im Ganzen,
konkretisiert sich vor dem dargelegten theoretischen Hintergrund. Eine weitere Zielstellung beinhaltet die Analyse der Kompatibilität und Abstimmung bereichsspezifischer Auseinandersetzungen mit den Wünschen und Zielen in anderen Lebensbereichen sowie Bewältigungsstrategien beim Umgang mit möglichen Divergenzen. Die aktuellen Lebenssituationen (und Antizipationen) der Befragten werden dabei zunächst bereichsweise beschrieben.
Bezüglich des Bereiches Ausbildung, Beruf und Einkommen wurden der aktuelle Berufs-, Erwerbs- und Einkommensstatus sowie antizipierte Präferenzen (zukünftige Berufswünsche) inhaltlich erfasst.
Im Hinblick auf die persönlich wahrgenommene Bedeutung von Freizeit ließen sich Funktionen und damit verknüpfte Bedürfnisse im Zusammenhang mit bestimmten Aktivitäten betrachten. Erfragt wurden derzeitige Freizeitaktivitäten, weitere Interessen und Freizeitpartner, um den Stellenwert des Freizeitbereiches im gegenwärtigen Lebenszusammenhang zu erfassen. Des Weiteren thematisierten die Befragten den grundsätzlichen Stellenwert des Freizeitsektors.
Konkrete individuelle Bedeutungen und Funktionen des Wohnens fanden hauptsächlich in den Antizipationen zu Sozialgefügen und Haushaltstypen bzw. zu verschiedenen Charakteristika der anvisierten Wohnverhältnisse Ausdruck - auch im Sinne der Ablösung von der Herkunftsfamilie.
Im Bereich der familiären Lebensformen interessieren vor allem Antizipationen bezüglich der präferierten Gestaltung und Institutionalisierung von Partnerschaften sowie zum grundsätzlichen Kinderwunsch, zur antizipierten Kinderzahl und zum vorgesehenen Zeitpunkt des Übergangs zur Elternschaft. Zudem werden Partnerwunschvorstellungen thematisiert. Des Weiteren äußern sich die Befragten zur Bedeutung familiärer Bindungen als auch von Freundschaftsnetzwerken. Besonders interessant sind die Beziehungen untereinander und dabei vor allem deren sinnstiftende Funktion für die eigene Biographie. Dabei spielt es für die Beurteilung von Quantität und Qualität sozialer und emotionaler Unterstützung eine entscheidende Rolle, welche Ressourcen der Einzelne für sich tatsächlich aktivieren kann. Von Bedeutung ist dabei vor allem auch die Art und Weise, in der sich der Biographieträger selbst in Beziehung zu anderen darstellt, da er sich durch die von ihm genannten Ereignisträger unterstützt, bestärkt oder behindert fühlen kann.
Hinsichtlich der Beurteilung der eigenen sozialen Lage steht die Wahrnehmung der Qualität des Lebens, das geführt wird, im Fokus der Aufmerksamkeit. Hierzu zählen sowohl die Reflexion bisheriger Entscheidungen als auch persönliche Erwartungshaltungen hinsichtlich der Gestaltung des zukünftigen Lebensweges. Diese Beurteilungen schließen auch Empfindungen der (Un-) Zufriedenheit ein.
3.1.2 Die Bestimmung der Zielgruppe
Die Auswahl der Zielgruppe richtete sich nach dem Ziel der Forschungsfrage. Zur empirischen Bearbeitung der hier formulierten Fragestellung war dafür eine Operationalisierung des Phänomens „erschwerte Lebenslage“ erforderlich. Da spezielle Persönlichkeitsmerkmale, die diese jungen Erwachsenen von anderen zweifelsfrei unterscheiden, nicht existieren, ergab sich aus dem Forschungsdesign, dass Personen einbezogen wurden, welche zunächst typische „Maßnahmekarrieren“ aufgrund einer durchweg brüchigen Berufsbiographie aufwiesen. Dies beinhaltete folglich den erschwerten Übergang von der Schule in das Berufsleben und die sich daraus ableitende erschwerte Integration in die Gesellschaft, bspw. aufgrund des familiären bzw. sozialen Umfeldes oder der materiellen Situation.
Das Konstrukt „erschwerte Lebenslage“ verweist demzufolge auf die geringere Ausstattung mit finanziellen, sozialen und kulturellen Ressourcen der Zielgruppe im Sinne...
- ökonomisch - situativer Benachteiligungen
- bildungsbedingter Benachteiligungen
- sozial - individuell bedingter Benachteiligungen.
3.1.3 Die Gewinnung der Interviewpartner
Da es mir nicht um Repräsentativität, sondern um ein möglichst zutreffendes Set der relevanten Handlungsmuster ging, hatte ich im Theoretical Sampling Personen angefragt, die zu meiner Fragestellung auch Bezug nehmen konnten. Bei der Auswahl der Interviewpartner spielten dabei informelle Kontakte zu meinem früheren Arbeitgeber sowie teilweise noch zur untersuchenden Personengruppe eine entscheidende Rolle. Aus Gründen der Praktikabilität ergab sich eine regionale Einschränkung der Befragten auf den Landkreis Harz. Die Probanden hatte ich telefonisch angefragt und über die Interviews aufgeklärt. Deren spontane Zusage werte ich als Ausdruck des persönlichen Interesses an der Thematik und individuellen „Betroffenheit“. Diese Einschätzung wird auch durch das Verhalten der Interviewten bestätigt, die sich auffallend motiviert, interessiert und gesprächsbereit zeigten. Die Gesprächstermine wurden nach anfänglichem Telefonkontakt verabredet und fanden aufgrund der Bedeutung der natürlichen Feldsituation in den Wohnungen der Befragten statt.
3.1.4 Die Datenerhebung
Die Intention der Arbeit erforderte ein hypothesengenerierendes, qualitativ - exploratives Vorgehen. Im Zentrum der Datenerhebung standen halbstrukturierte Interviews, bezogen auf die einzelnen Lebensbereiche in der Einzelsituation, bei denen wie bei narrativen Interviews das Erzählungsprinzip zu Grunde liegt. Diese gliederten sich wie folgt:
- Einführung
- persönliche Kontaktaufnahme
- Erläuterung des Erkenntnisinteresses und der geplanten Vorgehensweise
- Erklärung der Aspekte der Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der Aufzeichnungstechnik
- Erhebung der personenbezogenen Daten mittels eines Kurzfragebogens, um die innerhalb der Leitfadeninterviews gewonnenen Informationen inhaltlich zu ergänzen und validieren zu können.
Bei der Datenerhebung verwendete ich zunächst einen standardisierten Kurzfragebogen zur aktuellen Lebenssituation (siehe Anhang), der personenbezogene Daten der Befragten erfasste, die nicht mehr während des Interviews eruiert werden mussten und somit nicht den Gesprächsfluss durch Fragen unterbrachen. Zum anderen dienten mir die in ihm enthaltenen Informationen - und insbesondere in Kombination mit einer offenen Frage - zu einem Gesprächseinstieg.
Nach der Sicherung des Verständnisses für Intention, Inhalte und Ablauf der Datenerhebung begann der Hauptteil der halbstrukturierten Interviews. Ein wichtiges Instrument stellte hierbei der Gesprächsleitfaden dar (siehe Anhang), der mir als Gliederungshilfe und Orientierungsrahmen diente und einen organisierten Überblick über die einzelnen Lebensbereiche lieferte. Dieser beinhaltete im Hauptteil die bereits genannten Themenkomplexe:
- Hauptteil
- Ausbildung, Beruf und Einkommen
- Freizeit
- Wohnen
- Familie und soziale Beziehungen
- Beurteilung der eigenen sozialen Lage - Lebensstandard und -zufriedenheit im Ganzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(eigene Darstellung)
Diese Themenbereiche repräsentierten jene Lebensbereiche, für die ich für junge Erwachsene in erschwerten Lebenslagen besondere Schwierigkeiten innerhalb der Lebensbewältigung erwartete, wobei die einzelnen Themenblöcke nicht verpflichtend in einer festgelegten Reihenfolge bearbeitet werden mussten und Möglichkeiten zur Ergänzung eigener Themen aus Sicht der Befragten meinerseits gegeben wurden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer „Risikobiographie“?
Es handelt sich um Lebensverläufe junger Erwachsener, die durch Brüche, Ausgrenzung oder Benachteiligung (z.B. Schulabbruch) geprägt sind und ein hohes Maß an Bewältigungskompetenz erfordern.
Warum ist Biographiearbeit für junge Erwachsene in erschwerten Lagen wichtig?
Biographiearbeit hilft den Betroffenen, ihre eigene Lage zu reflektieren, Identität zu finden und trotz negativer Ereignisverkettungen neue Gestaltungsspielräume für die Zukunft zu erschließen.
Welche Lebensbereiche werden in der Studie untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Ausbildung, Beruf, Einkommen, Freizeit, Wohnen sowie Partnerschaft und soziale Beziehungen.
Wie beeinflusst der gesellschaftliche Wandel diese Lebensentwürfe?
Die zunehmende Individualisierung und der Strukturwandel (z.B. vom Beruf auf Lebenszeit zur Lebensabschnittstätigkeit) erhöhen den Entscheidungsdruck und das Risiko für Fehlentscheidungen.
Welche Methode wurde für die Analyse verwendet?
Es wurden Einzelfallanalysen basierend auf halbstrukturierten Interviews durchgeführt, um die subjektive Sichtweise der jungen Erwachsenen zu erfassen.
- Arbeit zitieren
- Annika Schmidt (Autor:in), 2008, Risikobiographien - Lebensentwürfe junger Erwachsener in erschwerten Lebenslagen , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138651