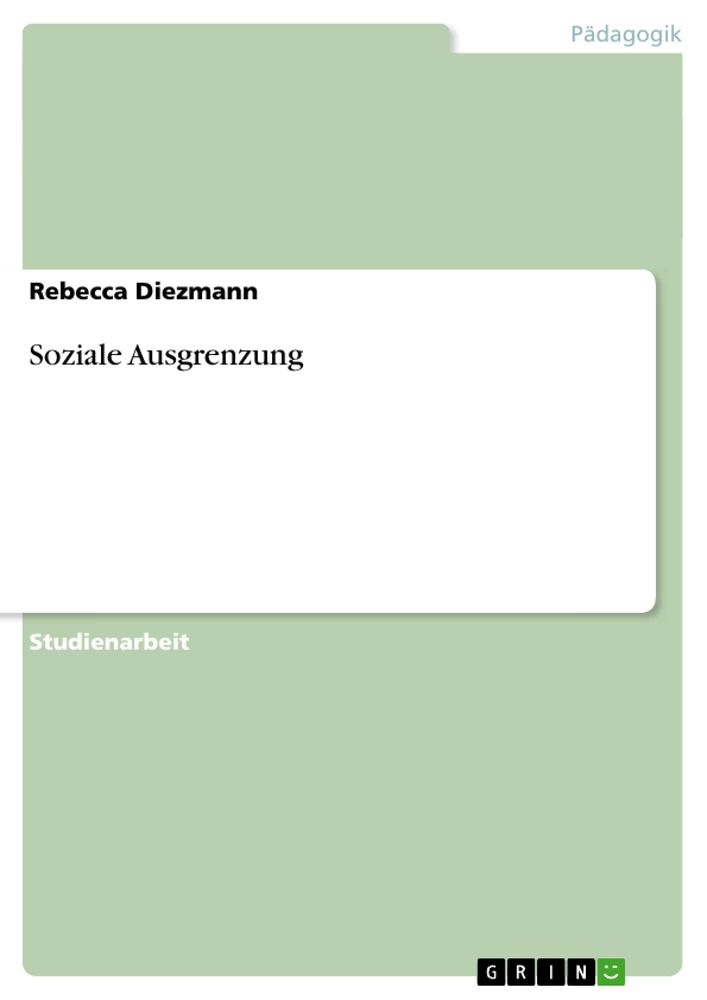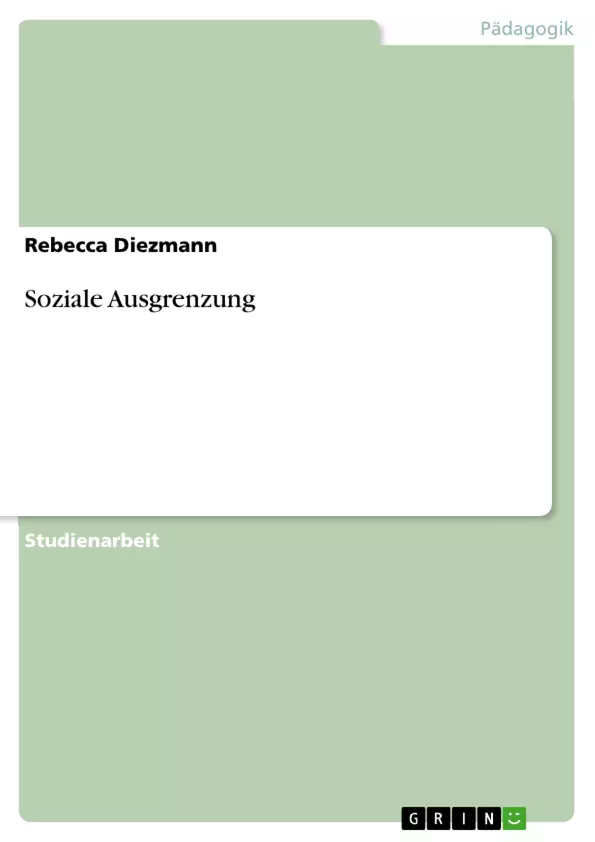Wachsende Armut und hohe Arbeitslosigkeit bei abnehmenden Ressourcen der Sozialstaaten
verändern seit den 80er Jahren tiefgreifend die meisten westlichen Gesellschaften. Mit vereinzelten
Ausbrüchen von Gewalt demonstrierten Jugendliche in französischen und englischen
Vorstädten, so dass eine tiefer werdende Kluft der Perspektivlosigkeit sie vom Rest der Gesellschaft
trennt. Selbst in den USA hat sich mit ihrer langen Geschichte der Minderheitenghettos
die Isolierung der Armenviertel in den Großstädten und die Chancenlosigkeit ihrer
Bewohner verschärft. Weniger spektakulär, aber im öffentlichen Bewusstsein durchaus gegenwärtig,
vollzieht sich in Westeuropa der Ausschluss einer wachsenden Zahl von Langzeitarbeitslosen
aus dem Erwerbsleben. Die momentane Beschäftigungskrise trifft das Selbstverständnis
und das Institutionengefüge der entwickelten Industriegesellschaften in sehr spezifischer
Weise: Sie hat eine neue historische Qualität angenommen. Dies gilt in dreifacher Hinsicht.
Erstens reichen die Beschäftigungseffekte des wirtschaftlichen Wachstums nicht mehr
aus, auf absehbare Zeit, das Arbeitskräfteangebot zu absorbieren. Mehr noch, in der Industrie
ist wirtschaftliches Wachstum selbst zum Motor der Arbeitsplatzvernichtung geworden (vgl.
Dahrendorf 1988, Europäische Kommission 1994,). Deshalb droht in Westeuropa Arbeitslosigkeit
zu einem Dauerzustand zu werden. Zweitens hat sich der historische Kontext für die
Bevölkerungsgruppen, die von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind, verändert. Während
Arbeitslosigkeit in früheren Epochen eingebettet war in eine Expansion von an- und ungelernter
Industriearbeit, schrumpft mittlerweile gerade dieses Beschäftigungselement seit Jahren.
Fraglich ist mehr, ob das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungsbereich diesen Verlust
kompensieren kann (vgl. Europäische Kommission 1994). Zu einem entscheidenden Zugangsund
Ausschlusskriterium am Arbeitsmarkt wird deshalb in immer stärkeren Maße Qualifikation.
Das Resultat ist in Westeuropa eine in sich gespaltene Arbeitslosigkeit: Als vorübergehende
Unterbrechung der Erwerbszeitraums (in der Regel mit ungewissem Ausgang) reicht
sie in immer weitere Bevölkerungskreise hinein. Zugleich wirkt sie selektiv und bedroht auch
an- und ungelernte Arbeitskräfte mit vollständigem Ausschluss am Arbeitsmarkt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Neue Problemlagen, Herausforderung an die Forschung
- Begriffliche Annäherung: „Peripheriesierung“, „Exclusion“, „Underclass“
- Wer wird ausgegrenzt, in welcher Weise und mit welchen gesellschaftlichen Folgen?
- Wer ist von Ausgrenzung bedroht?
- Was bedeutet Ausgrenzung für die Gesellschaft?
- Was bedeutet Ausgrenzung für die Betroffenen?
- Wie scharf ist der Bruch zwischen „innen“ und „außen“?
- Soziale Ausgrenzung nach Silvia Staub-Bernasconi
- Machtproblem
- Ressourcenerschließung
- Das Konzept Silva Staub-Bernasconis bezogen auf Psychisch Kranke
- Exkurs: Anfänge der Ausgrenzung psychisch Kranker
- Exkurs: Psychische Erkrankung und psychische Behinderung
- Versorgungsbedarf und Bedürfnisse psychisch Kranker
- Schwierigkeiten der Befriedigung der Bedürfnisse – Fallbeispiel -
- Schwierigkeiten durch diagnostische Unsicherheit: Behinderungs- und Begrenzungsmacht
- Schwierigkeiten der Ressourcenerschließung
- Schwierigkeiten in der Familie
- Warum überhaupt berufliche Rehabilitation?
- Grundlagen beruflicher Rehabilitation
- Berufsbildende Umschulungs- und Ausbildungsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der sozialen Ausgrenzung, einem Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Ausgrenzungsprozessen und deren Folgen für die Betroffenen sowie für die Gesellschaft als Ganzes. Insbesondere wird das Konzept von Silvia Staub-Bernasconi in Bezug auf psychisch Kranke beleuchtet, um die Herausforderungen der Ressourcenerschließung und die Schwierigkeiten in der Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verdeutlichen.
- Definition und Analyse von sozialen Ausgrenzungsprozessen
- Bedeutung und Auswirkungen von Ausgrenzung für die Gesellschaft
- Die Rolle von Machtstrukturen und Ressourcenerschließung in der Ausgrenzung
- Besonderheiten der Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Herausforderungen der beruflichen Rehabilitation psychisch Kranker
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit beleuchtet die neuen Problemlagen und Herausforderungen der Forschung im Kontext der sozialen Ausgrenzung. Es werden die Ursachen und Auswirkungen von wachsender Armut, hoher Arbeitslosigkeit und abnehmenden Ressourcen der Sozialstaaten diskutiert. Das zweite Kapitel widmet sich der begrifflichen Annäherung an soziale Ausgrenzung und beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Konzepte, die im Zusammenhang mit der Ausgrenzung verwendet werden. Das dritte Kapitel untersucht empirisch, wer von Ausgrenzung bedroht ist, welche gesellschaftlichen Folgen sie hat und wie sich die Ausgrenzung auf die Betroffenen auswirkt. Das vierte Kapitel stellt das Konzept von Silvia Staub-Bernasconi vor, das die Bedeutung von Macht und Ressourcenerschließung für die Entstehung von Ausgrenzung hervorhebt. Das fünfte Kapitel wendet das Konzept von Staub-Bernasconi auf den Kontext psychisch Kranker an und analysiert die spezifischen Herausforderungen, denen psychisch Kranke in Bezug auf Ausgrenzung und Integration begegnen.
Schlüsselwörter
Soziale Ausgrenzung, Peripheriesierung, Exclusion, Underclass, Machtproblem, Ressourcenerschließung, psychische Erkrankung, psychische Behinderung, berufliche Rehabilitation.
Häufig gestellte Fragen zu sozialer Ausgrenzung
Was versteht man unter sozialer Ausgrenzung?
Soziale Ausgrenzung (Exclusion) beschreibt den Prozess, bei dem Individuen oder Gruppen dauerhaft vom Arbeitsmarkt, sozialen Sicherungssystemen und der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden.
Wer ist heute besonders von Ausgrenzung bedroht?
Besonders gefährdet sind Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen, da Qualifikation zum zentralen Zugangskriterium geworden ist.
Was besagt das Konzept von Silvia Staub-Bernasconi?
Staub-Bernasconi analysiert Ausgrenzung als Machtproblem und untersucht die Schwierigkeiten der Ressourcenerschließung für Betroffene, um wieder Teil der Gesellschaft zu werden.
Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit als „Dauerzustand“ aus?
Wenn wirtschaftliches Wachstum keine neuen Arbeitsplätze mehr schafft, droht eine Spaltung der Gesellschaft in eine integrierte Mehrheit und eine perspektivlose „Underclass“.
Warum ist berufliche Rehabilitation für psychisch Kranke schwierig?
Herausforderungen liegen in diagnostischen Unsicherheiten, Stigmatisierung und dem hohen Bedarf an spezifischer Unterstützung bei der Erschließung von Ressourcen am Arbeitsmarkt.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Diezmann (Autor:in), 2003, Soziale Ausgrenzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13871