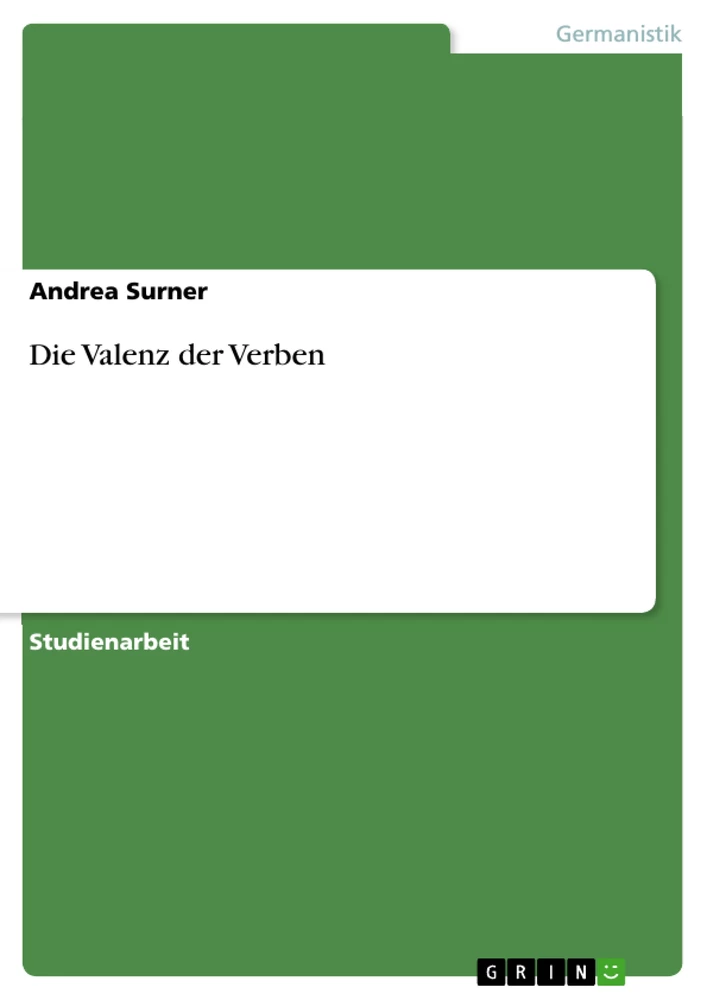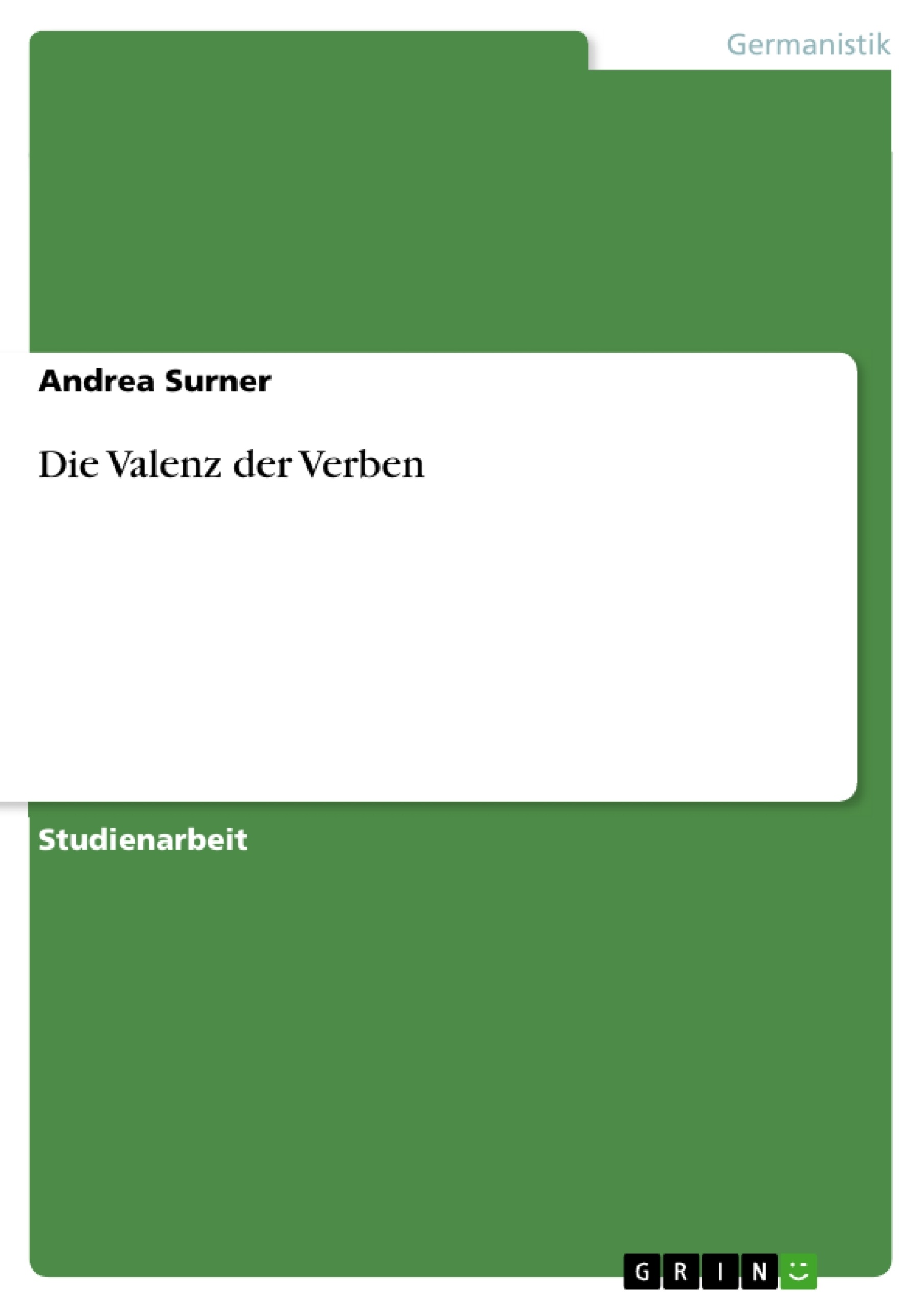In dieser Hauptseminararbeit werden, aufbauend auf einer Kritik an der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik, erst die Grundzüge der Valenz- oder Dependenztheorie nach TESNIÈRE vorgestellt, um dann auf modernere Forschungsansätze einzugehen. Dabei wird der semantische Valenzbegriff nach BONDZIO kurz dargestellt, das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf dem syntaktischen Valenzbegriff nach HELBIG /SCHENKEL. Natürlich können nicht alle Forschungsansätze bezüglich des komplexen Themas Verbvalenz durchleuchtet werden, es soll jedoch in seinen Grundzügen verständlich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kritik an der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik
- 2.1 Allgemeines zur Subjekt-Prädikat-Grammatik
- 2.2 Sätze ohne Subjekt oder ohne Prädikat
- 2.3 Die Kongruenz
- 3. Die Anfänge der Valenz- oder Dependenzgrammatik
- 3.1 Allgemeines zum Begriff Valenz
- 3.2 Der Valenzbegriff bei TESNIÈRE
- 3.2.1 Das Grundmodell der Dependenzgrammatik
- 3.2.2 Arten der Verbvalenz
- 3.2.3 Kritik am TESNIÈREschen Valenzbegriff
- 4. Erweiterung der Valenzgrammatik
- 4.1 Semantischer Valenzbegriff nach BONDZIO
- 4.2 Syntaktischer Valenzbegriff nach HELBIG / SCHENKEL
- 4.2.1 Das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes
- 4.2.2 Obligatorische Valenz, fakultative Valenz und freie Angaben
- 4.2.3 Rolle der Satzglieder für die Valenz
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Valenz der Verben im Deutschen, indem sie die traditionelle Subjekt-Prädikat-Grammatik kritisch beleuchtet und die Entwicklung der Valenz- oder Dependenzgrammatik nachzeichnet. Der Fokus liegt auf der Darstellung des semantischen und syntaktischen Valenzbegriffs, insbesondere nach Bondzio und Helbig/ Schenkel.
- Kritik der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik
- Einführung des Valenzbegriffs nach Tesnière
- Vergleichende Betrachtung des semantischen (Bondzio) und syntaktischen (Helbig/Schenkel) Valenzbegriffs
- Analyse der Rolle des Verbs als strukturelles Zentrum des Satzes
- Untersuchung der verschiedenen Arten der Verbvalenz (obligatorisch, fakultativ, freie Angaben)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verbvalenz ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des Valenzbegriffs als Weiterentwicklung der traditionellen Grammatik und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit der Subjekt-Prädikat-Grammatik sowie die detaillierte Darstellung der Valenztheorie nach Tesnière und neuerer Ansätze an. Der Fokus liegt auf der Verständlichkeit der komplexen Thematik.
2. Kritik an der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik: Dieses Kapitel analysiert kritisch die traditionelle Subjekt-Prädikat-Grammatik. Es beleuchtet die grundlegende grammatische Relation von Subjekt und Prädikat, ihre historische Entwicklung und unterschiedliche Interpretationen des Verhältnisses beider Satzglieder. Es werden verschiedene Konzeptionen aus der Literatur vorgestellt, die das Verhältnis von Subjekt und Prädikat unterschiedlich definieren, um die Grenzen und Einschränkungen dieses traditionellen Modells aufzuzeigen. Die Diskussion von Sätzen ohne Subjekt oder Prädikat unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenderen grammatikalischen Modells, das über die klassische Subjekt-Prädikat-Struktur hinausgeht.
3. Die Anfänge der Valenz- oder Dependenzgrammatik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen der Valenz- bzw. Dependenzgrammatik, beginnend mit einer allgemeinen Einführung des Valenzbegriffs. Der Schwerpunkt liegt auf Tesnières Beitrag, seinem Grundmodell der Dependenzgrammatik und den verschiedenen Arten der Verbvalenz. Die Kritik an Tesnières Konzept wird ebenfalls diskutiert, um die nachfolgenden Erweiterungen und Modifikationen der Valenztheorie vorzubereiten. Die Darstellung des Dependenzmodells bildet die Grundlage für das Verständnis modernerer Ansätze der Valenzgrammatik.
4. Erweiterung der Valenzgrammatik: Dieses Kapitel widmet sich der Erweiterung der Valenzgrammatik durch neuere Ansätze. Es präsentiert zunächst den semantischen Valenzbegriff nach Bondzio, bevor der syntaktische Valenzbegriff nach Helbig/Schenkel im Detail erläutert wird. Die Analyse der Rolle des Verbs als strukturelles Zentrum des Satzes, die Unterscheidung zwischen obligatorischer, fakultativer Valenz und freien Angaben sowie die Bedeutung der Satzglieder für die Valenz werden ausführlich behandelt. Diese Kapitelsektion vergleicht und kontrastiert die verschiedenen theoretischen Perspektiven und integriert sie in einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Valenzgrammatik.
Schlüsselwörter
Verbvalenz, Dependenzgrammatik, Subjekt-Prädikat-Grammatik, Tesnière, Bondzio, Helbig/Schenkel, Satzstruktur, semantische Valenz, syntaktische Valenz, obligatorische Valenz, fakultative Valenz, freie Angaben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Verbvalenz im Deutschen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zur Verbvalenz?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über die Verbvalenz im Deutschen. Sie beginnt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik und verfolgt dann die Entwicklung der Valenz- oder Dependenzgrammatik. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich des semantischen Valenzbegriffs nach Bondzio und des syntaktischen Valenzbegriffs nach Helbig/Schenkel. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis.
Welche Grammatik-Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die traditionelle Subjekt-Prädikat-Grammatik kritisch mit der Valenz- oder Dependenzgrammatik. Im Detail werden die Ansätze von Tesnière, Bondzio und Helbig/Schenkel hinsichtlich des Valenzbegriffs untersucht und gegenübergestellt. Der Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen semantischer und syntaktischer Valenz.
Was ist der Valenzbegriff nach Tesnière?
Die Arbeit erläutert Tesnières Grundmodell der Dependenzgrammatik und seine verschiedenen Arten der Verbvalenz. Sie beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit Tesnières Konzept, um die nachfolgenden Erweiterungen und Modifikationen der Valenztheorie zu kontextualisieren.
Wie unterscheiden sich die Valenzbegriffe nach Bondzio und Helbig/Schenkel?
Die Arbeit beschreibt den semantischen Valenzbegriff nach Bondzio und den syntaktischen Valenzbegriff nach Helbig/Schenkel. Der Unterschied liegt im Schwerpunkt: Bondzio betrachtet die Bedeutung der Wörter und ihre semantische Beziehung zum Verb, während Helbig/Schenkel sich auf die syntaktische Struktur und die Position der Satzglieder konzentrieren. Die Arbeit vergleicht beide Ansätze und integriert sie in einen umfassenden Überblick.
Welche Arten von Verbvalenz werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen obligatorischer, fakultativer Valenz und freien Angaben. Sie erklärt die Rolle dieser verschiedenen Arten von Valenz für die Satzstruktur und die Bedeutung des Verbs als strukturelles Zentrum des Satzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kritik an der traditionellen Subjekt-Prädikat-Grammatik, Die Anfänge der Valenz- oder Dependenzgrammatik, Erweiterung der Valenzgrammatik und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Verbvalenz, Dependenzgrammatik, Subjekt-Prädikat-Grammatik, Tesnière, Bondzio, Helbig/Schenkel, Satzstruktur, semantische Valenz, syntaktische Valenz, obligatorische Valenz, fakultative Valenz, freie Angaben.
Für wen ist diese Arbeit geeignet?
Diese Arbeit ist für Studierende der Linguistik und Germanistik, sowie für alle Interessierten an der deutschen Grammatik und der Valenztheorie geeignet.
- Arbeit zitieren
- Andrea Surner (Autor:in), 2008, Die Valenz der Verben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138728