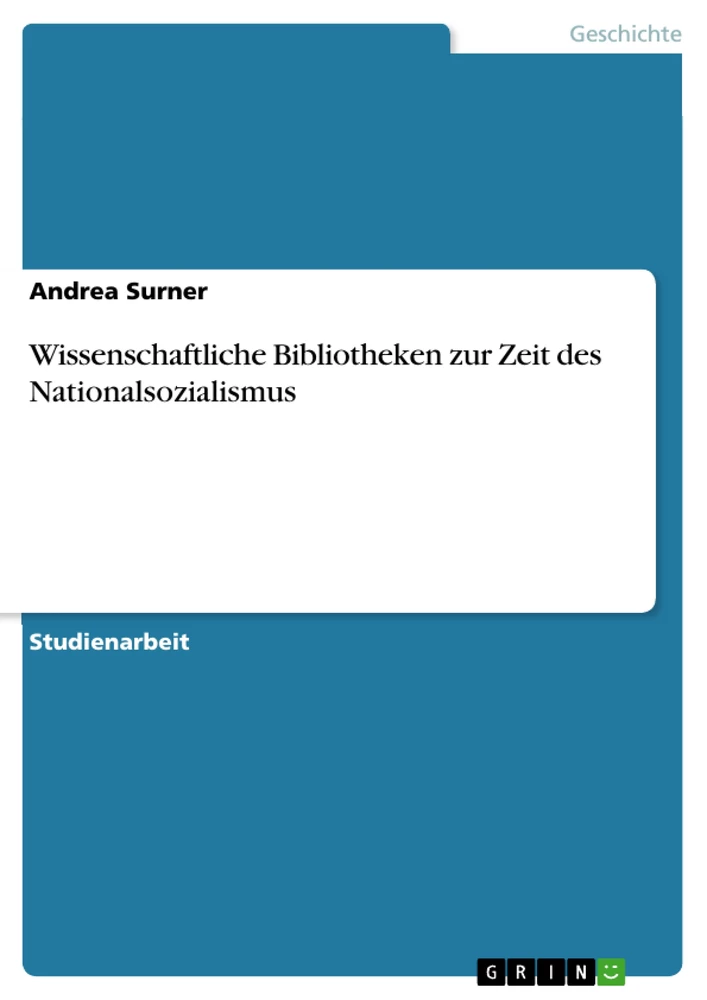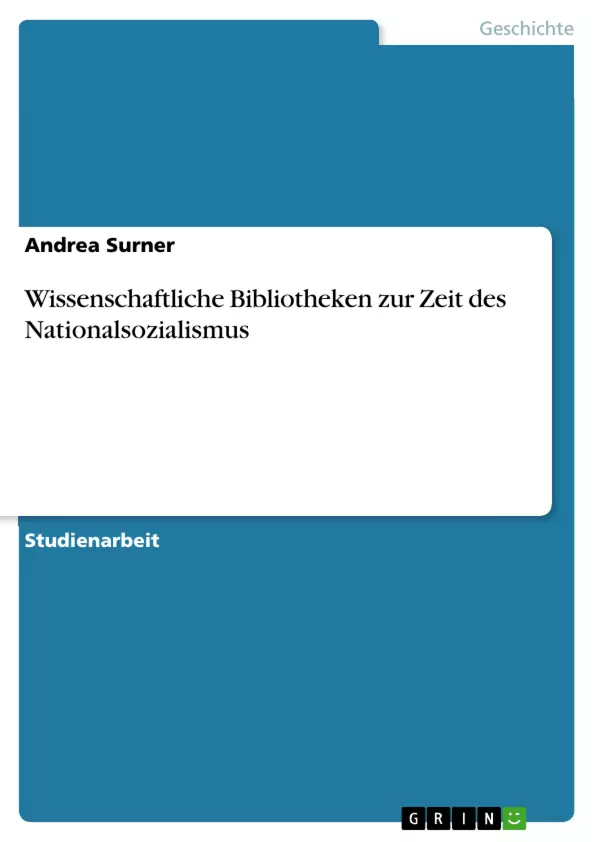In dieser Arbeit soll ein Eindruck davon vermittelt werden, wie „Menschen mit Menschen“ in der Zeit des Nationalsozialismus in bestimmten Kreisen umgingen. Dabei wird hauptsächlich die Personalpolitik an den wissenschaftlichen Bibliotheken betrachtet, anschließend soll in einem Exkurs exemplarisch der Umgang mit Benutzern der Bibliotheken dargestellt werden. Wie wurden einzelne Personen behandelt? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Warum wurden sie ergriffen – aus politischer Gehorsamkeit oder aus Eigennutz? Im Zentrum können hier natürlich nur individuelle Lebensläufe stehen, die keine Verallgemeinerung der Bibliothekspolitik darstellen sollen.
Inhaltsverzeichnis
1. Quellenlage und Forschungsstand
2. Wissenschaftliche Bibliotheken während des Nationalsozialismus – Personalpolitik
2.1 Politische Veränderungen innerhalb Wissenschaftlicher Bibliotheken
2.1.1 Gesetzesgrundlagen und Veränderungen auf Staatsebene
2.1.2 Der „neue“ Bibliothekar
2.2 Der Umgang mit missliebigen Bibliotheksdirektoren
2.2.1 UB Berlin – Rudolf Hoecker
2.2.2 BSB München – Georg Reismüller
2.2.3 UB München – Walter Plöbst
2.3 Der Umgang mit „nichtarischen“ Mitarbeitern der Bibliotheken
2.3.1 UB Berlin – Heinrich Loewe
2.3.2 UB Freiburg – das „Einzelschicksal“ Max Pfannenstiel
3. Universitätsbibliotheken während des Nationalsozialismus – Benutzungspolitik
3.1 Vorgehensweise der UB Heidelberg
3.2 Vorgehensweise der UB Freiburg
4. Fazit
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1 Benutzte Quellen
5.2 Benutzte Literatur
5.3 Benutzte Internetadressen
1. Quellenlage und Forschungsstand
Was die Quellensituation der wissenschaftlichen Bibliotheken zur Zeit des Nationalsozialismus betrifft, so sind die zugänglichen Quellen „[b]edingt durch die verwaltungsmäßige Zuständigkeit unterschiedlicher Behörden auf Reichs-, Landes- und Lokalebene […] sehr weit verstreut.“[1] Hinzu kommt, dass ein Großteil der Bibliotheken und auch das 1934 gegründete Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung aufgrund zahlreicher Bombenangriffe in den 40er Jahren teilweise zerstört wurden – dementsprechend wurden die Archive mit zahlreichen Personalakten oder auch dem dokumentierten Schriftverkehr vernichtet.
Die Forschung bezüglich dieses Themas setzte erst in den letzten 20 Jahren intensiv ein. Im Zuge der 5. Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheksgeschichte im Jahr 1988 entstand ein wertvolles Werk,[2] herausgegeben von Peter Vodosek und Manfred Komorowski, das neben dem Volksbüchereiwesen auch Aufschluss über die wissenschaftlichen Bibliotheken in dieser Zeit gibt. Eine weitere bedeutsame Arbeit erschien 1989 von Hans-Gerd Happel[3]. Hier wurde erstmals der Versuch unternommen, auf einer breiten Quellenbasis in einer Monographie mehrere wissenschaftliche Bibliotheken miteinander zu vergleichen. Weiterhin werden die führenden Bibliothekare der nationalsozialistischen Ära vorgestellt und Verhaltensweisen dargelegt, die an den einzelnen Bibliotheken an den Tag traten. Auch zu den einzelnen Bibliotheken lassen sich von Ingo Toussaint[4] oder Sören Flachowsky[5] Untersuchungen bezüglich dieser Zeit finden. Eine Analyse des Forschungsstandes liefert Christine Koch[6]. Insgesamt, so Komorowski, kann man resümieren, „dass sich die Forschungssituation doch nicht ganz so düster präsentiert, aber nach den viel versprechenden Wolfenbütteler Ansätzen besser sein könnte.“[7]
In dieser Arbeit soll nun ein Eindruck davon vermittelt werden, wie „Menschen mit Menschen“ in dieser Zeit umgingen. Dabei wird hauptsächlich die Personalpolitik an den wissenschaftlichen Bibliotheken betrachtet, anschließend soll in einem Exkurs exemplarisch der Umgang mit Benutzern der Bibliotheken dargestellt werden. Wie wurden einzelne Personen behandelt? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Warum wurden sie ergriffen – aus politischer Gehorsamkeit oder aus Eigennutz? Im Zentrum können hier natürlich nur individuelle Lebensläufe stehen, die keine Verallgemeinerung der Bibliothekspolitik darstellen sollen.
2. Wissenschaftliche Bibliotheken während des Nationalsozialismus – Personalpolitik
Um die Personalpolitik an wissenschaftlichen Bibliotheken untersuchen zu können – das sei an dieser Stelle noch einmal betont – , muss man sich vor Augen halten, dass man dabei immer nur Einzelpersonen und Einzelschicksale betrachten kann, die keine universelle Gültigkeit für das gesamte wissenschaftliche Bibliothekswesen während des Nationalsozialismus besitzen. Dieser eher „personenorientierte“ Ansatz bietet aber dennoch die Möglichkeit, gewisse Kontinuitäten festzustellen, die sich aus der Betrachtung mehrerer Bibliotheken ergeben. Andererseits findet man oft starke Gegensätze und muss versuchen, eine Erklärung für diese zu finden.
Besonders wichtige Fragestellungen, die schon Toussaint hervorhob, sind dabei „Gab es aktive Nationalsozialisten im Kollegium? Unter welchen Gesichtspunkten werden Neueinstellungen vorgenommen? Gab es „nichtarische“ Kollegen?“[8] Hierbei ist es besonders wichtig, sich darüber klar zu werden, inwiefern die Bibliotheken „Orte des zurückgezogenen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens [waren] oder ob die allgemeine Gleichschaltung und die NS-Ideologie auch in ihren Räumen Einzug hielten.“[9] Nachdem vorgestellt wird, welche Mittel auf staatlicher Ebene ergriffen wurden, um die nationalsozialistische Politik durchzusetzen, soll anhand einiger Beispiele dargestellt werden, wie diese Mittel in der Praxis umgesetzt wurden, das heißt, wie die Personalpolitik in den jeweiligen wissenschaftlichen Bibliotheken aussah. Dabei wird zuerst auf die Handhabung bei der Besetzung von Direktorenstellen eingegangen, anschließend soll der Umgang mit „nichtarischen“ Bibliothekaren und Mitarbeitern erläutert werden.
2.1 Politische Veränderungen innerhalb wissenschaftlicher Bibliotheken
„Das Personal war zwar keinem besonderen politischen und weltanschaulichen Druck ausgesetzt, weil es nicht allzu auffällig opponierte und nur passiven Widerstand leistete, aber für seine langsame Umerziehung war dadurch Sorge getragen, dass der neu in den Staatsdienst eintretende höhere und gehobene Dienst fast ausschließlich Mitglied einer Parteiorganisation sein musste, um überhaupt angestellt werden zu können.“[10]
Dieses Urteil, das Buzás über die Universitätsbibliothek München fällt, trifft wohl für die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken zu. Wichtig ist hierbei vor allem die Stellung des Bibliothekars als Leiter der Universitätsbibliotheken. Wenn dieser mit der neuen Regierung konform ging, so nahm man an, so würden auch seine Mitarbeiter gemäß dem „Führerprinzip“ Gefolgschaft leisten. Durch welche Gesetze man versuchte, nur noch politisch „annehmbare“ Beamte zu formen und welche Funktionen der „neue“ nationalsozialistische Bibliothekar innehaben sollte, wird nun kurz vorgestellt.
2.1.1 Gesetzesgrundlagen und Veränderungen auf Staatsebene
Mit der Machtübernahme am 30. Januar 1933 machte sich die neue nationalsozialistische Regierung sofort daran, ihr Programm auf allen Ebenen durchzusetzen. Durch den Erlass des „Gesetzes zur Wiederherstellstellung des Berufbeamtentums“ (BBG) sollten vor allem „nichtarische“ Staatsdiener und „Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten“[11] entlassen werden. Die Ministerien forderten hiernach die Leiter der Universitäten auf, ihre Mitarbeiter, einen Fragebogen ausfüllen zu lassen, in welchem diese Inhalte geklärt werden sollten. Mit diesem Gesetz wurden „bereits fast 60 Prozent aller ermittelten jüdischen Bibliothekare mit einem Berufsverbot belegt und verloren ihre Stelle.“[12] Durch die so genannte „Frontkämpferklausel“ jedoch, die besagt, das „Beamte, die bereits seit dem 1. August 1914 Beamte gewesen sind oder die im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich“[13] gekämpft hatten, konnten sich noch einige wenige „Nichtarier“ in den Bibliotheken halten.
Durch die Gründung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (REM) am 1. Mai 1934 wurde die Kulturhoheit der Länder an das Reich überträgen.[14] Damit wurde auch das wissenschaftliche Bibliothekswesen zentral geleitet. Innerhalb des REM war Rudolf Kummer von der Bayerischen Staatsbibliothek der Referent für das wissenschaftliche Bibliothekswesen und mit dem Amt eines Ministerialrats versehen. „Kummers ständige Präsenz in diesem Gremium sorgte dafür, dass neben den rein fachlichen auch die ideologischen Aspekte gebührend Berücksichtigung fanden. Die Mehrheit der Mitglieder gehörte im Übrigen der NSDAP an.“[15] Kummer war Nationalsozialist erster Stunde[16], bereits am 1. Mai 1922 trat er erstmals in die NSDAP ein, war Teilnehmer beim Marsch auf die Feldherrenhalle in München und daher Träger des Blutordens. Nach der Wiedergründung der NSDAP trat er am 1. November 1931 erneut bei. Es wurde also binnen eines Jahres der nationalsozialistischen Regierung stark daran gearbeitet, auch das wissenschaftliche Bibliothekswesen und dessen Leitung hauptsächlich durch Parteimitglieder und Regierungstreue zu besetzen. Am 7. Dezember 1936 gründete man den Reichsbeirat für Bibliotheksangelegenheiten, dessen Vorsitz Hugo Andreas Krüß[17], Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek, übernahm. Innerhalb des wissenschaftlichen Bibliothekswesens hatten Kummer und Krüß die höchsten Positionen inne.
Doch auch die Gesetzgebung schritt voran: Durch das „Reichsbürgergesetz“ (RBG) vom 15. September 1935 wurde die Reichsangehörigkeit neu geregelt, „Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.“[18] Dadurch waren nun die Beamten, die als „Volljuden“ bezeichnet wurden, gezwungen, bis zum 31. Dezember 1935 in den Ruhestand zu treten, denn „ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden.“[19] Im RBG fiel nun auch die „Frontkämpferklausel“ weg, was bedeutete, dass nun auch dieser Teil der „nichtarischen“ Bibliothekare entlassen werden musste. Ein weiterer, letzter Schritt war schließlich das „Deutsche Beamtengesetz“ (DBG) vom 26. Januar 1937, wodurch nun auch „jüdisch versippte“ Beamte, das heißt Beamte, deren Ehepartner „nicht deutschen oder artverwandten Blutes“[20] waren, aus dem Staatsdienst entlassen werden mussten. Der antisemitischen Regierung war es wichtig, keinen jüdischen oder auch jüdisch versippten Mitarbeiter im Staatsdienst zu haben, die Regelung des RBG wurde nämlich nicht nur auf Beamte, sondern auch auf nicht beamtete Mitarbeiter angewandt.
Im August 1938 wurde schließlich auch das Ausbildungs- und Prüfungswesen reichsweit geändert. „Dies bedeutete, dass sich nun auch der bibliothekarische Nachwuchs der politischen Indoktrination nicht entziehen konnte und die Auswahl der Bewerber nach nationalsozialistischen Kriterien erfolgte.“[21]
2.1.2 Der „neue“ Bibliothekar
Seit 1900 waren die wissenschaftlichen Bibliothekare und Bibliotheksmitarbeiter in dem Verein Deutscher Bibliothekare (VDB)[22] organisiert, als zentrales Organ dieses Vereins gilt das „Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken“. Mit der Machtergreifung änderte sich auch für den Verein, damals hatte er 621 Mitglieder, einiges: Er „musste sich bald den neuen politischen Gegebenheiten anpassen und im Rahmen der Gleichschaltung sechs Parteimitglieder in den elfköpfigen Vorstand berufen.“[23] Besonders hervorzuheben ist hier die Rede Joachim Kirchners,[24] damals Bibliothekar in Frankfurt, der auf dem Bibliothekartag 1933 in Darmstadt eine Rede über die Zukunft des Bibliothekars hielt. Er
„forderte er die Bibliothekare auf, zu kulturpolitischen Aktivisten der Hitler-Bewegung zu werden, billigte Bücherverbrennungen ausdrücklich, lobte das Aufräumen der politischen Polizei unter der so genannten Asphaltliteratur, wetterte gegen die liberalistisch-internationalistische Gesinnung vieler Wissenschaftler, gegen verpönte Wissenschaftsdisziplinen wie Soziologie und Psychoanalyse und empfahl die Erneuerung des deutschen wissenschaftlichen Schrifttums im Sinne der NS-Bewegung. Folglich waren jüdische und bolschewistische Schriften völlig auszumerzen.“[25]
Dies sollte also die Zukunft des nationalsozialistischen Bibliothekars sein. Es erscheint eindeutig, dass es hierbei nicht mehr um die Wissenschaft an sich ging, bestimmte Wissenschaften wurden sogar belächelt, sondern um ein kontrolliertes NS-Schrifttum, das andere Schriften an Wert übertraf. Unnütze Literatur war zu vernichten – dies geschah schließlich später auch durch zahlreiche Bücherverbrennungen.
Weiterhin wurde auch hier – wie in allen Bereichen der nationalsozialistischen Politik – eine Zentralisierung angestrebt: Dazu „war im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederverstammlung am 19. Oktober 1935 die Neugestaltung der Vereinssatzung nach dem ‚Führerprinzip’ beschlossen und der VDB entsprechend ideologisch ausgerichtet worden.“[26] Den Vorsitz des Vereins hatte bis 1937 Georg Leyh[27] inne, abgelöst wurde er dann von Gustav Abb, einem überzeugten Nationalsozialisten. Abb leitete seit 1934 die Universitätsbibliothek Berlin kommissarisch und wurde 1935 deren Direktor.[28] Als Parteimitglied stand er für eine nationalsozialistische Bibliothekspolitik, um seine Einstellung zum Ausdruck zu bringen, soll dieses kurze Zitat genügen: „Der Nationalsozialismus befreite dieses fruchtbare Feld für immer von Unkraut und Giftpflanzen […].“[29]
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste sich auch der VDB im Mai 1945 auflösen, wurde jedoch am 28. April 1948 neu gegründet. – „Dies geschah ohne größere Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und mit dem Anspruch der Interessenvertretung für das gesamte wissenschaftliche Bibliothekswesen.“[30]
Auch dies soll hier nicht unerwähnt bleiben: Neben dem VDB, der von den Nationalsozialisten infiltriert und übernommen wurde, gab es auch Versuche, neue Vereine zu gründen, wie zum Beispiel von Friedrich Smend in Erlangen die „Nationalsozialistische Vereinigung Deutscher Bibliothekare“.[31] In dem Gründungsaufruf vom 6. Mai 1933 heißt es, ihre Ziele wären, „in treuer Gefolgschaft Adolf Hitlers die Bibliotheken und ihre Arbeit in die große nationalsozialistische Kampffront einzureihen und auf dem ihnen eigentümlichen Arbeitsgebiet der Verwirklichung der Ziele der nationalsozialistischen Erhebung mit allen Kräften zu dienen.“[32] Allerdings gelang es diesem Verein nicht – auch in Anbetracht der Konkurrenz mit einem Traditionsverein – auf Dauer Fuß zu fassen.
2.2 Der Umgang mit missliebigen Bibliotheksdirektoren
Anders als heutige Regierungen wurde also in der Zeit des Nationalsozialismus versucht, die Geschehnisse an den wissenschaftlichen Bibliotheken gezielt zu beeinflussen und wichtige Stellen mit politisch konformen Personen zu besetzen. „Die Bedeutung des Bibliothekars als Vermittler des Wissens, aber eventuell auch der politischen Propaganda hatte der Nationalsozialismus frühzeitig erkannt.“[33] Bei einer Beurteilung der Beamten muss man allerdings vorsichtig sein: Eine Mitgliedschaft in der NSDAP bedeutete nicht immer eine Übereinstimmung mit deren Ideologie, andererseits konnte auch ein Bibliothekar, der kein Parteimitglied war, nach antisemitischen oder rassischen Vorurteilen handeln. Oder – um seine Stellung zu wahren – blieb auch die Möglichkeit, sich einfach ruhig zu verhalten. Ein gutes Beispiel hierfür liefert der Direktor der Universitätsbibliothek Jena, Theodor Lockemann, der sich im Dienst weigerte, den Hitler-Gruß zu erweisen[34]:
„Er wurde nicht Mitglied der NSDAP, sondern gehörte dem Kreis bürgerlicher, zum Teil konservativer Hitler-Gegner um Ricarda Huch an. Trotz seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Führerprinzip, dessen Ideologie und Politik, konnte er nicht verhindern, dass sich die Bibliothek von Jahr zu Jahr mehr zu einem Instrument der braunen Machthaber entwickelte.“[35]
So wurden am 27. August 1934 „mittags um 12 Uhr im Senatssaal der Universität […] folgende Herren auf den Führer und Reichskanzler vereidigt: Der Direktor Professor Lockemann“ und weitere sieben Mitarbeiter der UB Jena.[36] Es fügte sich also auch ein „Hitler-Gegner“ den neuen Gegebenheiten und schwor einen Eid auf den neuen Reichskanzler.
Anders als bei Lockemann in der UB Jena, der von seinen Mitarbeitern nicht bezüglich seiner politischen Vergangenheit angezeigt wurde und der sich in der nationalsozialistischen Zeit dementsprechend ruhig und zurückhaltend der Bibliotheksarbeit widmen konnte, verhielt es sich in den Universitätsbibliotheken Berlin und München, auch in der Bayerischen Staatsbibliothek in München, deren Personalpolitik bezüglich der Direktorenstellen nun vorgestellt werden sollen. Es ist anzumerken, dass
„[v]on den insgesamt 34 Bibliotheksdirektoren, die zwischen 1933 und 1945 ihr Amt an den 23 deutschen Universitätsbibliotheken ausübten, 12 Bibliotheksdirektoren Parteigenossen [waren]. […] Bei der Besetzungspolitik ist auffallend, dass bei Neubesetzungen meist ein Nationalsozialist bevorzugt wurde.“[37]
Wie dies von Statten ging, soll nun anhand der Ereignisse um Rudolf Hoecker an der UB Berlin – hier eine Zurückstufung vom Amt des Direktors –, um Georg Reismüller an der BSB München – da eine Verhaftung des Direktors – und um Walter Plöbst an der UB München – dort erst gar keine Beförderung zum Direktor – dargestellt werden.
2.2.1 UB Berlin – Rudolf Hoecker
Wie bereits erwähnt wurde, sollten nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (BBG) politisch missliebe Personen aus ihren Ämtern entfernt werden. „Das markanteste Beispiel war wohl Rudolf Hoecker, der wegen seiner sozialdemokratischen Gesinnung seines Amtes als Direktor der Berliner Universitätsbibliothek enthoben und zum Bibliotheksrat zurückgestuft wurde.“[38] Hoecker war seit 1. April 1930 an der Universitätsbibliothek Berlin tätig und wurde am 22. April zum Bibliotheksdirektor ernannt. In seinem Kollegium genoss er hohes Ansehen, doch „[t]rotz seiner Reputation blieb Hoecker den nationalsozialistischen Machthabern suspekt.“[39] Dies lag daran, dass Hoecker von 1929 bis 1932 Mitglied der SPD gewesen war, was der neuen Regierung ein Dorn im Auge zu sein schien – schließlich sollten die Beamtenstellen nunmehr nur mit politisch unbedenklichen, also nationalsozialistisch eingestellten Staatsdienern besetzt werden. Wie alle anderen Beamten an den Universitäten, so musste auch Hoecker nach dem BBG einen Fragebogen zu seiner Person ausfüllen, in dem er angab, „[p]olitisch habe ich mich weder durch Tat, Wort noch Schrift betätigt. Der nationalen Bewegung bin ich nie hindernd in den Weg getreten.“[40] Da er seine politische Untätigkeit in diesem Fragebogen mehrfach betont, kann man erkennen, dass er bereits 1933 wegen seiner politischen Vergangenheit um das Amt des Direktors der UB Berlin bangen musste.
Diese Angst war auch nicht unbegründet: Der Verwaltungsdirektor der Friedrich-Wilhelms-Universität, Karl Büchsel, forderte am 9. August 1933 den Bibliotheksrat und Obmann der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft der Beamten und Angestellten (NSBA), Werner Rust, auf, eine Beurteilung über Hoecker zu schreiben. Diese erhielt er am 11. August 1933 von Rust. Hierin gab dieser an: „Ich selbst hebe hervor, dass auch schon vor dem 30. Januar 1933, zu mir, der ich niemals meine politische Gesinnung und Zugehörigkeit zur NSDAP verschwiegen habe, Herr Hoecker kein angreifendes oder verletzendes Wort gesprochen […] hat.“[41] Weiterhin bescheinigt Rust Hoecker, dass dieser alle Verordnungen des nationalsozialistischen Regimes in der UB Berlin umgesetzt habe und auch, dass Hoecker „durch den Nationalsozialismus seine eigenen politischen und sozialen Ideen ausgeführt sieht.“[42] Durch diese Beurteilung Rusts konnte Hoecker aufgrund des BBG nicht entlassen werden, denn dadurch, dass Rust sogar angab, Hoecker wäre dem Nationalsozialismus freundlich gesinnt, konnte er auch nach §4 dieses Gesetzes „Gewähr dafür bieten, dass [er] jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat“ eintrat.[43] Doch obwohl Hoecker durch das NSDAP-Mitglied Rust, der ja wie erwähnt gleichzeitig auch Obmann des NSBA war und dessen Meinung dadurch den Nationalsozialisten von hohem Stellenwert hätte sein müssen, eine positive Beurteilung bekam, hatte sich der Fall damit nicht erledigt. Vorantreibende Kraft war hier erneut der Verwaltungsdirektor der Berliner Universität, Karl Büchsel, dem zwar eine offizielle Mitgliedschaft der NSDAP nicht nachzuweisen war, der aber wohl ein Befürworter der neuen Regierung war. Dieser fügte dem Beurteilungsschreiben über Hoecker an das Ministerium hinzu, dass er sich nicht vorstellen könne, dass Hoecker „sein Institut so zu leiten vermag, wie es ein anderer, der innerlich ungebrochen zu der nationalen Erhebung steht, tun würde.“[44]
[...]
[1] S. Happel, Hans-Gerd: Die Quellensituation für die Universitätsbibliotheken. In: Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter (Hrsg.): Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989, S. 303.
[2] Vgl. Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter: Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989.
[3] Happel, Hans-Gerd: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen im Nationalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung der Universitätsbibliotheken. München u.a., 1989.
[4] Toussaint, Ingo: Die Universitätsbibliothek Freiburg im Dritten Reich. Freiburg, 1982. Weiterhin Toussaint, Ingo (Hrsg.): Die Universitätsbibliotheken Heidelberg, Jena und Köln unter dem Nationalsozialismus. München u.a., 1989.
[5] Flachowsky, Sören: Die Bibliothek der Berliner Universität während der Zeit des Nationalsozialismus. Berlin, 2000.
[6] Koch, Christine: Das Bibliothekswesen im Nationalsozialismus. Eine Forschungsstandanalyse. Marburg, 2003.
[7] Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter: Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989. In: Kuttner, Sven / Reifenberg Bernd: Das bibliothekarische Gedächtnis. Aspekte der Erinnerungskultur an braune Zeiten im deutschen Bibliothekswesen. Marburg 2004, S. 62.
[8] S. Toussaint, Ingo: Wissenschaftliche Bibliotheken im Dritten Reich – methodische Probleme ihrer Erforschung. In: Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter (Hrsg.): Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989, S. 299.
[9] S. Kondziella, Verena / Nadler, Markus: Die Universitätsbibliothek München in der Zeit des Nationalsozialismus. Aspekte der Personalpolitik. In: Kraus, Elisabeth (Hrsg.): Die Universität München im Dritten Reich. Aufsätze. Teil I, München 2006, S. 433.
[10] S. Buzàs, Ladislaus: Geschichte der Universitätsbibliothek München. Wiesbaden, 1972, S. 178f.
[11] S. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (BBG), Erste Durchführungsverordnung (DVO) vom 11. April 1933; RGBl. I, S. 195, §4. Dieses Gesetz galt ab der Dritten DVO vom 6. Mai 1933 auch für „Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen“ und für die „nicht beamteten außerordentlichen Professoren und Privatdozenten an wissenschaftlichen Hochschulen.“, vgl. RGBl, I, S. 245.
[12] S. Müller-Jerina, Alwin: Jüdische Bibliothekare in Deutschland 1933 bis 1945. Ein Projektbericht. In: Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter (Hrsg.): Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989, S. 552.
[13] S. Erste DVO vom 11. April 1933; RGBl. I, S. 195, §3, Abs. 2.
[14] Vgl. hierzu Komorowski, Bibliotheken, S. 4ff.
[15] S. ebd. S. 5.
[16] Vgl. hierzu Happel, Bibliothekswesen, S. 45-47.
[17] Krüß war erst seit 1. April 1940 Parteimitglied und weit mehr als Kummer an den Bibliotheken und der Wissenschaft als solche interessiert. Er pflegte weit reichende internationale Beziehungen, welche er sogar dazu nutzte, einem jüdischen Kollegen, Edgar Breitenbach, eine Stelle in den USA zu vermitteln. Vgl. hierzu ebd., S. 56-60.
[18] S. Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935; RGBl. I, S. 1146, §2, Abs. 1.
[19] S. Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935; RGBl. I, S. 1333, §4, Abs. 1.
[20] S. Deutsches Beamtengesetz vom 26. Januar 1937; RGbl. I, S. 39, §59, Abs. 1.
[21] S. Koch, Bibliothekswesen, S. 73.
[22] Vgl. hierzu ebd., S. 87-89.
[23] S. Komorowski, Bibliotheken, S. 3.
[24] Kirchner war überzeugter Nationalsozialist und trat bei der Rede im Braunhemd auf. Später bewarb er sich um die Direktorenstelle der Universitätsbibliothek München. Vgl. hierzu auch Kapitel 2.3.3.
[25] S. Komorowski, Bibliotheken, S. 3.
[26] S. Koch, Bibliothekswesen, S. 88.
[27] Georg Leyh war von 1921 bis 1947 Leiter der Universitätsbibliothek Tübingen und „gehörte zu denjenigen Bibliothekaren, die dem Nationalsozialismus völlig fern standen.“ S. Happel, Bibliothekswesen, S. 60 und vgl. die Ausführungen zu Leyh ebd., S. 60ff.
[28] Auf welchem Wege dies geschah, vgl. Kapitel 2.2.1. Zu Abb vgl. Happel, Bibliothekswesen, S. 50f.
[29] Abb in einem Artikel füür das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Abb an Börsenverein vom 23. April 1938, NiedersLB, VDB Archiv, Korrespondenz 1938/1. Zitiert nach Happel, Bibliothekswesen, S. 51.
[30] S. Homepage des VDB, Link „Geschichte“, http://www.vdb-online.org/verein/geschichte.php.
[31] Vgl. hierzu Happel, Hans-Gerd: Die Quellensituation für die Universitätsbibliotheken. In: Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter (Hrsg.): Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989, S. 308.
[32] Gründungsaufruf der „Nationalsozialistischen Vereinigung Deutscher Bibliothekare“ vom 6. Mai 1933. Universitätsbibliothek Erlangen: XXUV / 4 / 1. Abbildung des Gründungsaufrufs in Happel, Quellensituation, S. 319.
[33] S. Komorowski, Bibliotheken, S. 18.
[34] Vgl. Happel, Bibliothekswesen, S. 37.
[35] S. Bohmüller, Lothar: Die Universitätsbibliothek Jena in den Jahren von 1933 bis 1945. In: Komorowski, Manfred / Vodosek, Peter (Hrsg.): Bibliotheken während des Nationalsozialismus. Teil I. Wiesbaden, 1989, S. 360.
[36] Aus dem Tagebuch der UB Jena. Zitiert aus Bohmüller, Lothar / Marwinski, Konrad: Die Universitätsbibliothek Jena von 1933 bis 1945. In: Toussaint, Ingo: Die Universitätsbibliotheken Heidelberg, Jena und Köln unter dem Nationalsozialismus. München u.a., 1989, S. 137. Die Textedition des Tagebuchs der UB Jena s. S. 119-258.
[37] S. Happel, Bibliothekswesen, S. 28f.
[38] S. Komorowski, Bibliotheken, S. 9. Vgl. hierzu auch das Kapitel 4.1 „Entlassung und Versetzung – Die Folgen der nationalsozialistischen Personalpolitik an der Universitätsbibliothek Berlin“ in Flachowsky, Bibliothek, S. 33-65.
[39] Ebd., S. 36.
[40] Personalakte Hoecker; AHU, UK, H 357, Bl. 12. Zitiert nach ebd., S. 37.
[41] Personalakte Hoecker; AHU, UK, H 357, Bl. 26. Zitiert nach ebd., S. 38.
[42] Personalakte Hoecker; AHU, UK, H 357, Bl. 26. Zitiert nach ebd., S. 39.
[43] S. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (BBG), Erste Durchführungsverordnung (DVO) vom 11. April 1933; RGBl. I, S. 195, §4. Vgl. hierzu Kapitel 2.1.1.
[44] Personalakte Hoecker; AHU, UK, H 357, Bl. 27f. Zitiert nach Flachowsky, Bibliothek, S. 40.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich die Personalpolitik in Bibliotheken im Nationalsozialismus?
Durch Gesetze wie das 'Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums' wurden 'nichtarische' und politisch missliebige Mitarbeiter entlassen und durch parteikonforme Personen ersetzt.
Was war das Reichsbürgergesetz von 1935 für Bibliothekare?
Es zwang jüdische Beamte, die zuvor durch die Frontkämpferklausel geschützt waren, bis Ende 1935 in den Ruhestand zu treten, da sie keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden durften.
Welche Rolle spielten Rudolf Kummer und Hugo Andreas Krüß?
Kummer und Krüß besetzten die höchsten Positionen im wissenschaftlichen Bibliothekswesen unter dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (REM).
Wie war die Quellensituation für die Forschung zu diesem Thema?
Die Quellen sind weit verstreut und viele Archive wurden durch Bombenangriffe im Krieg zerstört, was die Forschung erschwert.
Gab es Widerstand innerhalb der Bibliotheken?
Oft leistete das Personal nur passiven Widerstand, während die Leitung meist nach dem 'Führerprinzip' gleichgeschaltet wurde.
- Citar trabajo
- Andrea Surner (Autor), 2008, Wissenschaftliche Bibliotheken zur Zeit des Nationalsozialismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138735