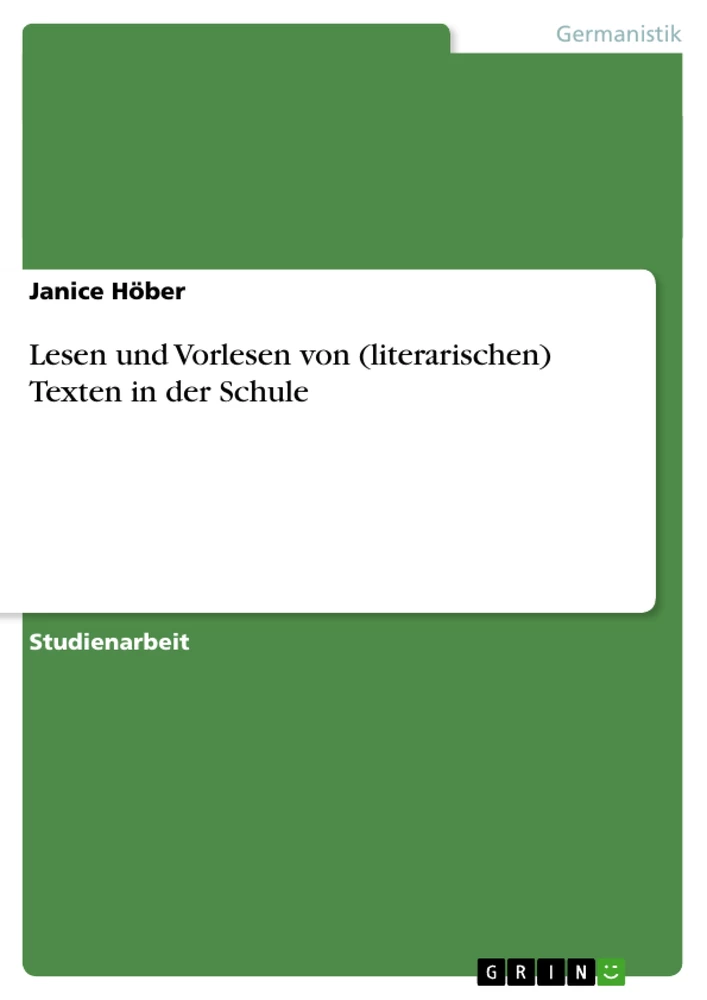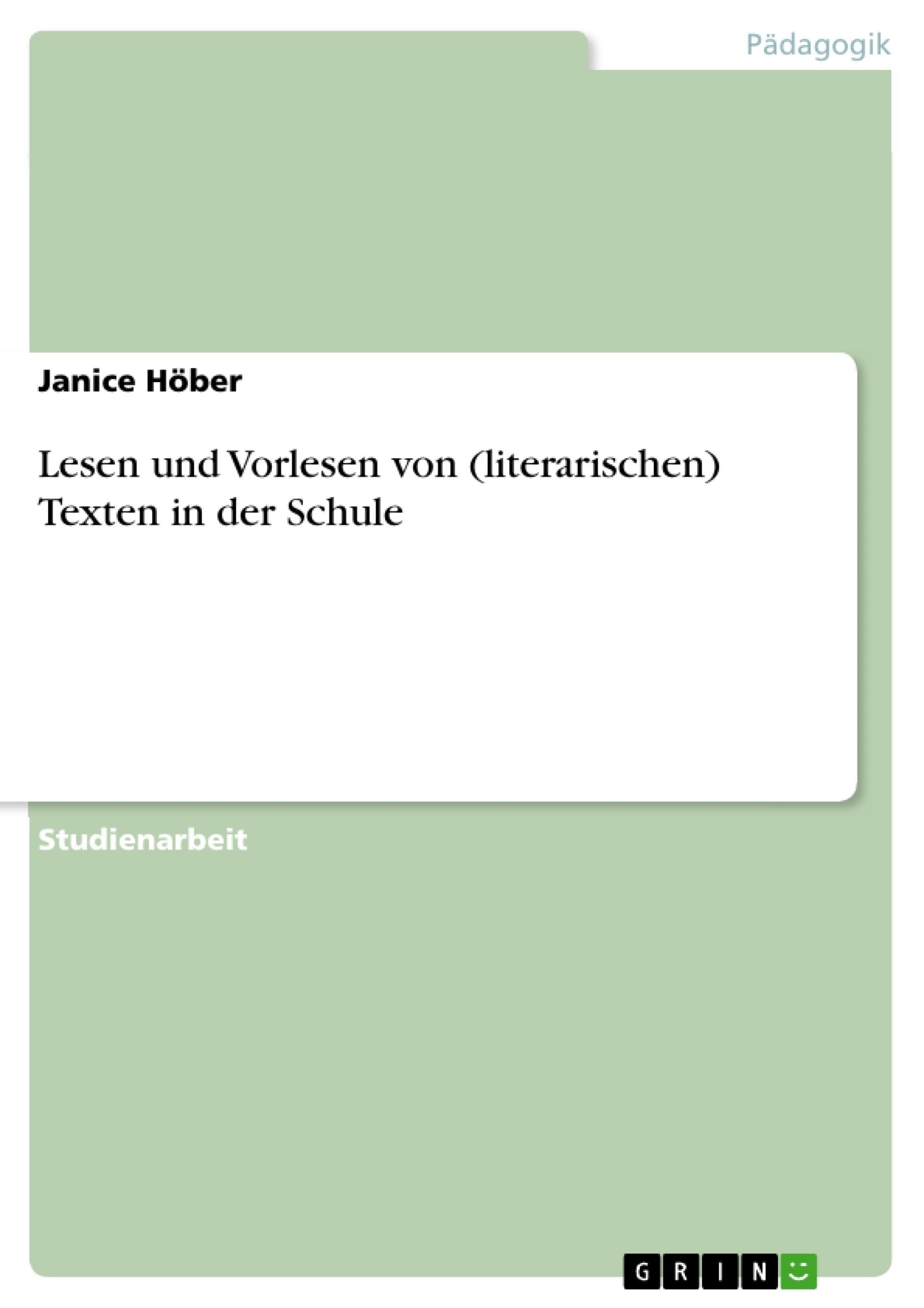Lesen wurde jahrhundertelang durchweg als Vorlesen praktiziert. Sowohl in der Antike als auch im Mittelalter war es selbstverständlich, dass, wenn öffentlich oder individuell gelesen wurde, dies grundsätzlich laut geschah.
Seit der frühen Neuzeit bildeten sich neue Formen des lauten Vorlesens heraus. Gemeint ist damit jenes Vorlesen, „das sich komplementär zum stillen Lesen in privatem Rahmen entwickelte und Formen einer intimen Geselligkeit und informellen Öffentlichkeit ausbildete.“
Im Barock entstanden so genannte literarische Zirkel, in denen sich die dort verkehrenden Autoren ihre Dichtungen gegenseitig laut darboten. Auf dieser Basis entwickelte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine eigenständige ästhetische Vortragskunst, die dazu diente, die Qualität der vorgetragenen Texte zu testen.
Beim Theater diente die Vorleseprobe den Schauspielern oder dem Regisseur in erster Linie als Auseinandersetzung mit dem Stück. All das geschah letztendlich vor dem Hintergrund, die deutsche Sprache zu pflegen, zu vereinheitlichen und hoffähig zu machen.
Eine selbstständige Vorlesekunst lässt sich erst um 1750 nachweisen.
Heute sind es vor allem die Schauspieler, die die Rolle des Vorlesers übernehmen und einem sich dafür begeisternden Publikum Texte meist schon verstorbener Autoren vortragen. Jedoch verhindern die seit den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommenen Medien, wie Rundfunk, Fernsehen, Schallplatte, Tonband oder CD, die völlige Wiederbelebung der alten Tradition. Statt der öffentlichen Lesung gewinnen medienvermittelte Vorlesungen, wie zum Beispiel in Form des Hörbuchs, zunehmend die Oberhand.
Wie wichtig das Lesen und Vorlesen von und aus Büchern vor allem im Kindesalter ist, wird von verschiedenen Seiten immer wieder bestätigt, denn es regt nicht nur die Fantasie an, sondern fördert auch die individuelle sprachliche Entwicklung. Darüber hinaus wird Lesen als Basiskompetenz für lebenslanges Lernen angesehen. Um so alarmierender wirken die PISA-Ergebnisse, aus denen hervorgeht, dass die deutschen Mädchen und Jungen erhebliche Defizite im Bereich der Lesekompetenz aufweisen und zu 42 Prozent sehr ungern lesen. Da Kinder nicht als Leseratten geboren werden, ist es die Aufgabe der Familie und der Schule, und hier vor allem des Deutschunterrichts, sie zum Lesen zu motivieren und in ihnen die Freude am Lesen zu wecken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Abgrenzung des Themas
- 2. Schulische Förderung des Vorlesens
- 2.1 Das 17. Jahrhundert
- 2.2 Das 18. Jahrhundert
- 2.3 Vom Ende der Klassik bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
- 2.3.1 Die Theorie
- 2.3.2 Die Praxis
- 3. Der Deutschunterricht im 20. Jahrhundert
- 3.1 Der Literaturunterricht während der NS-Zeit
- 3.2 Die Entwicklung des Literaturunterrichts nach der NS-Zeit bis 1968
- 3.2.1 Das Lesebuch zwischen 1965 und 1970
- 3.2.2 Das Lesebuch in der DDR
- 3.2.3 Die Entwicklung des Lesebuches seit 1970
- 4. Die Bedeutung des Deutschunterrichts heute
- 4.1 Die Leseleistungen 15-jähriger deutscher Schüler nach PISA
- 4.1.1 Lesekrisen und Leseunlust als Erklärungsansatz
- 4.2 Die gegenwärtige Stellung des (Vor-)Lesens im Deutschunterricht
- 4.3 (Vor-)Lesen als Aufgabe des Deutschunterrichts
- 4.3.1 Die Verankerung des (Vor-)Lesens im Rahmenlehrplan für die Grundschule
- 4.3.2 Die Verankerung des (Vor-)Lesens im Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I
- 4.3.3 Die Verankerung des (Vor-)Lesens im Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Vorlesens im Deutschunterricht und seine Bedeutung von der Antike bis zur Gegenwart. Sie beleuchtet die Veränderungen der Praxis und der didaktischen Konzepte des Vorlesens im Wandel der Zeit und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. Die Arbeit betrachtet die Rolle des Vorlesens im Kontext der Sprachpflege und der Leseförderung.
- Die historische Entwicklung des Vorlesens im Unterricht
- Der Einfluss des Vorlesens auf die Sprachentwicklung
- Die Bedeutung des Vorlesens in verschiedenen Epochen
- Die Rolle des Lesebuchs in der Leseförderung
- Die Herausforderungen des (Vor-)Lesens im heutigen Deutschunterricht im Lichte der PISA-Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Lesen und Vorlesen im Deutschunterricht ein und beschreibt die historische Entwicklung des Vorlesens von der Antike bis zur Gegenwart. Sie stellt heraus, dass Lesen lange Zeit vorwiegend als Vorlesen praktiziert wurde und betont die Bedeutung dieser Praxis für die Sprachentwicklung und die Leseförderung, besonders im Kontext der Illiteratur früherer Zeiten. Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung und Abgrenzung des Themas, welches die Arbeit im Detail beleuchten wird.
2. Schulische Förderung des Vorlesens: Dieses Kapitel analysiert die schulische Förderung des Vorlesens vom 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es untersucht verschiedene historische Phasen, unter anderem die Rolle des Vorlesens in literarischen Zirkeln des Barocks sowie die Bedeutung des Vorlesens für die Sprachpflege und Vereinheitlichung. Es werden die Entwicklungen der Vorlesekultur und die sich ändernden Ansichten zur Bedeutung von Vorlesepraxis in der Schule aufgezeigt.
3. Der Deutschunterricht im 20. Jahrhundert: Das Kapitel behandelt den Deutschunterricht im 20. Jahrhundert, mit einem besonderen Fokus auf die NS-Zeit und die Entwicklung nach 1968. Es analysiert die Auswahl der Autoren und Themen in den Lesetexten und ihre didaktische Bedeutung. Der Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung auf die Gestaltung des Deutschunterrichts und somit auf die Praxis des Vorlesens wird beleuchtet, mit einem Schwerpunkt auf die Rolle des Lesebuches im Schulsystem. Die unterschiedlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik und der DDR werden betrachtet.
4. Die Bedeutung des Deutschunterrichts heute: Dieses Kapitel befasst sich mit der heutigen Bedeutung des Deutschunterrichts und des (Vor-)Lesens im Kontext der PISA-Studien. Es analysiert die Lesekompetenzen deutscher Schüler und diskutiert die Ursachen für Lesekrisen und Leseunlust. Weiterhin werden die aktuellen Rahmenlehrpläne für die Grundschule, die Sekundarstufe I und die gymnasiale Oberstufe in Bezug auf die Bedeutung und die Verankerung von Lesen und Vorlesen im Unterricht untersucht.
Schlüsselwörter
Lesen, Vorlesen, Deutschunterricht, Leseförderung, Sprachentwicklung, Geschichte des Vorlesens, PISA-Studie, Lesebuch, Literaturunterricht, Rahmenlehrplan.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Historische Entwicklung des Vorlesens im Deutschunterricht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Vorlesens im Deutschunterricht und dessen Bedeutung von der Antike bis zur Gegenwart. Sie beleuchtet die Veränderungen der Praxis und der didaktischen Konzepte des Vorlesens im Wandel der Zeit und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen auf die Rolle des Vorlesens in der Sprachpflege und Leseförderung.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Zeitraum von der Antike bis zur Gegenwart, mit einem Schwerpunkt auf dem 17., 18. und 20. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Zeit und der Zeit nach 1968, gewidmet. Die aktuelle Bedeutung des Vorlesens im Kontext der PISA-Studien wird ebenfalls analysiert.
Welche Aspekte der Entwicklung des Vorlesens werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Vorlesens im Unterricht, den Einfluss des Vorlesens auf die Sprachentwicklung, die Bedeutung des Vorlesens in verschiedenen Epochen, die Rolle des Lesebuchs in der Leseförderung, und die Herausforderungen des (Vor-)Lesens im heutigen Deutschunterricht im Lichte der PISA-Studien. Die Veränderungen der Vorlesekultur und die sich ändernden Ansichten zur Bedeutung von Vorlesepraxis in der Schule werden aufgezeigt.
Welche Rolle spielt das Lesebuch in der Arbeit?
Das Lesebuch spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit, da es ein wichtiges Medium der Leseförderung im Deutschunterricht darstellt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Lesebuchs im Laufe der Zeit, die Auswahl der Autoren und Themen, und den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen auf dessen Gestaltung.
Wie wird die Bedeutung des Vorlesens im heutigen Deutschunterricht bewertet?
Die Arbeit bewertet die Bedeutung des Vorlesens im heutigen Deutschunterricht im Kontext der Ergebnisse der PISA-Studien. Sie analysiert die Lesekompetenzen deutscher Schüler und diskutiert die Ursachen für Lesekrisen und Leseunlust. Die aktuellen Rahmenlehrpläne für die Grundschule, die Sekundarstufe I und die gymnasiale Oberstufe werden hinsichtlich der Bedeutung und Verankerung des Lesens und Vorlesens im Unterricht untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Schulische Förderung des Vorlesens, 3. Der Deutschunterricht im 20. Jahrhundert, und 4. Die Bedeutung des Deutschunterrichts heute. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der historischen Entwicklung und der aktuellen Bedeutung des Vorlesens im Deutschunterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Lesen, Vorlesen, Deutschunterricht, Leseförderung, Sprachentwicklung, Geschichte des Vorlesens, PISA-Studie, Lesebuch, Literaturunterricht, Rahmenlehrplan.
- Quote paper
- Janice Höber (Author), 2007, Lesen und Vorlesen von (literarischen) Texten in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138885