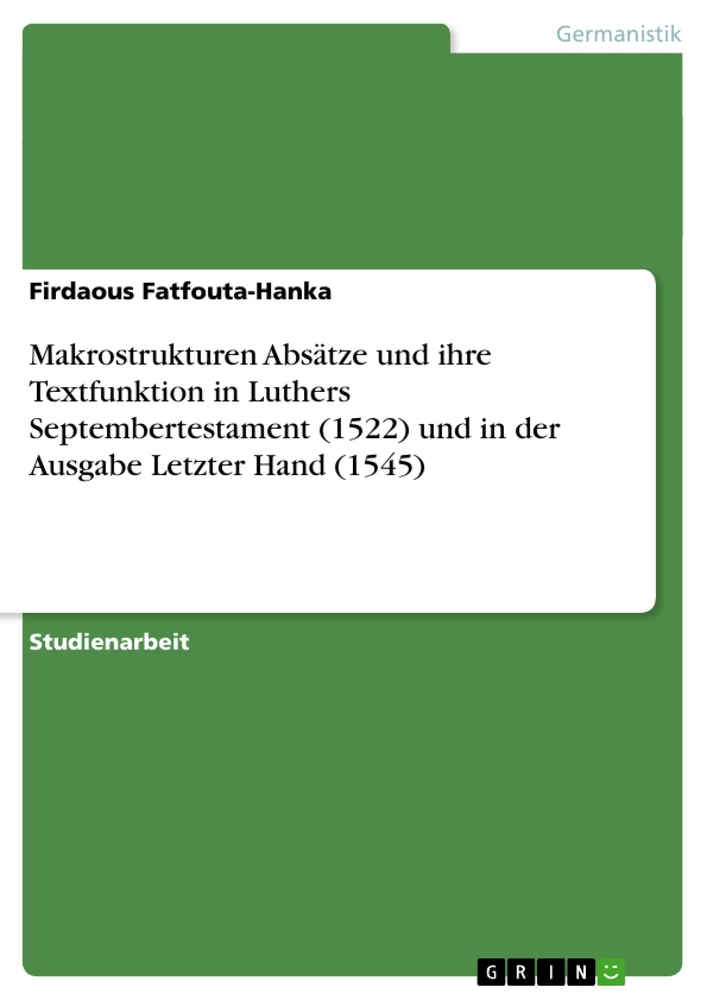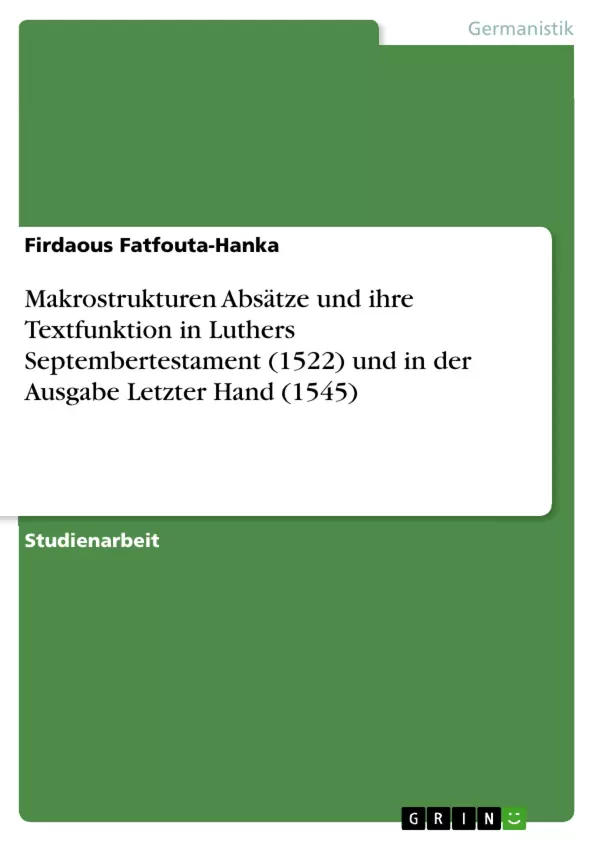In dieser Arbeit werden zu den Makrostrukturen im Matthäusevangelium des
Theologen D. Martin Luthers die Absätze unter ausdrucks- und inhaltsseitiger
Betrachtung untersucht. Als Grundlage dieser Analyse dient primär die
Ausgabe letzter Hand (1545). Sekundär wird das Septembertestament (1522)
hinzugezogen, wobei eine gründliche Analyse1 dieser letztgenannten Ausgabe
nicht durchgeführt werden kann, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen
würde.
Das erste Ziel dieser textlinguistischen Analyse ist also die beiden Textkorpora
systematisch und empirisch in Bezug auf die Makrostruktur „Absatz“ zu
erfassen. Der nächste Schritt wird die Untersuchung der Textfunktion in Bezug
auf die Hervorhebung der Inhaltsseite sein, wobei hier nur auf die Ausgabe von
1545 eingegangen wird.
1 Beim Septembertestament (1522) wird nur eine tabellarische Analyse bezüglich der
Makrostruktur Absatz durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Begriff Makrostuktur
- 1.1 Definition
- 1.2 Materialgrunglage
- 1.3 Initiatoren und Terminatoren
- 1.4 Vorgehensweise
- 1.5 Abkürzungsverzeichnis
- 2. Absatzstrukturen – ausdrucksseitig
- 2.1 Tabelle 1
- 2.2 Tabelle 2
- 2.3 Tabelle 3
- 2.4 Tabelle 4
- 2.5 Kapitel und Absätze
- 3. Absatzstrukturen – inhaltsseitig
- 3.1 Matthäus Kapitel II
- 3.2 Matthäus Kapitel V
- 3.3 Matthäus Kapitel X
- 3.4 Matthäus Kapitel XXVIII
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Makrostrukturen, insbesondere Absätze, im Matthäusevangelium von Martin Luther unter Berücksichtigung der Ausdrucks- und Inhaltsseite. Der Fokus liegt dabei auf der Ausgabe letzter Hand (1545) und dem Septembertestament (1522). Das Ziel ist es, beide Textkorpora systematisch und empirisch in Bezug auf die Makrostruktur „Absatz“ zu erfassen und die Textfunktion im Hinblick auf die Hervorhebung der Inhaltsseite zu untersuchen.
- Analyse der Makrostruktur „Absatz“ im Matthäusevangelium
- Untersuchung der Ausdrucksseite der Absätze
- Untersuchung der Inhaltsseite der Absätze
- Vergleich zwischen der Ausgabe letzter Hand (1545) und dem Septembertestament (1522)
- Hervorhebung der Textfunktion in Bezug auf die Inhaltsseite
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Vorgehensweise. Kapitel 1 definiert den Begriff „Makrostuktur“ und bezieht sich dabei auf die Definition von Franz Simmler. Es werden die Grundlagen des verwendeten Materials, die Initiatoren und Terminatoren der Makrostrukturen sowie die Vorgehensweise der Analyse erläutert. Kapitel 2 betrachtet die Absatzstrukturen ausdrucksseitig anhand von Tabellen, die die verschiedenen strukturellen Merkmale der Absätze aufzeigen. In Kapitel 3 wird die inhaltsseitige Struktur der Absätze untersucht, wobei exemplarisch die Kapitel II, V, X und XXVIII des Matthäus-Evangeliums analysiert werden.
Schlüsselwörter
Makrostrukturen, Absätze, Textfunktion, Matthäusevangelium, Martin Luther, Ausgabe letzter Hand, Septembertestament, textlinguistische Analyse, Ausdrucksseite, Inhaltsseite, Empirie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Makrostruktur in der Textlinguistik?
Es beschreibt die übergeordnete Gliederung eines Textes, in diesem Fall die systematische Einteilung in Absätze im Matthäusevangelium.
Was unterscheidet das Septembertestament (1522) von der Ausgabe letzter Hand (1545)?
Die Ausgabe von 1545 stellt Luthers finale Revision dar; die Arbeit vergleicht die Absatzstrukturen beider Versionen empirisch.
Welche Funktion haben Absätze laut der Analyse?
Absätze dienen der Hervorhebung der Inhaltsseite und strukturieren den Text für den Leser sowohl optisch als auch inhaltlich.
Was sind Initiatoren und Terminatoren?
Es sind sprachliche oder formale Merkmale, die den Beginn (Initiator) oder das Ende (Terminator) eines Absatzes markieren.
Wie ging Luther bei der Gliederung des Matthäusevangeliums vor?
Die Arbeit untersucht dies beispielhaft an den Kapiteln II, V, X und XXVIII, um Luthers strukturelle Entscheidungen nachzuvollziehen.
- Quote paper
- M. A. Firdaous Fatfouta-Hanka (Author), 2000, Makrostrukturen Absätze und ihre Textfunktion in Luthers Septembertestament (1522) und in der Ausgabe Letzter Hand (1545), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13890