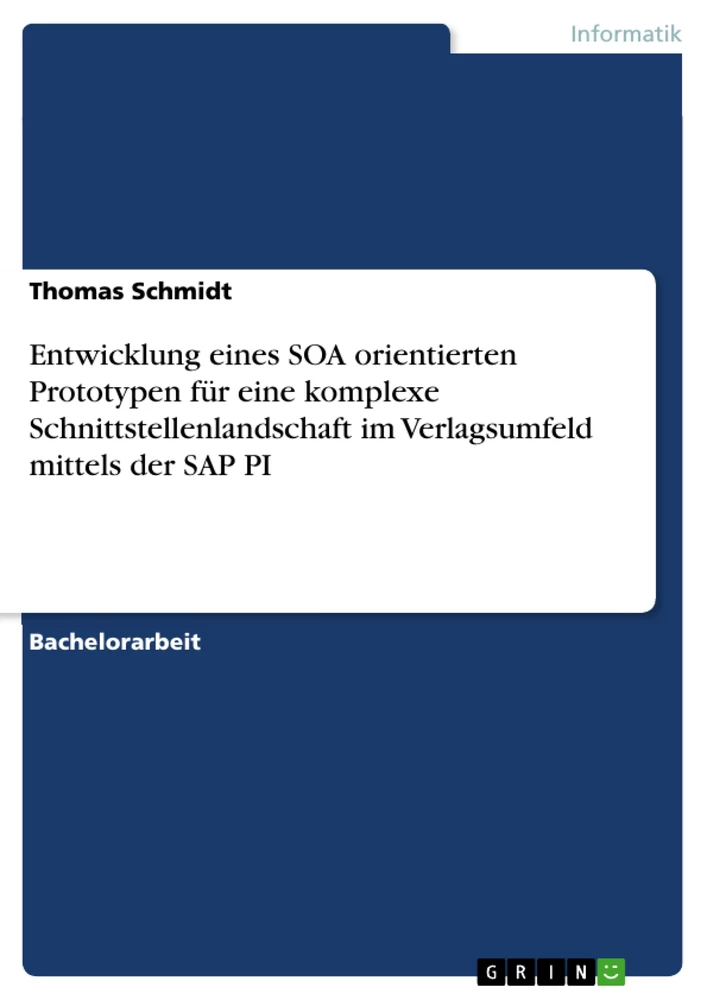Die Zielstellung dieser Arbeit ist die Untersuchung der Schnittstellenlandschaft des Springer Verlags und die Modellierung möglicher Verbesserungen. Wobei die vom Autor präferierte Lösung technisch in einem Prototypen realisiert und vorgestellt wird. Das Augenmerk wird besonders auf Datenkonsistenz, Abhängigkeiten, Fehlerbehandlung, Vermeidung von Dateischnittstellen und dem Verhalten der Schnittstellen beim Neustarten (wieder Anstarten) liegen. Es geht somit um den besseren Betrieb und Überblick der Schnittstellenlandschaft im Ganzen.
Im Augenblick funktionieren die Schnittstellen durch das Vorhandensein von vielen Triggern, die zueinander eine starke Verzahnung generieren. Durch diese Verzahnung enstehen viele "Hotspots", an denen die Übertragung der Daten in den Schnittstellen gefährdet ist.
Im Ganzen sind viele Punkte entstanden, an denen die Daten angepasst und geprüft werden. Dadurch sind viele Abhängigkeiten vorhanden, die manche Abläufe unnötig kompliziert erscheinen lassen, was sich auch in der Umsetzung der aktuellen Schnittstellenlandschaft wiederspiegelt. Die Schnittstellen sind so mitunter um die 10 Jahre gewachsen und in ihrer Komplexität und den Abhängigkeiten zu einander stetig gestiegen. Die verantwortliche IT hat erkannt, dass mit zunehmenden Abhängigkeiten auch das Risiko von Fehlern wächst. In den letzten Jahren istdie tägliche Fülle an Arbeit, dieauf dasWarten der Schnittstellen zurückzuführen ist, nicht weniger geworden. Durch die Adaptierung aktueller Technologien ist eine neue Herangehensweise und eine Reduzierung der Komplexität möglich. Diese Arbeit hat die Zielstellung, einen Beitrag in diese Richtung zu leisten.
Dazu kommt die stetig gestiegene Komplexität, die es nicht erlaubt einfach die neuen Möglichkeiten, die einem durch neue Technologie gegeben sind, voll zu nutzen. Vielmehr wird die alte Konstruktion nachgebaut, um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden.
Die Zielstellung dieser Arbeit umfasst die Hauptkomplikationspunkte in der jetzigen Schnittstellenlandschaft. Thema ist diese zu identifizieren und Konzepte zu entwerfen, wie die Hauptkomplikationspunkte durch neue Architekturen abgebaut oder vermieden werden können. Besonderes Augenmerk wird auf den Möglichkeiten der SAP PI und ihrer BPE als ESB sowie modernen Konzepten der SOA liegen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung / Zielstellung der Arbeit
1 Die Einleitung
1.1 Einleitende Gedanken
1.2 Allgegenwärtige Dynamik
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Das Unternehmen Springer
2.1 Globale Verteilung
2.2 Gewachsen durch Notwendigkeit
2.3 Produktlogik
3 Die Beschreibung der aktuellen Systemlandschaft
3.1 Systembesehreibung
3.1.1 Herstellung und Planung
3.1.2 Materialwirtsehaft/Vertrieb | internes & externes Rechnungswesen ,
3.2 Aktuelle Sehnittstellenlandsehaft
3.2.1 Werkzeuge / Techniken
3.2.1.1 Batehverarbeitung / Q32 Administration
3.2.1.2 Konverter
3.2.2 Ablauf der Synchronisation / Integration
3.2.2.1 Export PPM
3.2.2.2 Zentrales Element in den Schnittstellen
3.2.2.3 Import SAP
3.2.2.4 Rückschnittstelle SAP zum PPM
3.3 SAP Process Integration (PI)
3.3.1 System Landscape Directory
3.3.2 Integration Repository - Design
3.3.3 Integration Directory - Konfiguration
3.3.4 Business Process Engine | Business Process Execution Language , ,
3.3.5 Art der Übertragung | SAP PI Adapter
4 Die Bewertung der momentanen Lage
4,1 Übergang in neue Technologien
4,2 Aufbau auf prozedur aler Ebene
5 Die Möglichkeiten der Verbesserung
5.1 Ein pragmatischer Ansatz
5.2 Der Enterprise Service Bus (ESB) und die Enterprise Application Integration (EAI) Plattform SAP PI
5.3 Aufteilung der Logik
5.3.1 Verknüpfung der Logik
5.3.2 Aufgaben des Anwendungssystems
5.3.3 Aufgaben der SAP PI
5.4 Möglichkeiten der Realisierung
5.4.1 Konzepte zur Umsetzung
5.4.2 Fehlerbehandlung
5.5 Präferierte Lösung
6 Die prototypische Umsetzung
6.1 Auswertung der Anforderungen & Schwierigkeiten
6.2 Konzipierung des Designs
6.3 Realisierung
6.3.1 Zur SAP PI per SOAP - der Springer-Adapter
6.3.2 Aufbau der Konfigurationsdatei
6.3.3 Die Umsetzung in der SAP PI
6.3.3.1 Erster Block im Integrationsprozess
6.3.3.2 Zweiter Block im Integrationsprozess
6.3.3.3 Dritter Block im Integrationsprozess
6.3.3.4 Überwachung des Integrationsprozesses
7 Die Ergebnisse
7.1 Schlussfolgerungen
7.2 Vision
Literaturverzeichnis
Anhang
A Abbildungen zum besseren Verständnis
В Tabellen zum besseren Verständnis
C Wichtige Konzepte zur Komplcxitätsvcrmindcrung
D Groovy
E Quelleode Springeradapter
E.l Haupt_Objekt - SpringerAdapterMain
E.2 Datenbankobjekt - DatabasePPM
E.3 SOAP_Objekt - SendingDataSoap
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Glossar
ANT
Ein von Apache bereitgestelltes Werkzeug zum automatischen Erzeugen von fertigen Java Archive ( AR)-Files ans einer beliebigen Anzahl von Qnelleode-Dateien, Es ist vergleichbar mit dem in der UNIX-Welt gebräuchlichen ???? Befehl, AXT kann aber noch weit ans mehr1
BuzzWord Bingo
Meint das Benutzen von zu meist inhaltsleeren Schlagworten,
Client/Server Architektur
Betitelt eine dynamische Architektur, die im Gegensatz zum Mainframe ein verteiltes Rollensystem hat, wobei ein Element dieser Architektur die Rolle eines Servers (verteilt Informationen) oder eines Clienten (empfängt Informationen) annehmen kann,
Entität
Als Entität wird alles Existierende bezeichnet.
Exception
Als Exception werden in der Java Welt Ausnahmen im Programmablauf bezeichnet. Exceptions repräsentieren daher eingeplante Fehler, die keine ungewissen Situationen im Betrieb entstehen lassen2
Hotspot
Meint im Zusammenhang mit dieser Arbeit fehleranfällige Übergänge in Schnittstellen,
Individualsoftware
Individualsoftware zeichnet sich dadurch aus, dass sie nur für einen oder für wenige Anwendungsfälle geschaffen wird,
Job Scheduling
Jobs sind Aufgaben, die in Form von Prozessen ausgeführt werden. Scheduling meint das automatische Anstoßen dieser Prozesse, welche damit als Batchprozesse zu verstehen sind.
Bezeichnet eine herkömmliche Architektur von Großrechnern, die früher das zentrale Element einer Unternehmung waren, Zugriff bekommt man nur über ein Terminal, das die einzige Schnittstelle zwischen dem Mainframe und dem Benutzer darstellt.
Mapping
Betitelt den Prozess, bei dem ein Messageinterface auf ein anderes abgebildet und die Daten der Startnachricht in das Format der Zielnachricht überführt werden,
Message
Ist eine Nachricht und bezeichnet die Abstraktions-Ebene, auf der innerhalb der Process Integration ( ) gearbeitet wird. Sie ist die grundlegene Kommunikationseinheit im Konzept der Business Process Engine (????), mit der auch der Integrationsprozess programmiert wird,
Meta-Ebene
Die Meta-Ebene ist als eine höhere Abstraktionsebene zu verstehen. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wird sie hauptsächlich gebraucht, wenn eine Struktur in sieh zu kompliziert wird, einen Standpunkt einzunehmen, der versucht, die Struktur von einer höheren Sichtweise zu betrachten,
obsolet
Etwas ist veraltet oder hinfällig,
Paradigma
Kann als ein Muster oder Vorbild gesehen werden, das die grundlegende wissenschaftliche Denkweise eines Sachverhaltes wiederspiegelt,
Raumzeitkontinuum
Ist fester Bestandteil von Albert Einsteins Relativitätstheorie und bildet eine 4- dimensionale Struktur aus Raum und Zeit,
Return on Investment
Kann als eine periodische Bezugsgröße verstanden werden, die den finanziellen Erfolg angibt, den das eingesetzte Kapital erwirtschaftet hat3
Reverse Engineering
In diesem Prozess werden durch Abstraktion aus einem existierenden System die Entwicklungsmuster abgeleitet4
Routing
Bezeichnet das Steuern von Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger,
SPRINT
Order fulfillment and warehouse based on SAP, Im Springer Verlag werden die SAP Module Vertrieb (SD) und Materialwirtschaft (MM) intern als SPRIXT bezeichnet,
Standardsoftware
Durch diese Software werden Anwendungsfälle abgedeckt, die bei einer Vielzahl von Unternehmen gleich sind. Besonderes Augenmerk dieser Arbeit liegt auf der Standardsoftware Systeme, Anwendungen, Produkte (SAI ),
Trigger
Meint einen Prozess, der einen Vorgang anstößt und ihn damit beginnen lässt. Ein Trigger stellt somit ein auslösendes Moment dar.
Web Service
Möglichkeit, Funktionalitäten global und vor allem Programmiersprachen-unabhängig zur Verfügung zu stellen und zu nutzen. Die Kommunikation wird hierbei üblicherweise unter Verwendung vom HTTP Protokoll realisiert, ist aber nicht von diesem abhängig.
Wrapper
Ein Programm, das einen umschlossenen Programmeode ausführt. Im Zusammenhang dieser Arbeit werden Funktionsbausteine und Java Archive ausgeführt und benötigte Abhängigkeiten mitgeladen,
Z-Tabellen
Tabellen, die der Kunde im SAP System anlegt, müssen mit einem 7 beginnen, damit die Integrität der systemeigenen Datenbanktabellen nicht gefährdet wird.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1,1 : Ausschnitt des Raumzeitkontinuums
Abbildung 1,2 : Die Entwicklung der Systeme seit den 70er Jahren
Abbildung 1,3 : Ein Vergleich der Paradigmen durch Google Trends
Abbildung 1,4 : Die Beschleunigungsspirale von Hartmut Rosa
Abbildung 2,1 : Organigram IT
Abbildung 2,2 : Verteilung der Verlage über den Planeten
Abbildung 2,3 : Die Entwicklung der Hauptkomponenten
Abbildung 2,4 : Die Produktlogik der Bücher
Abbildung 3,1 : Die relevanten Karteikästen im PPM System
Abbildung 3,2 : Die Abbildung der PPM Logik im SAP durch Projektstrukturplan-Elemente
Abbildung 3,3 : Links: Die Logik der K&P Schnittstellenkonverter | Rechts: Der Ordneraufbau der Konverter
Abbildung 3,4 : Die Skizzierung der aktuellen Synchronisation / Integration
Abbildung 3,5 : Erklärung zum Abschnitt PPM Export aus Abb,: 3,4 auf
Abbildung 3,6 : Der momentane Import der Integrationsdaten ins SPRIXT über Änderungstabellen
Abbildung 3,7 : Der Import ins FI/CO durch Kontrollprogramm ZSIX- BOUXD1 gesteuert
Abbildung 3,8 : Der SAP XetWeaver, der als Infrastruktur für fast alle aktuellen SAP Lösungen dient
Abbildung 3,9 : Business Prozesse im Integration Repository
Abbildung 6,1 : Designschritte für die Umsetzung des Integrationsprozesses
Abbildung 6,2 : Struktur des Springer-Adapter vom Altsystem PPM zur SAP PI
Abbildung 6,3 : Der vom Springer-Adapter realisierte Datenstrom vom PPM System zur SAP PI
Abbildung 6,4 : Der prototypisehe Integrationsprozess am Beispiel der Schnitt stelle SPV_E_SPXT, bei der die Integrations daten aus dem PPM per SOAP kommen und mit dem SAP R/3 System synchronisiert werden
Abbildung A.l : Der Lebenszyklus der Sonne
Abbildung A.2 : Das Wachstum des Internets: Wird ausgedrückt durch die Anzahl der Computer mit registrierter IP Adresse
Abbildung A.3 : Die Beschleunigung der Innovationszyklen durch neue Medien
Abbildung A.4 : Die Erweiterung der Produkte durch neue Medien und Technologien
Abbildung A,5 : Verantwortlichkeiten/Kompetenzen sind über den Planeten verstreut
Abbildung A.6 : Die Verteilung auf Xetzwerkebene
Abbildung A.7 : Ausschnitt Schnittstellenlandschaft Springer Science—Business Media 2007/2008
Abbildung A.8 : Die Masken des PPM Systems im Produktmodus
Abbildung A.9 : Das Flowsystem - seine Funktionalität und die Verbindung zum SAP System
Abbildung A.10 : Grobskizze der Synchronisation zwischen dem PPM und dem SAP System
Abbildung A.ll : Die Q32 Administration, in der sieh Queueagents verwalten lassen
Abbildung A.12 : Die Skizzierung der aktuellen Synchronisation / Integration mit Programmnamen
Abbildung A.13 : Darstellung der Sehnisttelle SPV_E_SPXT - im Detail das Anlegen oder Ändern von Buchreihen
Abbildung A.14 : Darstellung der Sehnisttelle SPV_E_SPXT - im Detail das Anlegen oder Ändern von Büchern xxvii
Abbildung A.15 : Der Konfigurationsassistent der SAP Process Integration im Integration Directory xxviii
Abbildung A.16 : Das zentrale Element vor der SAP PI war das Streamserve System
Abbildung A.17 : Die PI verbindet zwei Systeme miteinander
Abbildung A.18 : Die Aufgaben die nacheinander in der PI erledigt werden ,
Abbildung A.19 : Steckbrief System-Landscape-Directory
Abbildung A.20 : Steckbrief Integration Repository
Abbildung A.21 : Steckbrief Integration Directory
Abbildung A.22 : Die wichtigsten Elemente in der Designphase
Abbildung A.23 : Der Editor für das Business Process Management der SAP Process Integration
Abbildung A.24 : Visualisierung der optimalen Messagegröße für Xachrich- ten an die SAP Process Integration
Abbildung A.25 : Die Aggregation von Informationen zu Kennzahlen, am Beispiel eines Umweltkennzahlensystems
Abbildung A.26 : Die Erzeugung einer WSDL Datei aus einem Messageinterface durch die SAP PI
Abbildung A.27 : Ein Beispielprozess in der Business Process Engine der SAP Process Integration
Abbildung A.28 : Eine Übersieht, wie sieh die objektorientierten Programmiersprachen entwickelt und durchgesetzt haben
Abbildung A.29 : Die Synchronisation der “Integrationsdaten” über Änderungstabellen
Abbildung A.30 : Die Erklärung der Konfigurationsdatei, die die Funktionsweise des Adapters bestimmt xxxviii
Abbildung A,31 : Die Erklärung zu Abbildung 6,3 auf Seite 55
Abbildung A.32 : Der Weg der Integrationsdaten vom PPM über den Adapter zu den zugehörigen MPs der SAP PI
Abbildung A.33 : Die grafische Darstellung des Integrationsprozesses durch die Transaktion SXMB_MOXI_BPM xl
Abbildung D.34 : Die Realisierung des Sachverhaltes X in Java
Abbildung D.35 : Die Realisierung des Sachverhaltes X in Groovy
Tabellenverzeichnis
Tabelle 7,2 : Ein Verzeichnis aller Verlage mit zugehöriger Firmengruppe für Amerika
Tabelle 7,4 : Ein Verzeichnis aller Verlage mit zugehöriger Firmengruppe für Asien / Europa Teill
Tabelle 7,6 : Ein Verzeichnis aller Verlage mit zugehöriger Firmengruppe für Europa Teil2
Zusammenfassung / Zielstellung der Arbeit
Die Zielstellung dieser Arbeit ist die Untersuehung der Sehnittstellenland- sehaft des Springer Verlags und die Modellierung möglieher Verbesserungen, Wobei die vom Autor präferierte Lösung teehniseh in einem Prototypen realisiert und vorgestellt wird. Das Augenmerk wird besonders auf Datenkonsistenz, Abhängigkeiten, Fehlerbehandlung, Vermeidung von Dateischnittstellen und dem Verhalten der Schnittstellen beim Neustarten (wieder Anstarten) liegen. Es geht somit um den besseren Betrieb und Überblick der Schnittstellenlandschaft im Ganzen,
Im Augenblick funktionieren die Schnittstellen durch das Vorhandensein von vielen Triggern, die zueinander eine starke Verzahnung generieren. Durch diese Verzahnung enstehen viele "Hotspots'"a, an denen die Übertragung der Daten in den Schnittstellen gefährdet ist.
Im Ganzen sind viele Punkte entstanden, an denen die Daten angepasst und geprüft werden. Dadurch sind viele Abhängigkeiten vorhanden, die manche Abläufe unnötig kompliziert erscheinen lassen, was sieh auch in der Umsetzung der aktuellen Schnittstellenlandschaft wiederspiegelt. Die Schnittstellen sind so mitunter um die 10 Jahre gewachsen und in ihrer Komplexität und den Abhängigkeiten zu einander stetig gestiegen. Die verantwortliche Informationstechnik ( ’) hat erkannt, dass mit zunehmenden Abhängigkeiten auch das Risiko von Fehlern wächst. In den letzten Jahren ist die tägliche Fülle an Arbeit, die auf das Warten der Schnittstellen zurückzuführen ist, nicht weniger geworden. Durch die Adaptierung aktueller Technologien ist eine neue Herangehensweise und eine Reduzierung der Komplexität möglich. Diese Arbeit hat die Zielstellung, einen Beitrag in diese Richtung zu leisten.
Dazu kommt die stetig gestiegene Komplexität, die es nicht erlaubt einfach die neuen Möglichkeiten, die einem durch neue Technologie gegeben sind, voll zu nutzen. Vielmehr wird die alte Konstruktion nachgebaut, um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden.
Die Zielstellung dieser Arbeit umfasst die Hauptkomplikationspunkte in der jetzigen Schnittstellenlandschaft. Thema ist diese zu identifizieren und Konzepte zu entwerfen, wie die Hauptkomplikationspunkte durch neue Architekturen abgebaut oder vermieden werden können. Besonderes Augenmerk wird auf den Möglichkeiten der SAP P und ihrer BPI als Enteprise Service Bus ( lSB)sowie modernen Konzepten der Service-orientierte Architekturen (SOA) liegen,
1 Die Einleitung
1.1 Einleitende Gedanken
Der Punkt im Raumzeitkontinuum, den diese Arbeit abdeckt, ist vollends im digitalen Zeitalter integriert und es gibt kaum noch einen Beruf, der keine grundlegenden IT- Kenntnisse erfordert. In Abb,: 1,1 befindet sieh dieser Punkt im Raumzeitkontinuum 4,6 Milliarden Jahre nach der Entstehung der Sonne und liegt damit ea, in der Mitte ihrer anzunehmenden Lebenserwartung5 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1,1: Ausschnitt des Raumzeitkontinuums7
Die ist eine stark antreibende Kraft, Es ist mittlerweile zur Normalität geworden, dass sehon ein mittelständisehes Unternehmen eine recht komplexe Systemlandschaft zu betreuen hat.
Ab einer bestimmten Größe benötigt ein Unternehmen mehr als ein System, um seine Geschäfte in einer globalisierten Welt, konkurrenzfähig zum Erfolg8 zu führen. Es existieren zwar Lösungen von verschiedenen Anbietern, die als Standardsoftware die meisten Prozesse in einem Unternehmen abdecken, aber dennoch gibt kein Unternehmen, das alleinig diese “eine” Standardsoftware einsetzt und sonst keine andere Software ,9 Ein Kornstück der Betrachtungen im -Bereich liegt auf den Datenströmen und demzufolge auf der eigentlichen Information. Wo kommt die Information her, wo geht sie hin und wie besehreitet sie diesen Weg,
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1.2: Die En t wiklung der Systeme seit den 70er Jahren10
Wird die Information auf ihrem Weg durch verschiedene Abteilungen geleitet, entsteht leicht eine Situation, in der verschiedene lokale Optima existieren, die im Ganzen gegen ein globales Optimum streben ,11 Durch den Einsatz von mehreren Systemen in verschiedenen Abteilungen ist dementsprechend auch nicht immer klar, wo werden Daten genau wie und warum verändert.
Hinzu kommt die Tatsache, dass die technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten fast exponentiell angewachsen ist. Als ein exemplarisches Beispiel kann an dieser Stelle das Wachstum des Internets genommen werden, das im Anhang auf Seite xvi in Abb,: A von 1990 bis zum Jahre 2006, durch die Anzahl der Hosts ausgedrückt wird, Waren in den 70er Jahren noch Mainframe Systeme die vorherrschende Plattform im betrieblichen Einsatz, so sind diese mehr und mehr neuen Technologien, wie dynamischen Clicnt/Scrvcr Architekturen gewichen12 13 14
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1,3: Ein Vergleich der Paradigmen durch Google Trends15
Die Informatik als solche existiert im Vergleich zu anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen erst seit kurzer Zeit, Aus diesem Grund sind die Paradigmen ,16 die diese Wissenschaft ausmachen, noch in einem sehr zügigen Wandel ,17
Dieser Wandel ging auf höherer Ebene Hand in Hand mit dem Wechsel der Paradigmen auf unteren Abstraktionsebenen, nämlich der Art, wie diese Bausteine im Kleinen programmiert werden ,18 Von der anfänglich maschinennahen Assemblerprogrammierung über prozedurale Programmierung bis zum heutigen Hauptprogrammierparadigma - der Objektorientierung ,19
1.2 Allgegenwärtige Dynamik
In der Berliner Eingangshalle des Springer-Unternehmens steht geschrieben: “Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht, wissen, ein Ozean.20
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten21
Abbildung 1.4: Die Beshleunigungsspirale v on Hartm ut Rosa
Um mit den Unmengen an Informationen klar zu kommen, war schon immer ein Abgrenzen der Bereiche notwendig. Die Naturwissenschaft unterteilt sieh zum Beispiel in eine Vielzahl von Teilwissenschaften, die wiederum selber auch immer feiner granuliert werden. Dieses weiterführende Verständnis in allen Teilbereichen wird eben als ’’Beschleunigung“ interpretiert und treibt sieh selber an ,22 Die Teilbereiche werden durch den höheren Detaillierungsgrad aller Bausteine fortwährend komplexer. Daher muss eine Mare. Abgrenzung der Teilbereiche, im Unternehmen an das Know How der Mitarbeiter angepasst sein. Ein Mitarbeiter allein kann die ganze Schnittstellenlandschaft schon lange nicht mehr überblicken.
Auch im Springer-Unternehmen wurden dit und Abb,: A im Anhang ab Seite xvii zu erkennen ist
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1,4: Die Beschleunigungsspirale von Hartmut Rosa
Die Systemlandschaft, die aktiv die betriebswirtschaftlichen Abläufe koordiniert und unterstützt, ist ständig im Wandel, Heute ist daher eine sehr heterogene Systemlandschaft vorzufinden, die eine Vielzahl von Systemen vereint. Die schnelle technische Entwicklung und die fortschreitend detailliertere Bildung der Menschen führt zu immer größer werdenden Abgrenzungen in der Bildung der Mitarbeiter, Es arbeiten immer mehr Spezialisten aus einzelnen Teilbereichen zusammen, die meist den Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Dazu kommt das ’’BuzzWord Bingo“ der ’’Unternehmens Solution” Produzenten und “der Druck immer auf dem Laufenden bleiben zu müssen”.
Betrachtet man diese sieh selbst antreibenden Umstände genauer, wird schnell klar, dass diese rasant anwachsende Beschleunigung auch Probleme bereit hält. Durch die Sehnelllebigkeit bleibt nicht mehr wirklich Zeit, sieh umfassend mit Aufgaben auseinanderzusetzen, Es wird fast nur noch parallel an verschiedenen Brennpunkten gearbeitet, Der schnelle Wandel führt somit zu pragmatischen Ansätzen, die zur Lösung der Aufgabe führen, aber im Nachhinein den Wartungsaufwand erhöhen und Änderungen erschweren. Die Praxis lässt oft nicht die Zeit, sieh theoretisch mit allen Gesichtspunkten zu befassen und auch die Beschleunigung in der Kommunikation führt dazu, dass fast nur noch an vielen Baustellen parallel gearbeitet wird ,23
Hinzu kommt der Drang nach Echtzeit. Die Beschleunigung kommt nicht aus dem Nichts, sondern wir treiben diese selber an , Der Drang des Managements nach Echtzeit treibt nicht nur die Integration in den Unternehmen an,24 sondern auch zwischen ihnen. Eines der zentralen Konzepte der nächsten Jahre wird ganz klar das NetzwerkUnternehmen sein, das sieh mehr und mehr auf seine Kernkompetenzen konzentriert und durch eine Vernetzung die Nebenfunktionalitäten von Netzwerkpartnern abdecken lässt, die diese wiederum mit ihren Kernkompetenzen abdecken. So entsteht ein Netzwerk von Unternehmen, die einen Vorteil gegenüber den Unternehmen haben, die nicht in einem Netzwerkverbund integriert sind: 25
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in mehrere Kapitel untergliedert, die den Weg des Antors, bei der Bearbeitung des Themas, naehbilden. Wichtige Begriffe sind im Glossar erklärt, Abkürzungen werden beim ersten Auftreten ausgeschrieben und sind im Abkürzungsverzeichnis übersichtlich geordnet.
1, Dies ist das ersten Kapitel, in dem einleitende Gedanken zusammengefasst werden, um den Leser in die Thematik zu geleiten,
2, Im zweiten Kapitel wird das Unternehmen Springer vorgestellt und auf die Problemstellung eingegangen, die zum Verfassen dieser Arbeit führte. In diesem Kapitel wird desweiteren auf die globale Verteilung und die damit verbundenen Einwirkungen sowie auf das Wachstum des Unternehmens eingegangen. Der letzte Teil des ersten Kapitels wird eine kurze Einführung in die Produktlogik der Springer Science—Business Media sein,
3, Im dritten Kapitel wird auf die momentane Systemlandschaft eingegangen und somit die Ist-Situation analysiert. Es werden die einzelnen Komponenten und ihre Abhängigkeiten von einander betrachtet und auf Grundlage dessen wird die Realisierung der Schnittstellen zwischen dem beteiligten System erörtert und ihr Aufbau betrachtet. In diesem Kapitel wird auch das zentrale Element in der Neugestaltung detailliert in allen relevanten Punkten vorgestellt - die SAP PL
4, Im vierten Kapitel findet die Betrachtung der Situation auf einer Meta-Ebene statt, wobei die gegebene Struktur analysiert wird,
5, Im fünften Kapitel werden mögliche Lösungen, aus den im vorhergehenden Kapitel herausgearbeiteten Problemen, aufgezeigt und bewertet, (Soll-Konzept)
6, Im sechsten Kapitel beschreibt der Autor seine präferierte Lösung in ihrer Umsetzung, Es werden die erkannten Anforderungen und Schwierigkeiten beschrieben und die Realisierung bis zu den Ergebnissen begleitet,
7, Abschließend gibt es ein Fazit und einige Schlußgedanken auch in Bezug auf die Zukunft
2 Das Unternehmen Springer
Das Unternehmen Springer wurde 1842 in Berlin von Julius Springer als kleiner Buchhandel gegründet und avancierte in wenigen Jahren zu einem Verlag, Der wissenschaftliche Springer Verlag'26 war sehr lange ein rein in Familienhand geführtes Unternehmen, welches erst 1999 vom Bertelsmann Verlag übernommen und im Jahr 2003 zum Abbau von Schulden an eine Gruppe von Private-Equity-Firmen (Cinven and Candover) verkauft wurde. Heute umfasst der Springer Verlag ea, 53 Verlage ,27 ist in mehr als 20 Ländern präsent und gehört zu den renommiertesten Verlagsgruppen für Wissenschaftsund Fachliteratur, Besonders hervorzuheben ist die wissenschaftliche Ausrichtung des Springer Verlages, bei dem schon mehr als 150 Nobelpreis-Träger publizierten. Die Produktpalette umfasst ein sehr großes Medienspektrum von Büchern, Zeitschriften, Newslettern, CD-ROMs, Seminaren, Online-Diensten, Protokollen, Datenbanken oder auch Konferenzen28 29
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2,1: Organigram IT30
Die vorliegende Arbeit entstand im Kernbereich des Springer Verlags, in der Niederlassung Berlin in der Abteilung Zentralbereich /?31, Die Zielsetzung dieser Abteilung sind -Aufgaben, die das gesamte Unternehmen betreffen32
- Der Aufbau eines Springer weiten -Controllings,
- Entwicklung, Koordination und Betreuung verlagsübergreifender Anwendungssysteme,
- Konzernweite Vertragsverhandlungen im -Bereich,
- Direkte -technische Betreuung des Springer Verlages,
2.1 Globale Verteilung
Während seiner Geschichte adaptierte das Unternehmen Springer zahlreiche Verlage und wurde schließlich durch den Zusammenschluss mit dem Verlag Kluwer Academie. Publishers33 zum zweitgrößten wissenschaftlichen Verlag der Welt, Die Springerholding, die aus diesem Zusammenschluss unter der Private-Equity-Firmer Cimieri und Candover entstand, vereint mehr als 50 Verlage auf 3 Kontinenten und über 20 Länder, 34
Bei der Anzahl und V erteilung v on zusammenarb eitenden V erlagen üb er den Planeten35 wird der Austaush v on Informationen zu einem wih tigen Kriterium, das denErfolg maÿgeblih ausmah t.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.2: V erteilung der V erlage üb er den Planeten 36
In Abb,: 2,2 ist die Verteilung der Verlage und damit die notwendigen Informationsströme über den Planeten gut ersichtlich. In einem global agierenden Unternehmen müssen diese Datenströme im ersten Schritt geleitet “geroutet” und im zweiten Schritt die Abhängigkeiten untereinander aufgelöst “synchronisierte werden.
Von der Schnelligkeit der Bereitstellung und der Qualität der Daten selber sind vielseitige Lieferketten abhängig, die wiederum den Umsatz des Unternehmens sichern.
Die Abhängigkeit des Management von diesen Datenströmen ist somit sehr deutlich gegeben und wird mit Voransehreiten der Beschleunigung37 immer größer werden. Bei der Betrachtung der Systeme, die im Endeffekt mit den Datenströmen die Funktionalität bereitstellen, müssen dabei wichtige Kriterien, die durch die globale Verteilung entstehen, berücksichtigt werden,
Entfernung Der gesamte Springer Verlag ist in 20 Firmengruppen über den Planeten verteilt. Die Synchronisation untereinander ist der entscheidende Punkt, wenn es um das Operative Geschäft geht38
Transport großer Datenmengen Es ist wichtig, dass die Techniken der Synchronisation gut durchdacht sind, denn die auszutauschenden Datenmengen sind teilweise sehr groß. Die Skalierbarke.it der Architektur ist ein wichtiger Punkt, der in Beobachtung bleiben und ständig an veränderte Situationen und Bedingungen angepasst werden muss,
Import großer Datenmengen Die transportierten Datenmengen müssen auch wieder in das System importiert werden. Hier ist es wichtig, die Konsistenz zu wahren.
Sicherheit In Sachen Sicherheit sind mehrere Aspekte zu beachten:
- In wie weit die eigentliche Architektur des Kerns offen gelegt werden muss, damit die Synchronisationspunkte miteinander verbunden werden können. Es geht um die Frage: Muss jeder Beteiligte alles wissen? In Bezug auf diesen Punkt wird in der Arbeit stark auf Aspekte der Objektorientierung - im speziellen das Prinzip der Kapselung39 - eingegangen,
- Wie sicher sind die Daten auf ihrem Weg und wie sicher ist der Weg an sich,
Fehlerbehandlung Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Vorgehen und das Verhalten bei Fehlern, da die Fehler im empfangenden System auftreten, aber im sendenden System korrigiert werden müssen.
[...]
a Die Einordnung der Bedeutung dieses Begriffes, sowie anderer relevanter Begriffe für diese Arbeit, ist im Glossar beschrieben.
1Siehe Entwicklerhomepage http://ant.apache.org
2 S.110 (Daum 2007), /Berthold Daum: Java 6, Addison- Wesley Verlag, 2007/ Mainframe Architektur
3 (^MANAGERS 2009), /Walter Brenner, Christoph Witte: Erfolgsrezepte für CIOs, Hanser Verlag, 2006/
4 s.ßllf (BöllM und, Fuchs 2002), /R. Böhm und E. Fuchs: System-Entwicklung in der Wirtschaftsinformatik, vdf Hochschulverlag AG, 2002/
5 Vgl: ?.? (KUMMER 2006), /Jürgen Kummer: Besondere Sterne, BoD, 2006/
6 (Siehe dazu aueh im Anhang auf Seite xvi Abb.: A)
7 Urheber des Bildes: S.157 (Green 2006), /Brian Green: Der Stoff aus dem der Kosmos ist, Verlagsgruppe Random House, 2006/
8 Unter Erfolg ist mindestens ein Return on Investment (RO ) zu verstehen, aber auch das Erlangen von Aufträgen, um das tägliche Geschäft überhaupt finanzieren zu können. Dieses setzt voraus, dass Aufgaben auf einem dem technologischen Niveau der gegenwärtigen Umwelt entsprechendem Maße ausgeführt werden.
9 Vgl.: S.33 /Brenner. und Witte 2006), /Walter Brenner, Christoph Witte: Erfolgsrezepte für CIOs, Hauser Verlag, 2006/
10 Urheber des Bildes: S.225 ('Teich et al. 2007), /Irene Teich and Walter Kolbenschlag and Wilfried Reiners: Der richtige Weg zur Softwareauswahl, Springer Seienee+Business Media, 2007/
11 Vgl.: S.35 (AIelzer 2008), /Ingo Melzer: Service-orientierte Architeeturen mit Web Services, Spektrum Akademischer Verlag, 2008/
12 (Siehe Abb.: 1.2)
13 Als passendes Beispiel kann das SAP R/2 System genommen werden, das noch eine Mainframe Architektur verfolgte. Das heutige SAP R/3 System ist dagegen cinc Clicnt/Scrvcr Architektur
14 Vgl: S.23ff /Brenner und Witte 2006)
15 Urheber des Bildes: /Google 2008), /Google: Google Trends, 2008/
16 Der Begriff des Paradigma wird in dieser Arbeit sehr maßgeblich sein, er ist im Glossar erklärt.
17 (Siehe Abb.: 1.3)
18 Vgl: S.ZO fMl'.l.Zl'.li 2008)
19 Nach Ingo Melzer stellen SOA das logisch nächste Glied der Kette dar Vgl.: S.19 (AIelzer 2008)
20 /Isaac Newton: englischer Physiker, Mathematiker, Astronom, Alchemist und Philosoph, 04.01.1643 - 31.03.1727/
21 Urheber des Bildes: S.85 (Rosa 2008), /Haiimut Rosa: Im Wirbel der Beschleunigungsspirale, Spektrum der Wissenschaft, 2008/
22 (Siehe Abb.: I.4)
23 (Siehe Ahsehnitt 5.1 ’’Ein pragmatiseher Ansatz“ ab Seite 39)
24 (Siehe dazu aueh Abb.: 1-4)
25 Vgl: S.46 (J3RLNNLR imdWlTTL 2006)
26 Der wissenschaftliche Springer Verlag hat nichts mit dem Axel Springer Verlag zu tun, es handelt sich lediglich um zwei vollkommen unterschiedliche Menschen mit identischen Nachnamen.
27 (Siehe dazu auch im Anhang ab Seite xlii Tab.: 7.2, Tab.: 7-4 und Tab.: 7.6)
28 ('Springer 2006), /Springer: Zahlen und Fakten, Springer Verlag, 2006/
29 (MEDIA. 2009), /Springer Science+Business Media: We manage knowlegde, 2009/
30 Urheber des Bildes: S.6 (Grobis und SCHUSTER 2003), /Grobis, Schuster: IT- Organisationshandbueh, Springer Verlag, 2003/
31 (Siehe A bb.: 2.1 )
32 S.83 (Fisher 2002 )
33 Klu w er Aademi Publishers wurde v or der Üb ernahme des Springer V erlags v on Cin v en und Cando v er aufgek auft
34(Siehe dazu auch im Anhang ab Seite dii Tab.: 7.2, Tab.: 7-4 und Tab.: 7.6)
35 (Siehe Abb.: 2.2)
36 Urheb er des Bildes: S.6 (Springer 2006 )
37 (Siehe Abschnitt 1.2 “Allgegenwärtige Dynamik” ab Seite 4)
38 (Siehe dazu auch im Anhang ab Seite dii Tab.: 7.2, Tab.: 7.4 und Tab.: 7.6)
39 (Siehe dazu auch im Anhang auf Seite xlv Abschnitt C “Wichtige Konzepte zur Komplexitatsaer- minderung”)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des SAP PI Prototypen beim Springer Verlag?
Das Ziel ist die Modernisierung einer komplexen Schnittstellenlandschaft, um Datenkonsistenz zu verbessern, Fehlerbehandlung zu optimieren und die Abhängigkeiten zwischen Systemen zu reduzieren.
Warum sind „Hotspots“ in der Schnittstellenlandschaft gefährlich?
Hotspots sind fehleranfällige Übergabepunkte, an denen Datenübertragungen gefährdet sind. Eine hohe Verzahnung durch viele Trigger erhöht das Risiko von Systemausfällen.
Welche Rolle spielt der Enterprise Service Bus (ESB)?
Der ESB (hier SAP PI) fungiert als zentrale Kommunikationsplattform, die Nachrichten zwischen verschiedenen Anwendungen routet, transformiert und überwacht.
Was bedeutet SOA im Kontext dieser Arbeit?
SOA steht für Service Oriented Architecture. Es ist ein Konzept, bei dem IT-Dienste modular bereitgestellt werden, um Flexibilität zu erhöhen und die Komplexität gewachsener Systeme zu beherrschen.
Wie wird die Fehlerbehandlung im neuen System verbessert?
Durch die Nutzung der Business Process Engine (BPE) und strukturierte Integrationsprozesse können Fehler zentral überwacht und Schnittstellen nach einem Abbruch kontrolliert wieder angestartet werden.
- Quote paper
- Bachelor Thomas Schmidt (Author), 2009, Entwicklung eines SOA orientierten Prototypen für eine komplexe Schnittstellenlandschaft im Verlagsumfeld mittels der SAP PI, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138939