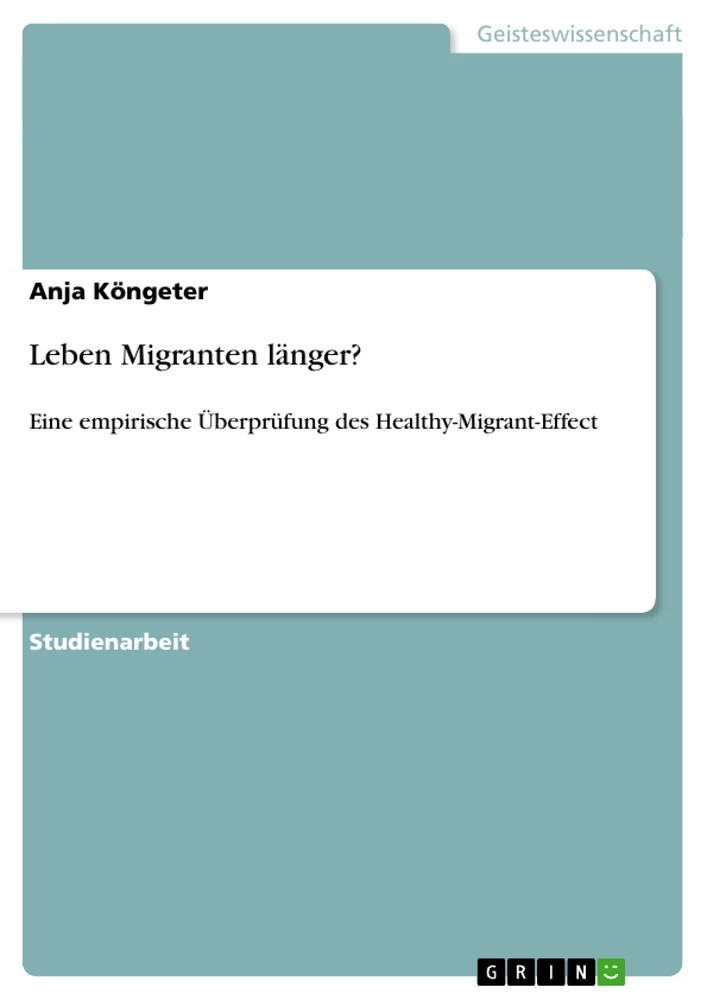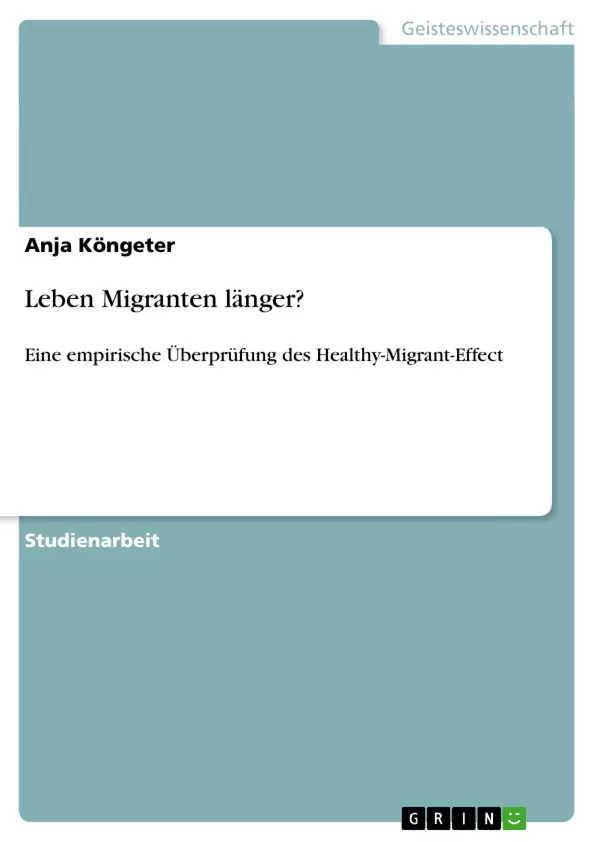Deutschland ist ein Zuwanderungsland – dies stellte die unabhängige Kommission „Zuwanderung“ der Bundesregierung 2001 fest. Die jahrzehntelange Migrationsgeschichte Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg begann mit den Vertriebenen der 1940er Jahre, worauf die so genannten „Gastarbeiter“ der 1960er Jahre, die Familiennachzüge der 1970er Jahre und die Einwanderungswellen der Kriegsflüchtlinge der 1990er Jahre folgten (Klein, 2005: 112). Menschen mit Migrationshintergrund, d.h. alle seit 1949 Zugewanderten und in Deutschland geborenen Zuwandererkinder, die sowohl eine ausländische als auch deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, stellen mittlerweile fast ein Fünftel der Bevölkerung (vgl. Razum, 2006: 255). Deshalb ist die Berücksichtigung dieser Bevölkerungsgruppe hinsichtlich der Demografieforschung, der damit zusammenhängenden Sozialstruktur und der daraus resultierenden Bedeutung für Sozial- und Gesundheitspolitik von hoher Relevanz.
So unterscheiden sich die Lebensumstände und die dadurch beeinflussten Mortalitätsraten von Migranten und Nicht-Migranten systematisch. Allerdings ist nicht eindeutig analysiert, ob Migranten eine höhere oder eine geringere Sterblichkeit aufweisen (Razum, 2008: 131).
So deklariert der Healthy-Migrant-Effect trotz sozioökonomischer Benachteiligung dieser Gruppe (vgl. Eichler, 2008: 18) eine geringere Mortalität der Migranten. Diese kontraintuitive Beobachtung wurde in deutschen Analysen vielfach bestätigt. Die Ergebnisse beruhen allerdings zumindest in Deutschland teilweise auf Datenartefakten der statistischen Erhebungen, die es näher zu untersuchen gilt.
In dieser Arbeit soll anhand bereits veröffentlichter empirischer Studien analysiert werden, inwiefern der Healthy-Migrant-Effect die Mortalität beeinflusst und ob dieser auch nach Betrachtung verschiedener Datengrundlagen bestätigt werden kann. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die amtliche Statistik, das Ausländerzentralregister (AZR) sowie die Daten der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) (Kohls, 2008b: 25).
Die vorliegende Arbeit beschreibt in Kapitel 2.1 die theoretischen Ansätze. Darin soll zunächst der Healthy-Migrant-Effect näher erläutert werden. Im Gegenzug stellt der darauffolgende Abschnitt die Einflüsse vor, die eine höhere Mortalität von Migranten bewirken. Auf Grundlage dieser theoretischen Vorüberlegungen werden in Kapitel 2.2 die Ergebnisse empirischer Studien analysiert.
Gliederung
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Theoriebildung
2.1.1 Der Healthy-Migrant-Effect
2.1.2 Gegeneffekte – Mortalitätserhöhende Einflüsse auf Migranten
2.2 Ergebnisse empirischer Überprüfung des Healthy-Migrant-Effect
2.2.1 Verwendete Datensätze
2.2.2 Ergebnisse
2.2.2.1 Mortalität von Migranten auf Datengrundlage der amtlichen Statistik
2.2.2.2 Mortalität von Migranten auf Datengrundlage des Ausländerzentralregisters (AZR)
2.2.2.3 Mortalität von Migranten auf Datengrundlage der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV)
3 Fazit
1 Einleitung
Deutschland ist ein Zuwanderungsland – dies stellte die unabhängige Kommission „Zuwanderung“ der Bundesregierung 2001 fest. Die jahrzehntelange Migrationsgeschichte Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg begann mit den Vertriebenen der 1940er Jahre, worauf die so genannten „Gastarbeiter“ der 1960er Jahre, die Familiennachzüge der 1970er Jahre und die Einwanderungswellen der Kriegsflüchtlinge der 1990er Jahre folgten (Klein, 2005: 112). Menschen mit Migrationshintergrund, d.h. alle seit 1949 Zugewanderten und in Deutschland geborenen Zuwandererkinder, die sowohl eine ausländische als auch deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, stellen mittlerweile fast ein Fünftel der Bevölkerung (vgl. Razum, 2006: 255). Deshalb ist die Berücksichtigung dieser Bevölkerungsgruppe hinsichtlich der Demografieforschung, der damit zusammenhängenden Sozialstruktur und der daraus resultierenden Bedeutung für Sozial- und Gesundheitspolitik von hoher Relevanz.
So unterscheiden sich die Lebensumstände und die dadurch beeinflussten Mortalitätsraten von Migranten und Nicht-Migranten systematisch. Allerdings ist nicht eindeutig analysiert, ob Migranten eine höhere oder eine geringere Sterblichkeit aufweisen (Razum, 2008: 131). So deklariert der Healthy-Migrant-Effect trotz sozioökonomischer Benachteiligung dieser Gruppe (vgl. Eichler, 2008: 18) eine geringere Mortalität der Migranten. Diese kontraintuitive Beobachtung wurde in deutschen Analysen vielfach bestätigt. Die Ergebnisse beruhen allerdings zumindest in Deutschland teilweise auf Datenartefakten der statistischen Erhebungen, die es näher zu untersichen gilt.
In dieser Arbeit soll anhand bereits veröffentlichter empirischer Studien analysiert werden, inwiefern der Healthy-Migrant-Effect die Mortalität beeinflusst und ob dieser auch nach Betrachtung verschiedener Datengrundlagen bestätigt werden kann. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die amtliche Statistik, das Ausländerzentralregister (AZR) sowie die Daten der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) (Kohls, 2008b: 25).
Die vorliegende Arbeit beschreibt in Kapitel 2.1 die theoretischen Ansätze. Darin soll zunächst der Healthy-Migrant-Effect näher erläutert werden. Im Gegenzug stellt der darauffolgende Abschnitt die Einflüsse vor, die eine höhere Mortalität von Migranten bewirken. Auf Grundlage dieser theoretischen Vorüberlegungen werden in Kapitel 2.2 die Ergebnisse empirischer Studien analysiert. Nach der Erläuterung der Datenproblematik und der Vorstellung der drei Datengrundlagen werden die Effekte des Healthy-Migrant-Effect anhand der amtlichen Statistik, des AZR sowie der GVR überprüft. Im Mittelpunkt der empirischen Analyse stehen die Working Paper des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
2 Hauptteil
2.1 Theoriebildung
2.1.1 Der Healthy-Migrant-Effect
Viele Studien bestätigen den Healthy-Migrant-Effect, der eine geringere Sterblichkeit von Migranten postuliert. So beruht die höhere Lebenserwartung der ausländischer Bevölkerung auf gesundheitsabhängiger Migration (Klein 2005). Vor allem körperlich und psychisch stabile Individuen nehmen die Belastungen einer Migration auf sich. Diese These trifft stärker auf Arbeitsmigranten zu, die – wie bei den „Gastarbeitern“ in Deutschland – sogar vor ihrer Ankunft medizinisch untersucht wurden. Weniger stark ist dieser Effekt bei Vertriebenen und Flüchtlingen, da hier nicht unbedingt eine positive Selektion stattfindet. Im Fall Deutschlands sind hier die Flüchtlinge des Jugoslawienkriegs der 1990er Jahre zu nennen (Kohls, 2008a: 19).
Der Healthy-Migrant-Effect sagt nur für die erste Einwanderergeneration einen besseren Gesundheitsstatus voraus. Die Nachfolgegenerationen würden demnach nicht mehr von diesem Effekt profitieren.
Außerdem soll der Salmon-Bias-Effect erwähnt werden, der eine Remigration der weniger gesunden Migranten und eine damit einhergehende geringere Mortalität der im Zielland bleibenden Migranten postuliert (Kohls, 2008: 21).
Der an den Healthy-Migrant-Effect anknüpfende, rationale handlungstheoretische Ansatz der Wert-Erwartungs-Theorie besagt außerdem, dass eine Migration umso wahrscheinlicher wird, desto höher der Nutzen und geringer die Kosten sind (Eichler 2008: 94 und Kley, 2009: 35f., 240). Dies bedeutet hinsichtlich der behandelten Fragestellung einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und der geografischen bzw. kulturelle Differenz des Herkunfts- und des Ziellandes. Der Nutzen, beispielsweise die Verbesserung des Lebensstandards, muss die Kosten übersteigen, damit eine Migration stattfindet. Kosten sind unter anderem geografisch bzw. kulturelle Distanz und die körperlichen Belastungen, die auf sich genommen werden. Demnach migrieren aus geografisch und kulturell weit entfernten Ländern eher Menschen, die eine gute körperliche Verfassung aufweisen und auf diese Weise weniger Kosten ausgleichen müssen. Je weiter entfernt das Herkunftsland vom Zielland ist, desto stärker wirkt der Healthy-Migrant-Effect.
2.1.2 Gegeneffekte – Mortalitätserhöhende Einflüsse auf Migranten
In diesem Abschnitt sollen dem Healthy-Migrant-Effect entgegenwirkende Effekte, die eine höhere Sterblichkeit von Migranten hervorrufen, zusammengefasst werden.
In Anbetracht zahlreicher epidemiologischer Studien erhöht die sozioökonomische Benachteiligung, von der Migranten überdurchschnittlich stark betroffen sind (vgl. Eichler, 2008: 18, Hradil, 2001: 342f.), Morbidität und Mortalität dieser Bevölkerungsgruppe (vgl. Mielck, 2005: 15ff.). Der durch geringen Bildungsgrad und unterdurchschnittliche ökonomische Lage bedingte niedrige Sozialstatus bildet den Ausgangspunkt für weitere gesundheitsrelevante Faktoren. Die materiellen Lebensbedingungen werden maßgeblich durch das Einkommen bestimmt. Ein niedriges Einkommen zwingt Migranten zum Konsum inferiorer Güter[1], denen eine geringe gesundheitliche Qualität nachgesagt wird. Außerdem beeinflusst das Einkommen die Wohnbedingungen. Migranten wohnen im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung in schlechter ausgestatteten, kleineren Wohnungen, die in den unattraktivsten Stadtvierteln liegen (Häussermann 2004: 175f.). Diese Wohnungen weisen außerdem höhere Luftverschmutzung und Lärmbelastung auf (vgl. Mielck, 2005: 69). Migranten erfuhren außerdem in ihren Herkunftsländern meist noch stärkere Umweltbelastungen als in Deutschland, wodurch sich die Mortalität im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung zusätzlich erhöht.
Auch schlechtere hygienische Verhältnisse durch Belastung im Heimatland und schlechte Wohnbedingungen verringern den Gesundheitsstatus, welche Infektionen und Magen- sowie Darmkrebs auslösen können (Mielck, 2005: 31).
Der sozioökonomische Status hat ebenfalls Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen. In den unteren Einkommensklassen werden überdurchschnittlich viele körperlich schwere Tätigkeiten ausgebübt. Vor allem die angeworbenen „Gastarbeiter“ leisteten „gefahrenträchtige, gesundheitsbelastende und schmutzige Arbeit“ (Hradil 2001: 345), die oft als Schichtarbeit durchgeführt wurde.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens. Oft nehmen Migranten aufgrund von Schamgefühl und kultureller Einstellungen Leistungen des Gesundheitswesens nicht wahr. Teilweise vertrauen die Migranten dem „fremden“ Gesundheitssystem nicht oder aber es herrscht ein Informationsdefizit, das vor allem eine Nicht-Inanspruchnahme präventiver Angebote zur Folge hat. Über das teilweise unzureichnde Sprachverständnis hinaus ist die „mangelhafte interkulturelle Kompetenz“ des Fachpersonals ein Grund für die geringe Einbindung der Migranten in das Gesundheitssystem (Eichler, 200: 21ff.). Aber auch migrationsspezifische Aspekte können die Lebenserwartung einschränken. Demnach führt der migrationsbedingte Stress (Trennung von Familie, Heimweh, Entfremdung, Unsicherheit über Erwartungserfüllung und Fremdenfeindlichkeit) zu bestimmten psychosomatischen Krankheitsbildern. „Akkulturationsstress“ aufgrund der veränderter Lebensumstände, Sprache und Kultur beeinflussen ebenfalls den Gesundheitszustand und damit die Mortalität der betroffenen Migranten (Zoll 1997: 106). Durch die Migration verringern sich außerdem die Bewältigungsressourcen der Einwanderer. Da die Wohnorte der Migranten meist in segregierten Wohngegenden mit überdurchschnittlich hohem Ausländeranteil liegen, werden vor allem soziale Kontakte zu sozioökonomisch ähnlich gestellten Migranten aufgebaut. So sinkt die Leistungsfähigkeit der sozialen Netzwerke. Hieraus ergeben sich mangelhafte soziale Ressourcen, die weniger emotionale, instrumentelle und informationelle Unterstützung bieten. Aufgrund der fehlenden positiven Wirkungen unterstützender Netzwerke erhöht sich die Mortalität der Migranten. Außerdem wird die Einbindung in das Erwerbs- und Bildungssystem ohne soziale Netzwerke erschwert (Hurrelmann 2000: 81ff.).
Dennoch wird von einer Adaption des im Einwanderungsland vorgelebten Lebensstils ausgegangen, welcher sich vor allem im Risikoverhalten der Migranten äußert. So können beispielsweise eine ungesunde Ernährung und ein höherer Alkoholkonsum zu den adaptierten Risikofaktoren gehören, die sich negativ auf die Lebenserwartung auswirken.
Die in diesem Abschnitt zusammengefassten Effekte proklamieren eine höhere Mortalität der eingewanderten Bevölkerung. Gelten ebenfalls die Annahmen des Healthy-Migrant-Effect, kann von aneinander angleichenden Lebenserwartungen ausgegangen werden. Durch den Aufenthalt in Deutschland würde die Mortalität kontinuierlich erhöht. Die Folgegenerationen besäße demnach bei gleichem Sozialstatus und ohne Betrachtung genetischer Effekte eine deutlich höhere Sterblichkeit als die erste Einwanderergeneration, da nur noch die dem Healthy-Migrant-Effect entgegen gesetzten Einflüsse wirken würden.
2.2 Ergebnisse empirischer Überprüfung des Healthy-Migrant-Effect
Das in vielen Studien nachgewiesene „Paradox“ der geringeren Mortalität sozioökonomisch benachteiligter Migranten bedarf einer kritischen Betrachtung der Datengrundlage und einer genaueren Untersuchung.
Auf Grundlage der in Kapitel 2.1 vorgestellten Hypothesen sollen nun die empirischen Ergebnisse analysiert werden. Im Zentrum der Analyse steht die Identifizierung von Datenartefakten, die eine starke Verzerrung der Ergebnisse hervorrufen können. Um die Datenartefakte zu kontrollieren, stehen die Datensätze der amtlichen Statistik, des Ausländerzentralregisters (AZR) und der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zur Verfügung.
[...]
[1] Güter sind inferior, wenn sie bei steigendem Einkommen weniger nachgefragt werden. Es handelt sich meist um günstige Produkte, die bei steigendem Einkommen durch hochwertigere Güter ersetzt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Healthy-Migrant-Effect“?
Die Beobachtung, dass Migranten trotz sozioökonomischer Nachteile oft eine geringere Sterblichkeit aufweisen, da primär gesunde Menschen migrieren.
Was besagt der „Salmon-Bias-Effect“?
Er postuliert eine Remigration kranker Migranten in ihre Heimatländer, wodurch die im Zielland verbleibende Gruppe statistisch gesünder erscheint.
Welche Faktoren erhöhen die Mortalität von Migranten?
Dazu gehören sozioökonomische Benachteiligung, schlechtere Arbeitsbedingungen, Sprachbarrieren im Gesundheitswesen und Akkulturationsstress.
Welche Datensätze werden zur Analyse der Sterblichkeit genutzt?
Die amtliche Statistik, das Ausländerzentralregister (AZR) und die Daten der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV).
Gilt der Healthy-Migrant-Effect für alle Generationen?
In der Regel wird der Effekt vor allem für die erste Einwanderergeneration beobachtet; Nachfolgegenerationen gleichen sich dem Gesundheitsstatus der Mehrheitsbevölkerung an.
- Arbeit zitieren
- Anja Köngeter (Autor:in), 2009, Leben Migranten länger? , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138967