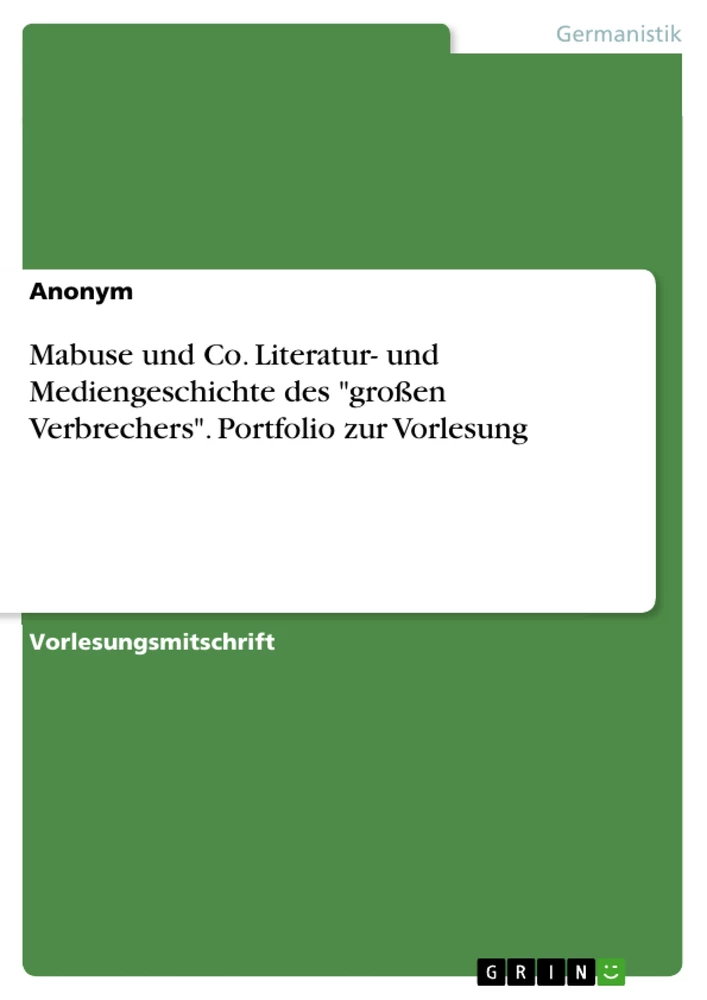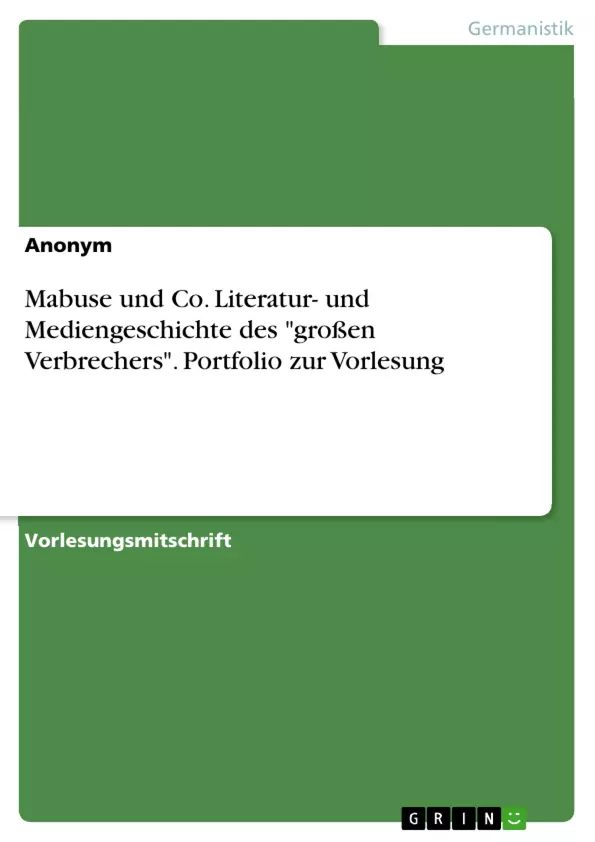Die Figuration des Verbrechers in der Literatur lässt sich in vier verschiedene Schwerpunkte unterteilen: Die Figur des geborenen Verbrechers, die Korrelation von Verbrecher und Genie, das Phantasma des Verbrechers als Spinne im Netz/Strippenzieher und der Verbrecher als krimineller Doppelgänger (Unheimlicher personaler Doppelgänger von Verbrecher und Nicht-Verbrecher oder Figur des Verbrechers als Doppelgänger des großen Detektivs). All diese Charaktertypen werden im Portfolio anhand verschiedener Literaturbeispiele dargestellt und ausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Vier Figurationen des Verbrechers
- Zu: Eine kleine Geschichte des Verbrechers: Vom Outsider zum Mastermind
- Eigene Gedanken
- Zu: Outsider
- Eigene Gedanken
- Vorlesung 2
- Eigene Gedanken
- Zu: Vorstellung des „geborenen Verbrechers“
- Eigene Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesung „Mabuse und Co. Literatur- und Mediengeschichte des „großen Verbrechers“ befasst sich mit der Figur des Verbrechers in der Literatur und den Medien. Sie analysiert die Entwicklung der Verbrecherfigur in verschiedenen Epochen und untersucht die unterschiedlichen Konzepte des Verbrechens.
- Die verschiedenen Figurationen des Verbrechers
- Die Rolle des Verbrechers in der Gesellschaft
- Die Beziehung zwischen Verbrecher und Genie
- Die Darstellung des Verbrechers in Literatur und Medien
- Die Frage nach der Entstehung des Verbrechens
Zusammenfassung der Kapitel
Vier Figurationen des Verbrechers
Dieses Kapitel stellt vier unterschiedliche Schwerpunkte der Verbrecherfigur vor: den geborenen Verbrecher, die Verbindung zwischen Verbrecher und Genie, das Phantasma des Verbrechers als Spinne im Netz bzw. Strippenzieher und den Verbrecher als kriminellen Doppelgänger.
Zu: Eine kleine Geschichte des Verbrechers: Vom Outsider zum Mastermind
Die Trennung vom Bösen/Missetäter in Bezug auf die göttliche Ordnung und dem Verbrecher in Bezug auf weltliche Gesetze im 18. Jahrhundert wird hier beleuchtet. Der Verbrecher ist nicht mehr „Repräsentant des Bösen“, sondern steht am Rande der Gesellschaft. Der Mastermind hingegen befindet sich in Grauzonen und strebt nach der Überstülpung eigener Gesetzmäßigkeiten über die Gesellschaft, während kleinere Verbrecher die gesellschaftliche Ordnung eher hintergehen oder egoistisch ausnutzen.
Zu: Outsider
Die intrinsische Rationalität der Verbrecherperspektive wird hier behandelt. Die Tat bietet die Möglichkeit zur Buße und zum Lebenswandel. Der Autor diskutiert Schillers Protagonisten Christian Wolf und dessen Außenseitertum, das durch Konfliktzonen (bürgerliche Existenz vs. fehlender Vater, Verstand vs. Hässlichkeit) geprägt ist. Die Ambiguität des Grenzgängertums erscheint als Grundlage für das Risiko, zum Verbrecher zu werden.
Zu: Vorstellung des „geborenen Verbrechers“
Die Imagination des „geborenen Verbrechers“ wird in der Kriminologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Frage gestellt. Es wird argumentiert, dass Verbrecher durch Lebensumstände und Umfeld geformt werden. Die These von der Verbrecherphysiognomie ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts widerlegt.
Vorlesung 2
Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur des kriminellen Masterminds, die vornehmlich in Comics und Filmen vorkommt. Der Master of Crime ist kein Resultat einer aus der Bahn geratenen Biografie, sondern ein bewusst eingeschlagener Weg gegen den Strom. Er ist der Gegenentwurf zu einer wichtigen, machtvollen Position im gesellschaftlichen System.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Vorlesung sind: Verbrecher, Mastermind, Outsider, Kriminologie, Literatur, Medien, Gesellschaft, Genie, Doppelgänger, Ambiguität, Physiognomie, Kriminalantrophologie, Homo Delinquenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche vier Typen von Verbrechern gibt es in der Literatur?
Die Arbeit unterscheidet den geborenen Verbrecher, das kriminelle Genie, den Strippenzieher ("Spinne im Netz") und den kriminellen Doppelgänger.
Was kennzeichnet ein "kriminelles Genie" oder Mastermind?
Ein Mastermind ist ein hochintelligenter Täter, der das Verbrechen als bewusst gewählten Weg gegen die gesellschaftliche Ordnung nutzt.
Was ist die Theorie des "geborenen Verbrechers"?
Eine historische Vorstellung aus der Kriminalanthropologie, die besagt, dass Kriminalität an physischen Merkmalen (Physiognomie) erkennbar sei.
Wer ist Dr. Mabuse?
Mabuse ist eine literarische und filmische Figur, die den Typus des kriminellen Superhirns und Manipulators perfekt verkörpert.
Was versteht man unter dem "Outsider" in der Verbrecherliteratur?
Figuren wie Schillers Christian Wolf, die durch unglückliche Lebensumstände an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und so zum Verbrecher werden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Mabuse und Co. Literatur- und Mediengeschichte des "großen Verbrechers". Portfolio zur Vorlesung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1391370