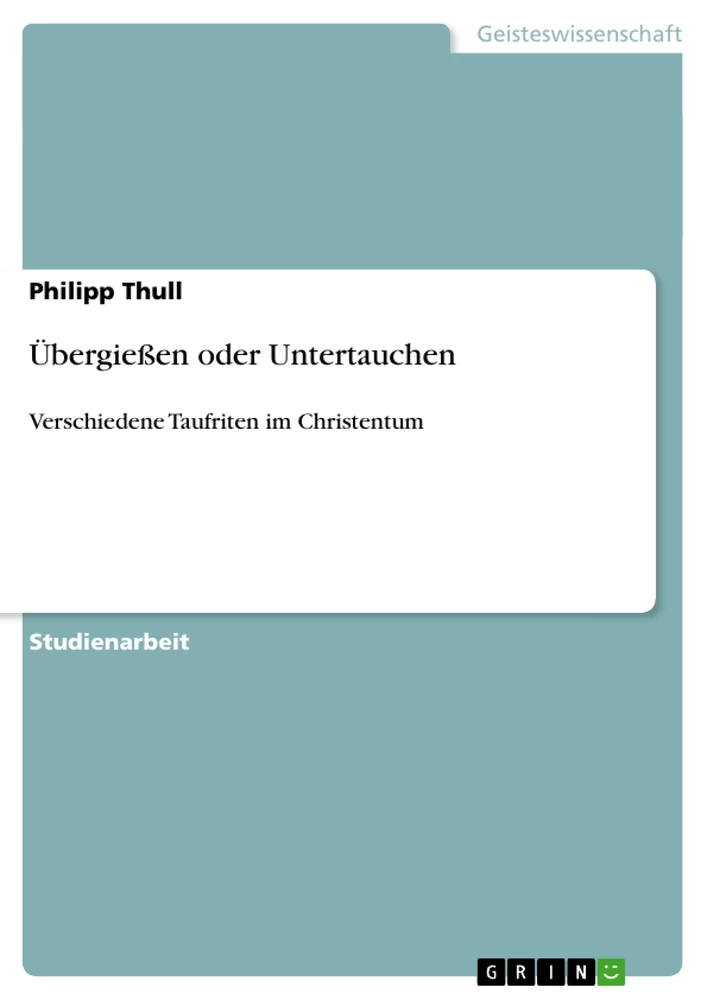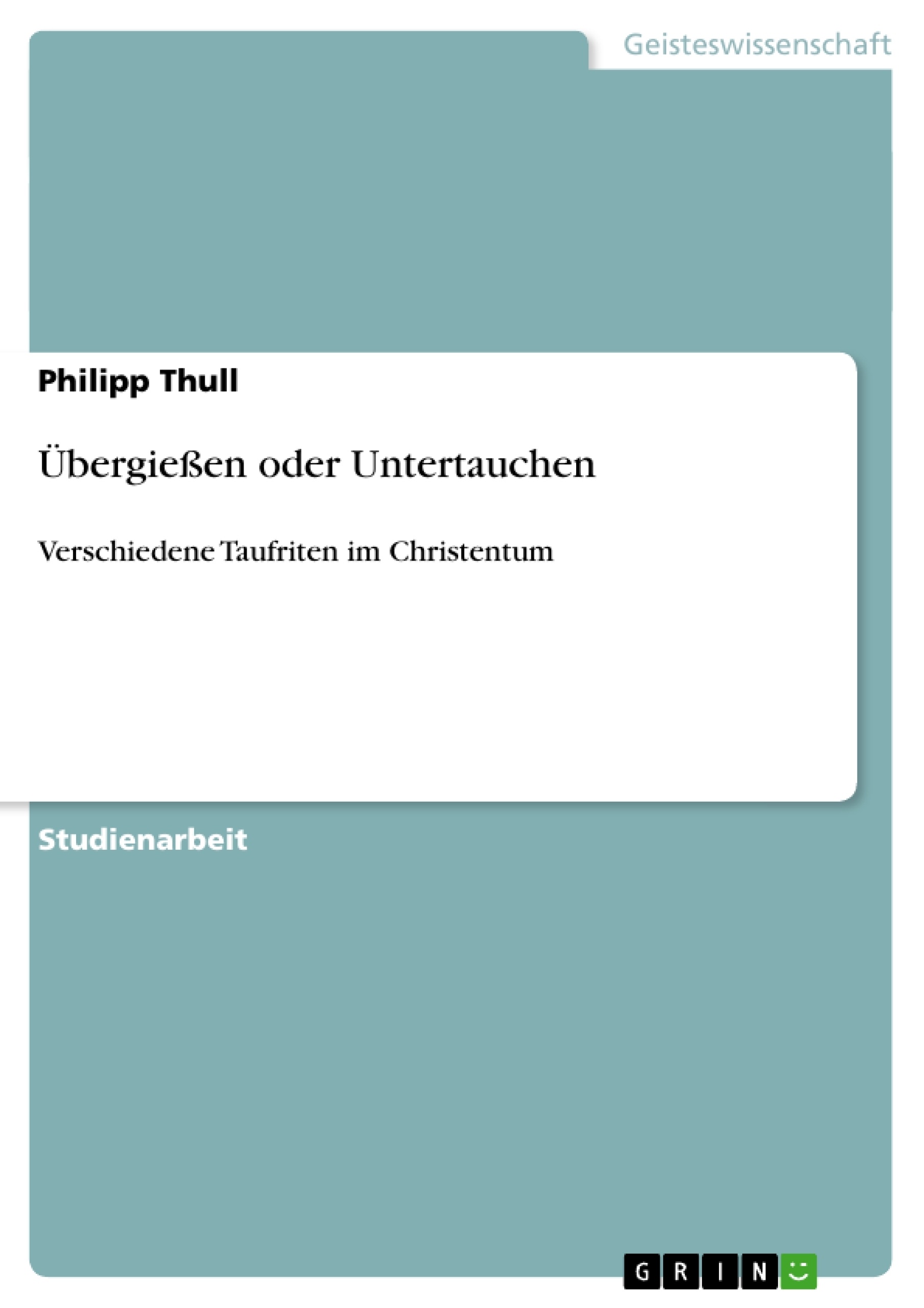„Darum geht zu allen Völkern, und macht sie zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ (Mt 28,19-20) So lautet der Sendungsbefehl des Auferstandenen Christus am Ende des Matthäus-Evangeliums an seine Jünger, durch den er ihnen aufträgt die eigenen Grenzen zu überschreiten, hinzugehen zu allen Völkern und die Menschen durch die Taufe Gott anzuvertrauen, um sie so zu „Mitbürgern der Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (Eph 2,19) zu machen. Indem die Jünger sich aufmachten in fremde Kultur- und Sprachkreise gelang es ihnen schnell, viele Menschen durch ihr Zeugnis vom Evangelium zu überzeugen und sie durch die Taufe zu einer großen Gemeinschaft der Glaubenden zusammenzufügen. Damals wie heute ist die Taufe der entscheidende Akt, durch den Menschen, die dem Christentum begegnen, in den „einen einzigen Leib aufgenommen“ (1 Kor 12,12) werden. Da die Geschichte des Christentums aber auch eine Geschichte der Spaltungen ist, lässt sich zwar von dem Bekenntnis zur „einen“ Taufe sprechen, kennen die einzelnen Konfessionen aber auch eine jeweils eigene Praxis und ein eigenes Verständnis der Initiation. Dennoch wird die Taufe heute von den meisten Kirchen und christlichen Gemeinschaften als „Sakrament der Einheit“ gesehen und in Deutschland auch als Ausdruck ökumenischer Verbundenheit. Bei einem gemeinsamen Treffen am 29. April 2007 im Magdeburger Dom, einigten sich elf Kirchen bzw. kirchliche Gemeinschaften auf die Unterzeichnung einer Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe. Hierin heißt es: „Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens im Wasser bzw. des Übergießens mit Wasser vollzogene Taufe an und freuen uns über jeden Menschen der getauft wird. Diese wechselseitige Anerkennung der Taufe ist Ausdruck des in Jesus Christus gründenden Bundes der Einheit (Eph 4,4-6). Die so vollzogene Taufe ist einmalig und unwiederholbar.“
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1.0 Die Taufe in der orthodoxen Kirche
1.1 Verständnis der Taufe
1.2 Die Praxis der Taufe
1.3 Abschluss der Taufe und Teilnahme am österlichen Mahl
2.0 Die Taufe in der koptischen Kirche
2.1 Bedeutung der Initiation
2.2 Die Taufhandlung in der koptischen Kirche
3.0 Die Taufe im Protestantismus
3.1.Die Taufe in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
3.1.1 Auffassung der Taufe bei Martin Luther
3.1.2 Taufliturgie in der Evangelisch-Lutherischen Kirche
3.2.Die Taufe in den Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden (Baptisten)
3.2.1 Taufauffassung der Baptisten
3.2.2 Die Praxis der Taufe
3.2.3 Die Ablehnung der Kindertaufe
4.0 Ergebnis
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
„Darum geht zu allen Völkern, und macht sie zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ (Mt 28,19-20) So lautet der Sendungsauftrag des Auferstandenen Christus am Ende des Matthäus-Evangeliums an seine Jünger, durch den er ihnen aufträgt die eigenen Grenzen zu überschreiten, hinzugehen zu allen Völkern und die Menschen durch die Taufe Gott anzuvertrauen, um sie so zu „Mitbürgern der Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (Eph 2,19) zu machen. Indem die Jünger sich aufmachten in fremde Kultur- und Sprachkreise gelang es ihnen schnell, viele Menschen durch ihr Zeugnis vom Evangelium zu überzeugen und sie durch die Taufe zu einer großen Gemeinschaft der Glaubenden zusammenzufügen. Damals wie heute ist die Taufe der entscheidende Akt, durch den Menschen, die dem Christentum begegnen, in den „einen einzigen Leib aufgenommen“ (1 Kor 12,12) werden. Da die Geschichte des Christentums aber auch eine Geschichte der Spaltungen ist, lässt sich zwar von dem Bekenntnis zur „einen“ Taufe sprechen, kennen die einzelnen Konfessionen aber auch eine jeweils eigene Praxis und ein eigenes Verständnis der Initiation. Dennoch wird die Taufe heute von den meisten Kirchen und christlichen Gemeinschaften als „Sakrament der Einheit“[1] gesehen und in Deutschland auch als Ausdruck ökumenischer Verbundenheit. Bei einem gemeinsamen Treffen am 29. April 2007 im Magdeburger Dom, einigten sich elf Kirchen bzw. kirchliche Gemeinschaften auf die Unterzeichnung einer Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe. Hierin heißt es: „Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens im Wasser bzw. des Übergießens mit Wasser vollzogene Taufe an und freuen uns über jeden Menschen der getauft wird. Diese wechselseitige Anerkennung der Taufe ist Ausdruck des in Jesus Christus gründenden Bundes der Einheit (Eph 4,4-6). Die so vollzogene Taufe ist einmalig und unwiederholbar.“[2]
Die folgende Betrachtung unterliegt der Überschrift „Untertauchen oder Übergießen“ und soll die Praxis und das Verständnis der Taufe einzelner Konfessionen darstellen. Für alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ist die Taufe der entscheidende Zugang in die christliche Gemeinschaft und das Prägemahl wahrhaft christlichen Lebens. Durch alle Zeit hindurch kam es aber immer wieder zu unterschiedlichen Glaubensauffassungen, die auch Einfluss auf Praxis und Verständnis der Taufe in den jeweiligen Kirchen bzw. kirchlichen Gemeinschaften hatten.
Da es hier vieler Seiten mehr bedürfte um das Verständnis und die Praxis der Taufe in den einzelnen Kirchen darzustellen, sollen nur einige wenige Konfessionen in den Blick genommen werden. Neben der orthodoxen Kirche, werden die koptische Kirche, die evangelischen Kirchen, sowie als Beispiel für die freikirchlichen Gemeinschaften, die Baptisten, Gegenstand dieser unserer Betrachtung sein.
1. 0 Die Taufe in der orthodoxen Kirche
1.1 Verständnis der Taufe
Die Tauflehre der orthodoxen Kirchen, die sich auf die in der Taufe enthaltene Gabe und Wirkung bezieht, unterscheidet sich in ihrem Wesen nur in geringem Maße von jener, welche die römisch-katholische Kirche zu glauben vorgibt. Hervorzuheben in der orthodoxen Taufliturgie ist jedoch der besondere Blick auf den „Mysteriencharakter“, der die Taufe als sog. „Mysterion“ auszeichnet und sich jedem Zugriff nüchterner Verständlichkeit bzw. kognitiver Zustimmung zu entziehen vermag. Wahrnehmbar ist die Taufe nach orthodoxem Verständnis lediglich in ihrem Vollzug, bei dem der Täufling unter Nennung der trinitarischen Formel dreimal unter Wasser getaucht wird.[3] Durch dieses Sakrament geschieht es, dass der Neugetaufte „dem fleischgewordenen, sündhaften Leben abstirbt und vom Heiligen Geist wiedergeboren wird zum geistlichen, heiligen Leben.“[4] Dieses Ereignis entspricht nicht nur der Präsenz der Trinität, sondern bewirkt sie und ist sie. Die Handlung des Taufgeschehens wirkt gleich den Gravitationsgesetzen der Natur, also notwendigerweise, selbst dann, wenn der Täufling ohne oder mittels falschen Glaubens das Sakrament der Initiation empfängt. Hinzu kommt, dass die Taufe nur durch die Handlung des dreimaligen Untertauchens, nicht durch Besprengen oder das in anderen Kirchen übliche Übergießen des Täuflings, an Gültigkeit gewinnt. Dennoch ist es gerade die orthodoxe Kirche, die sich gegen eine Wiedertaufe derer ausspricht, welche in anderen Konfessionen bereits dieses Sakrament der Initiation empfangen haben.[5] Hierzu heißt es: „Da die Taufe eine geistliche Geburt ist, der Mensch aber nur einmal geboren wird, kann dieses Sakrament nicht wiederholt werden.“[6] Im Geschehen selbst ist es Gott, der handelt und tauft, während der Priester in den Hintergrund rückt.[7]
Neben der Erwachsenentaufe, die nach Zusammenbruch der kommunistischen Strukturen in Osteuropa zunahm, ist die Taufe von Kleinkindern trotzdem, wie in den meisten Kirchen, die häufigere Form. Da die Taufe der Vorbereitung bedarf, geht sowohl der Erwachsenen- wie auch der Kindertaufe das sog. Katechumenat voraus, selbst wenn der Täufling erst einige Tage alt ist.[8] Der Pate bzw. die Gemeinde übernimmt hierbei die Stellvertretung für das neue Glied der Kirche[9], die mit dazu beitragen, dass diesem das Verständnis der Taufe ermöglicht wird, welches nicht Voraussetzung der Taufe, sondern vielmehr deren „Frucht und Folge“ darstellt.[10] Durch die Taufe wird der Neugetaufte von Gott als dessen Kind angenommen und damit ,zugleich in den Leib Christi, die Kirche, eingegliedert und so dem Wirken des Heiligen Geistes anbefohlen.’ Damit stellt sie einen Zugang zum Heil dar, welches dem Menschen durch Jesus Christus mitgeteilt wurde und wird, und schließt die Sündenvergebung, mehr noch die Entrückung aus der in Sünde und Tod verstrickten ,Welt’ dar.[11]
1.2 Die Praxis der Taufe
Die Taufe in der orthodoxen Kirche gliedert sich in solche Riten, welche vor der Spendung dieses Sakramentes, also „präbaptismal“ vollzogen und solchen Riten, die im Anschluss, also „postbaptismal“ vollzogen werden.[12] Schon am Tag der Geburt spricht der Priester drei Gebete über die künftige Mutter des Kindes[13], der von Seiten der Kirche besondere Sorge gebührt. Durch die Gebete und die Mysterien wird die Mutter gestärkt, Würde, Ernst und Aufgabe der Mutterschaft gerecht zu werden.[14] Am achten Tag nach der Geburt wird das Kind vom Priester mit einem Kreuz auf der Stirn bezeichnet und beim Namen genannt, der „die eigene Persönlichkeit, für die Christi Kreuzesopfer gilt“ hervorhebt.[15] Unter dem Schutz des Kreuzes Christi und in der Gemeinschaft der Kirche soll das Kind „in allen Fährlichkeiten des Lebens teilhaben an den Gütern seines Reiches.“[16] Die Aufnahme des Kindes in die Kirche vollzieht sich sodann am vierzigsten Tag nach der Geburt bei der Aussegnungsfeier der Mutter, die an die Darstellung Jesu im Tempel erinnert (Lk 2,22). Erst jetzt folgt die Aufnahme des Täuflings in den Katechumenat, zu dem ein vierfacher Exorzismus gehört.[17]
[...]
[1] http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2008_05_06_1_orientierungshilfe_taufe.html
[2] http://www.ekd.de/ausland_oekumene/pm86_2007_wechselseitige_taufanerkennung.html
[3] Vgl. RATSCHOW, Carl Heinz, Die eine christliche Taufe, 63.
[4] DÖPMANN, Hans-Dieter, Die orthodoxen Kirchen, 219.
[5] Vgl. RATSCHOW, Carl Heinz, Die eine christliche Taufe, 63f.
[6] DÖPMANN, Hans-Dieter, Die orthodoxen Kirchen, 219.
[7] Vgl. RATSCHOW, Carl Heinz, Die eine christliche Taufe, 64.
[8] Vgl. BREY, Christoph, Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen, 143.
[9] Vgl. RATSCHOW, Carl Heinz, Die eine christliche Taufe, 65.
[10] Vgl. BREY, Christoph, Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen, 143.
[11] Vgl. RATSCHOW, Carl Heinz, Die eine christliche Taufe, 65.
[12] Vgl. BREY, Christoph, Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen, 143.
[13] Vgl. Ebd. 143.
[14] Vgl. VON RUDLOFF, Leo, Taufe und Firmung, 52.
[15] Vgl. BREY, Christoph, Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen, 144.
[16] VON RUDLOFF, Leo, Taufe und Firmung, 52.
[17] Vgl. BREY, Christoph, Gestaltung und Deutung der christlichen Initiation in den orthodoxen Kirchen, 144f.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Taufpraxis in der orthodoxen Kirche?
In der orthodoxen Kirche ist das dreimalige vollständige Untertauchen des Täuflings zwingend vorgeschrieben, um die Gültigkeit des Sakraments zu gewährleisten.
Erkennen sich die christlichen Kirchen gegenseitig in der Taufe an?
Ja, viele Kirchen unterzeichneten 2007 in Magdeburg eine Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung der Taufe, unabhängig davon, ob sie durch Übergießen oder Untertauchen vollzogen wurde.
Warum lehnen Baptisten die Kindertaufe ab?
Baptisten verstehen die Taufe als bewusste Entscheidung des Glaubenden, weshalb sie nur die Glaubenstaufe (Erwachsenentaufe) praktizieren.
Was bedeutet der Begriff „Mysterion“ in der orthodoxen Tradition?
Es betont den geheimnisvollen Charakter des Sakraments, das sich rein rationaler Erklärbarkeit entzieht und als direktes Handeln Gottes am Menschen verstanden wird.
Welche Rolle spielt das Wasser bei der Taufe?
Wasser symbolisiert sowohl Reinigung als auch das Sterben und Auferstehen mit Christus; die Form des Gebrauchs (Übergießen oder Untertauchen) variiert je nach Konfession.
- Arbeit zitieren
- Philipp Thull (Autor:in), 2008, Übergießen oder Untertauchen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139244