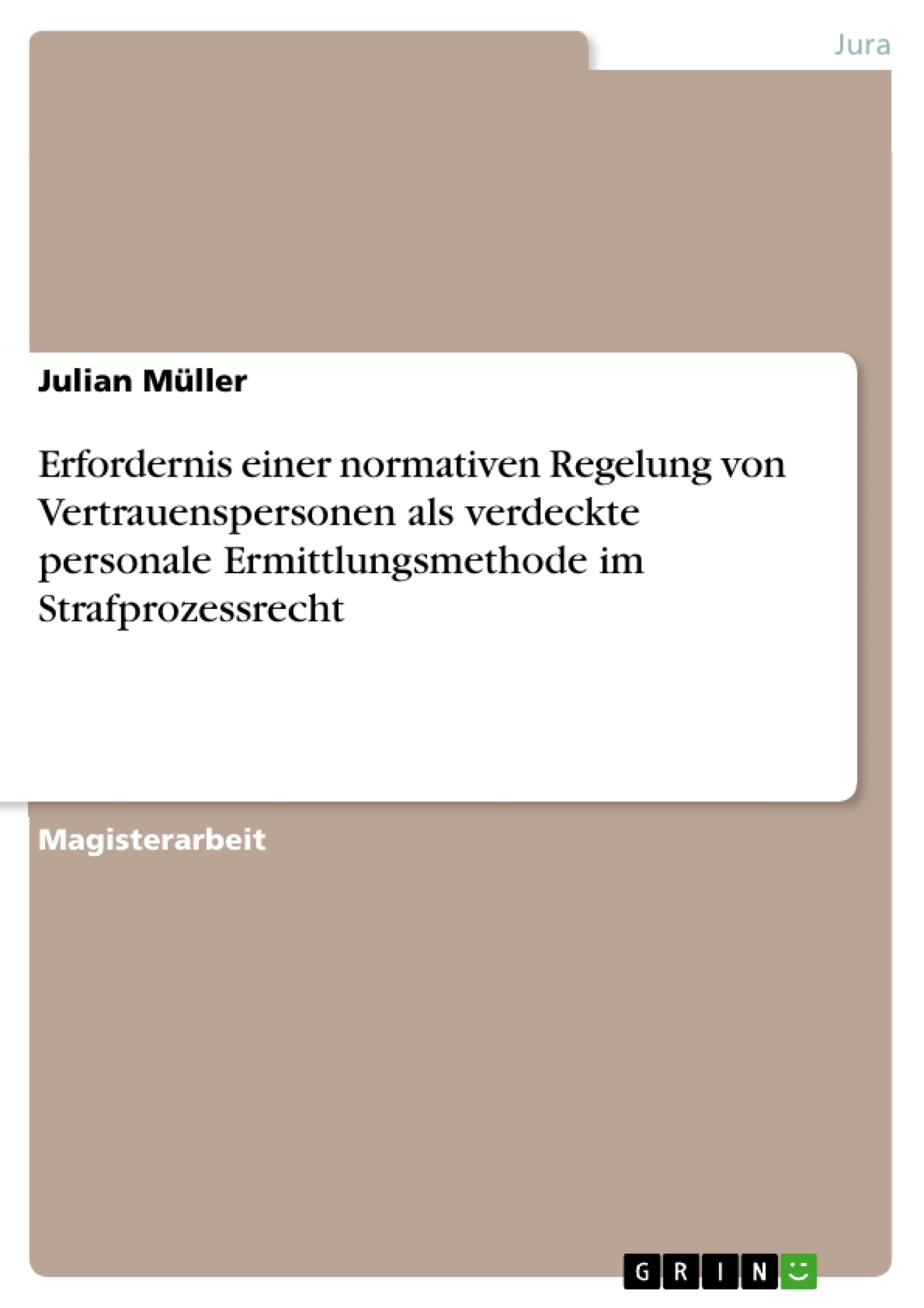Vertrauenspersonen (V-Personen) sind Privatpersonen, deren planmäßige und dauerhafte Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden oder den Nachrichtendiensten Dritten nicht bekannt ist. Ihr Einsatz ist aufgrund diverser Skandale und spezifischer Problematiken sowohl im politischen als auch zivilgesellschaftlichen Raum immer wieder Teil kontroverser Diskurse.
So existieren aktuell etwa Entschließungsanträge der FDP-Fraktion und der Fraktion Die Linke sowie eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zur konsequenteren Regelung des V-Personenwesens.
Die Polizeigesetze der Länder und des Bundes sowie die Gesetze über die Nachrichtendienste normieren unterschiedlich detaillierte Ermächtigungsgrundlagen für den Einsatz von V-Personen zu Zwecken der Gefahrenabwehr und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten. Anders stellt sich die Gesetzgebung im Bereich der Strafverfolgung dar, da das V-Personenwesen nicht explizit durch die Strafprozessordnung (StPO) kodifiziert wird. Stattdessen wird die Maßnahme auf die strafprozessualen Ermittlungsgeneralklauseln der §§ 161, 163 StPO i.V.m. Anlage D der RiStBV gestützt. Diese Rechtslage wird im Rahmen der Masterarbeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Im Verlauf des Forschungsprozesses wird dabei erläutert, wie V-Personen im Kontext vergleichbarer verdeckter personaler Ermittlungsmethoden einzuordnen sind, wie die verschiedenen Teilbereiche der einschlägigen Sicherheitsgesetzgebung (Gefahrenabwehrrecht, Recht der Nachrichtendienste, Strafprozessrecht) das V-Personenwesen regeln, wie dies zu bewerten ist und weshalb eine Harmonisierung der entsprechenden Sicherheitsgesetzgebung angemessen erscheint. Weiterhin wird der bestehende rechtspolitische Diskurs hinsichtlich einer Regelung ausgewertet und kontextualisiert. Im Ergebnis werden sowohl juristische als auch rechtspolitische Erfordernisse hinsichtlich einer Normierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht gesehen.
In Anbetracht der legislativen Erfordernisse soll final ein Gesetzesentwurf aufzeigen, wie eine Kodifizierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht ausgestaltet werden kann, um den rechtsstaatlichen Anforderungen zu genügen, ohne dabei den erheblichen Einsatzwert von V-Personen zu gefährden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Der Mensch als verdeckte Ermittlungsmethode bei Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten
- I. Vertrauenspersonen
- II. Verdeckte Ermittlerinnen und Verdeckte Ermittler
- III. Nicht offen ermittelnde Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
- IV. Informantinnen und Informanten, Augenblickshelferinnen und Augenblickshelfer sowie Gewährspersonen
- V. Counter-Men
- VI. Undercover-Agents
- C. Rechtliche Grundlagen des Einsatzes von Vertrauenspersonen
- I. Verfassungs- und völkerrechtliche Grundlagen
- II. Einfachgesetzliche Regelungen zum Einsatz von Vertrauenspersonen
- 1. Strafprozessrecht
- 2. Gefahrenabwehrrecht
- 3. Recht der Nachrichtendienste
- a. Verfassungsschutzbehörden
- aa. Aufgaben und Befugnisse
- bb. Einfügung des § 9b BVerfSchG
- cc. Sonderfall Verfassungsschutz Brandenburg
- b. Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst
- c. Bundesnachrichtendienst
- a. Verfassungsschutzbehörden
- III. Parallelität und Relevanz des Rechts der Nachrichtendienste und des Gefahrenabwehrrechts für das Strafprozessrecht
- D. Rechtskonformität der bestehenden Ermächtigungsgrundlagen für Vertrauenspersonen im Strafprozessrecht
- I. Schlaglichter der Jurisdiktion des Bundesgerichtshofes
- 1. Urteil vom 22.02.1995 („Keine analoge Anwendung der Regelungen zu Verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern für Vertrauenspersonen“)
- 2. Urteile vom 18.11.1999, vom 19.05.2015 und vom 07.12.2017 („Agent Provocateur“).
- 3. Entscheidungen vom 05.02.1993 und 07.06.2000 („Glaubwürdigkeit einer Vertrauensperson; Sperrerklärung“)
- 4. Relevanz der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Bezug auf die Regelungsbedürftigkeit von Vertrauenspersonen_
- II. Rechtspolitische Debatte und Standpunkte in Literatur und Praxis
- 1. Ablehnende Positionen gegenüber einer gesetzlichen Regelung
- 2. Zustimmende Positionen gegenüber einer normativen Regelung
- a. Öffentliche Anhörung vom 24.03.2021 im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages
- b. Beschlüsse der Expertenkommission des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie der 90. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 2019
- c. Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
- d. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Juristisches Schrifttum und Zivilgesellschaft
- 3. Synthese des Diskurses
- III. Die Dependenzrelation der strafprozessualen Ermittlungsgeneralklausel zum staatsrechtlichen Bestimmtheitsgebot
- 1. Staatsrechtliches Bestimmtheitsgebot als rechtsstaatlicher Orientierungspunkt
- 2. Reichweite und Grenzen der §§ 161, 163 StPO
- a. Eingriff in die Privatsphäre
- aa. Sphärentheorie
- bb. Sozialsphäre
- cc. Privatsphäre
- dd. Intimsphäre
- ee. Die Sphärentheorie als Nexus für die Eingriffsintensität von Vertrauenspersonen
- b. Dauerhaftigkeit
- a. Eingriff in die Privatsphäre
- 3. Eingriffstiefe normierter Ermittlungsmethoden als Bezugsrahmen
- IV. Die Relevanz der Anlage D der RiStBV
- a. Verwaltungsvorschrift versus Gesetz
- b. Wesentlichkeitstheorie
- V. Ergebnis zur Regelungsbedürftigkeit von Vertrauenspersonen im Strafprozessrecht
- I. Schlaglichter der Jurisdiktion des Bundesgerichtshofes
- E. Gesetzesentwurf
- F. Erläuterung zum Gesetzesentwurf
- G. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der rechtlichen Situation des Einsatzes von Vertrauenspersonen (V-Personen) im Strafprozessrecht. Die Arbeit analysiert die Rechtslage, die sich aus der Anwendung der Ermittlungsgeneralklauseln der §§ 161, 163 StPO i.V.m. Anlage D der RiStBV ergibt, und untersucht die Notwendigkeit einer expliziten Normierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht. Neben der juristischen Analyse wird der rechtspolitische Diskurs zu diesem Thema ausgewertet und kontextualisiert.
- Die rechtliche Einordnung von Vertrauenspersonen im Kontext vergleichbarer verdeckter personaler Ermittlungsmethoden.
- Die Analyse der verschiedenen Teilbereiche der einschlägigen Sicherheitsgesetzgebung (Gefahrenabwehrrecht, Recht der Nachrichtendienste, Strafprozessrecht) in Bezug auf die Regulierung des V-Personenwesens.
- Die Bewertung der bestehenden Rechtslage und die Argumente für eine Harmonisierung der entsprechenden Sicherheitsgesetzgebung.
- Die Untersuchung der rechtlichen und rechtspolitischen Anforderungen an eine Normierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht.
- Die Entwicklung eines Gesetzesentwurfs, der eine Kodifizierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht vorschlägt, um rechtsstaatlichen Anforderungen zu genügen und gleichzeitig den Einsatzwert von V-Personen nicht zu gefährden.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Relevanz des Einsatzes von Vertrauenspersonen im Strafprozessrecht dar. Kapitel B befasst sich mit den verschiedenen Arten verdeckter personaler Ermittlungsmethoden, die in der Strafverfolgung und im Bereich der Nachrichtendienste eingesetzt werden. Kapitel C analysiert die rechtlichen Grundlagen des Einsatzes von Vertrauenspersonen, insbesondere im Hinblick auf die Strafprozessordnung, das Gefahrenabwehrrecht und das Recht der Nachrichtendienste. Kapitel D untersucht die Rechtskonformität der bestehenden Ermächtigungsgrundlagen für Vertrauenspersonen im Strafprozessrecht und beleuchtet die relevante Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sowie den rechtspolitischen Diskurs zum Thema. Kapitel E entwickelt einen Gesetzesentwurf, der eine Kodifizierung des V-Personenwesens im Strafprozessrecht vorschlägt. Kapitel F erläutert den Gesetzesentwurf im Detail und Kapitel G fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit befasst sich mit den Themen Vertrauenspersonen, verdeckte Ermittlungsmethoden, Strafprozessrecht, Ermittlungsgeneralklauseln, §§ 161, 163 StPO, Anlage D der RiStBV, rechtsstaatliche Bestimmtheit, Eingriffsintensität, Datenschutz, Rechtspolitik, Sicherheitsgesetzgebung, Harmonisierung, Gesetzesentwurf, Kodifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer Vertrauensperson (V-Person) und einem verdeckten Ermittler?
V-Personen sind Privatpersonen, die dauerhaft mit Behörden zusammenarbeiten, während verdeckte Ermittler Polizeibeamte mit einer Legende (falsche Identität) sind.
Warum wird eine gesetzliche Regelung für V-Personen in der StPO gefordert?
Aktuell basiert ihr Einsatz nur auf allgemeinen Generalklauseln und Verwaltungsvorschriften. Eine explizite Normierung soll für mehr Rechtsstaatlichkeit, Bestimmtheit und parlamentarische Kontrolle sorgen.
Was ist ein „Agent Provocateur“?
Dies ist eine Person (oft eine V-Person), die eine andere Person zu einer Straftat provoziert oder anstiftet, was rechtlich höchst problematisch ist und zu Beweisverwertungsverboten führen kann.
Wie tief greift der Einsatz von V-Personen in Grundrechte ein?
Der Einsatz greift massiv in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Privatsphäre ein, da durch Täuschung ein Vertrauensverhältnis ausgenutzt wird.
Was regelt die Anlage D der RiStBV?
Die Anlage D der „Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren“ enthält behördeninterne Vorschriften über die Inanspruchnahme von V-Personen, hat aber keinen Gesetzesstatus.
- Arbeit zitieren
- Julian Müller (Autor:in), 2023, Erfordernis einer normativen Regelung von Vertrauenspersonen als verdeckte personale Ermittlungsmethode im Strafprozessrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1393630