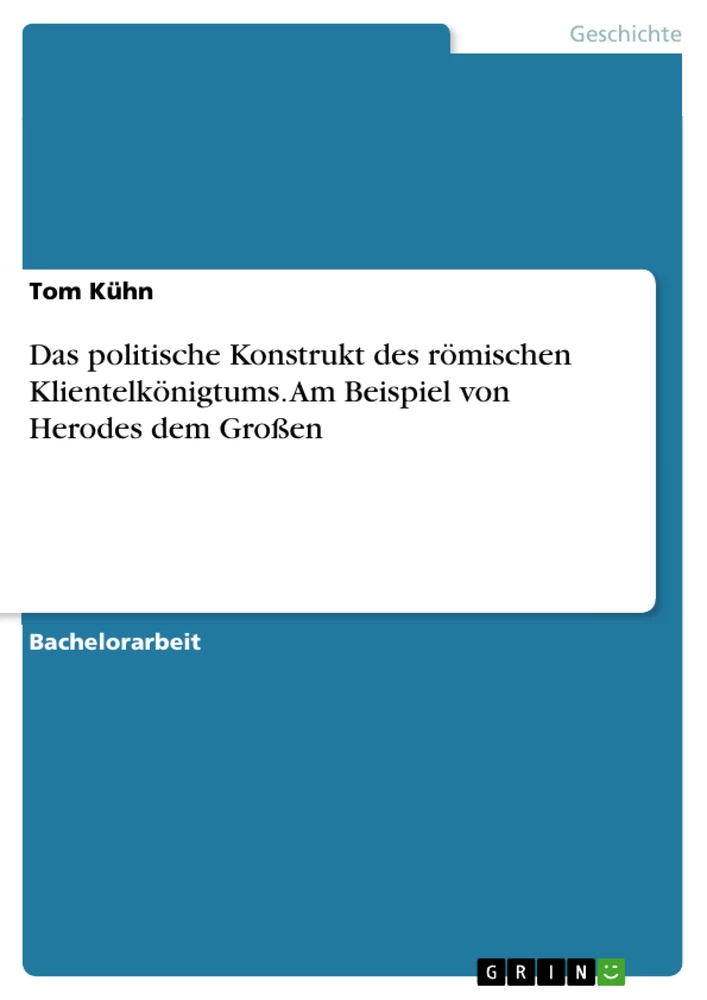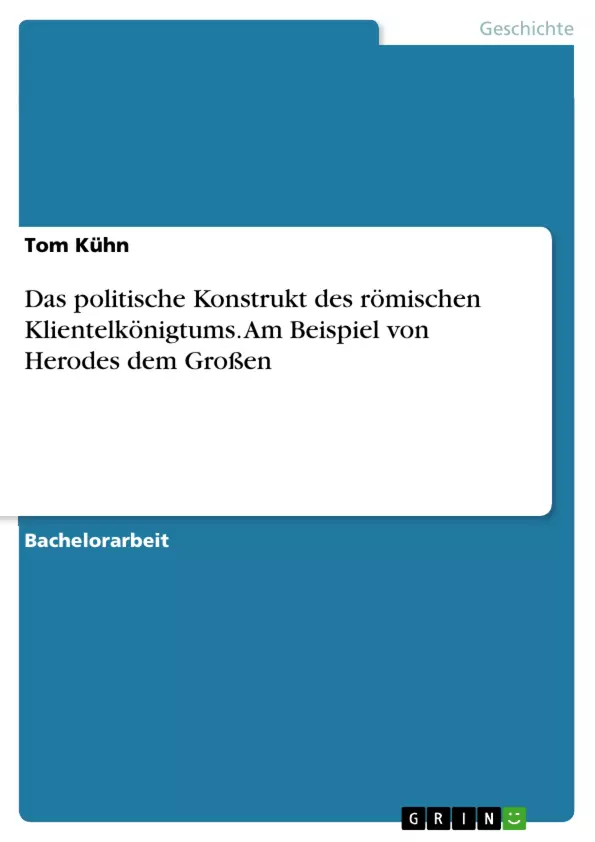In seiner Augustus-Vita berichtet der römische Schriftsteller Sueton über die sogenannten "befreundeten und verbündeten Könige" (reges amicii atque socii) des Römischen Reiches. Dabei zählt er einige wichtige Charakteristika auf, welche einen typischen befreundeten König ausmachen: den Bau sogenannter "urbes caesarea", die Tätigkeit als "euergetes", die Verehrung des Augustus und Reisen nach Rom. Sueton vergleicht die verbündeten Könige mit Klienten, indem er sich dem innerrömischen Klientelkonzept metaphorisch bedient.
Die moderne Forschung hat sich diese Metapher zu eigen gemacht, um das von Ungleichheit und Abhängigkeit geprägte Verhältnis zwischen den Klientelkönigen auf der einen und Rom auf der anderen Seite zu beschreiben. Zeitlich beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die späte Republik und das frühe Prinzipat, die Zeitspanne also, in die auch Herodes‘ Herrschaft fällt. In dieser von Umwälzungen und Unsicherheiten geprägten Periode befand sich das politische Konstrukt des Klientelkönigtums in einer Art Hochphase. Spätestens ab der Herrschaft der Flavierdynastie (69–96 n. Chr.) befand sich das Klientelkönigtum auf dem absteigenden Ast und verlor nach und nach seine Relevanz, indem direkte Herrschaft indirekte Herrschaftsformen ersetzte.
Geographisch beschränkt sich die Arbeit auf den Osten des Römischen Reiches, da das politische Konstrukt des römischen Klientelkönigtums hier seine Anwendung fand. Herodes‘ Reich lag im Spannungsfeld zwischen Hellenismus, Romanisierung und Judentum. Im Osten hatte man mit dem Partherreich eine Weltmacht als direkten Nachbarn. Knapp 40 Jahre lang regierte Herodes sein Reich zwar nicht geräuschlos, aber dafür umso effizienter. Was Herodes von anderen Klientelkönigen unterscheidet, ist die gute Quellenlage zu seiner Person und seiner Regentschaft. Dies ist in allererster Linie dem jüdisch-römischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der in seinen beiden Hauptwerken "Der Jüdische Krieg" und "Jüdische Altertümer" ausführlich über ihn berichtet. Die Klientelkönige sollen durchaus als eigenständig handelnde Herrscher, mit einem begrenzten Spielraum betrachtet werden. Diesen Spielraum galt es in sich wandelnden Zeiten und dem aufkommenden Prinzipat auszuloten, was einigen Klientelkönigen besser gelang als anderen, aber alle vor Herausforderungen stellte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff „Klientelkönigtum“
- 2.1 Der Begriff „Klientelkönigtum“ in der Forschung
- 2.2 Die Verwendung des Begriffs in dieser Arbeit
- 3. Das Klientelkönigtum des Ostens in der späten Republik und im frühen Prinzipat
- 3.1 Das Klientelkönigtum als Teil des Imperium Romanum
- 3.2 Die Entwicklung der Klientelkönige des Ostens im 1. Jahrhundert v. Chr.
- 3.2.1 Pompeius’ Neuordnung des Ostens
- 3.2.2 Die Klientelkönige unter Antonius
- 3.2.3 Die Klientelkönige unter Octavian/Augustus
- 3.3 Anerkennung durch Rom
- 3.4 Herrschaftsstrategien, Aufgaben und Funktionen der Klientelkönige
- 3.5 Die Vernetzung innerhalb der Klientelkönige
- 3.6 Zwischenfazit
- 4. Herodes der Große als römischer Klientelkönig
- 4.1 Herodes in der Forschung
- 4.2 Flavius Josephus als Chronist des Herodes
- 4.3 Aufstieg eines Idumäers
- 4.4 Anerkennung durch Rom: Herodes wird König
- 4.5 Bestätigung durch Octavian: Herodes bleibt König
- 4.6 Der dritte Mann im Imperium? Zur Machtfülle des Herodes
- 4.7 Herrschaftsstrategien: Herodes als hellenistischer Bauherr und jüdischer König
- 5. Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das politische Konstrukt des römischen Klientelkönigtums, insbesondere in der späten Republik und im frühen Prinzipat. Sie analysiert das Verhältnis zwischen Rom und seinen Klientenkönigen im Osten des Reiches und beleuchtet die Handlungsspielräume dieser Herrscher. Am Beispiel Herodes des Großen wird die Anwendung des Konzepts „Klientelkönigtum“ auf einen konkreten Fall untersucht.
- Terminologische Klärung des Begriffs „Klientelkönigtum“
- Entwicklung des Klientelkönigtums im Osten des römischen Reiches
- Anerkennung und Abhängigkeit der Klientelkönige von Rom
- Herrschaftsstrategien und -funktionen der Klientelkönige
- Herodes der Große als Fallbeispiel eines römischen Klientelkönigs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des römischen Klientelkönigtums ein, ausgehend von einer Passage aus Suetons Augustus-Vita, die die befreundeten und verbündeten Könige des römischen Reiches beschreibt und diese metaphorisch mit Klienten vergleicht. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: eine allgemeine Betrachtung des Klientelkönigtums (Kapitel 2 und 3), gefolgt von einer Fallstudie zu Herodes dem Großen (Kapitel 4).
2. Der Begriff „Klientelkönigtum“: Dieses Kapitel klärt den Begriff „Klientelkönigtum“ terminologisch. Es diskutiert die unterschiedliche Verwendung des Begriffs in der Forschung und definiert dessen Anwendung im Kontext dieser Arbeit. Das Ziel ist die Schaffung eines theoretischen Grundgerüsts für die folgende Analyse.
3. Das Klientelkönigtum des Ostens in der späten Republik und im frühen Prinzipat: Dieses Kapitel untersucht die Klientelkönige des Ostens vom späten 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins frühe Prinzipat. Es beschreibt die historische Entwicklung unter Pompeius, Antonius und Augustus, beleuchtet die Anerkennung durch Rom, die Herrschaftsstrategien und -funktionen der Klientelkönige sowie deren Vernetzung untereinander. Der Fokus liegt auf den politischen und Machtstrukturen, die dieses System prägten.
4. Herodes der Große als römischer Klientelkönig: Dieses Kapitel untersucht Herodes den Großen als Beispiel für einen römischen Klientelkönig. Es setzt sich mit der Herodes-Forschung und Flavius Josephus als Hauptquelle auseinander, analysiert chronologisch Herodes’ Aufstieg, seine Anerkennung als König und seine Bestätigung durch Octavian. Im Mittelpunkt steht die Analyse seiner Herrschaftsstrategien im Kontext seines Verhältnisses zu Rom.
Schlüsselwörter
Römisches Klientelkönigtum, Herodes der Große, Späte Republik, Frühes Prinzipat, Imperium Romanum, Klientenkönig, Abhängigkeit, Herrschaft, Machtstrukturen, Flavius Josephus, Hellenismus, Romanisierung, Judentum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Römisches Klientelkönigtum im Osten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das politische System des römischen Klientelkönigtums, insbesondere im Osten des römischen Reiches während der späten Republik und des frühen Prinzipats. Sie analysiert das Verhältnis zwischen Rom und seinen Klientenkönigen und beleuchtet deren Handlungsspielräume. Herodes der Große dient als Fallbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die terminologische Klärung des Begriffs „Klientelkönigtum“, die Entwicklung des Klientelkönigtums im Osten, die Anerkennung und Abhängigkeit der Klientenkönig von Rom, deren Herrschaftsstrategien und -funktionen sowie Herodes den Großen als Fallbeispiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung von „Klientelkönigtum“, ein Kapitel zum Klientelkönigtum im Osten der späten Republik und des frühen Prinzipats, ein Kapitel zu Herodes dem Großen als römischem Klientenkönig und ein abschließendes Fazit.
Wie wird der Begriff „Klientelkönigtum“ definiert?
Das zweite Kapitel klärt den Begriff „Klientelkönigtum“ terminologisch. Es diskutiert unterschiedliche Verwendung des Begriffs in der Forschung und definiert dessen Anwendung im Kontext dieser Arbeit, um ein theoretisches Fundament für die Analyse zu schaffen.
Welche Rolle spielt Herodes der Große in dieser Arbeit?
Herodes der Große dient als Fallstudie im vierten Kapitel. Die Analyse umfasst seine Forschung, Flavius Josephus als Quelle, seinen Aufstieg, seine Anerkennung als König durch Rom und seine Herrschaftsstrategien im Kontext seines Verhältnisses zu Rom.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Forschungsliteratur zum römischen Klientelkönigtum und verwendet Flavius Josephus als Hauptquelle für die Analyse Herodes des Großen.
Was sind die Kernaussagen der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Machtstrukturen und Abhängigkeiten zwischen Rom und seinen Klientenkönigen im Osten. Sie zeigt die Handlungsspielräume der Klientenkönig auf und analysiert am Beispiel Herodes des Großen die Anwendung des Konzepts „Klientelkönigtum“ in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römisches Klientelkönigtum, Herodes der Große, Späte Republik, Frühes Prinzipat, Imperium Romanum, Klientenkönig, Abhängigkeit, Herrschaft, Machtstrukturen, Flavius Josephus, Hellenismus, Romanisierung, Judentum.
- Arbeit zitieren
- Tom Kühn (Autor:in), 2022, Das politische Konstrukt des römischen Klientelkönigtums. Am Beispiel von Herodes dem Großen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1393697