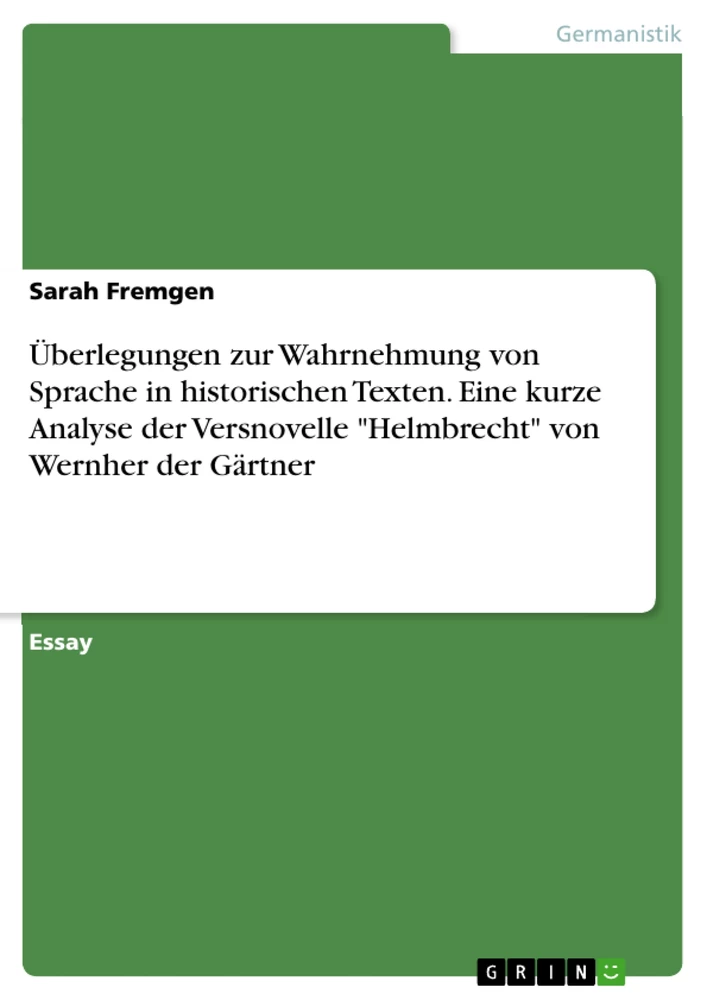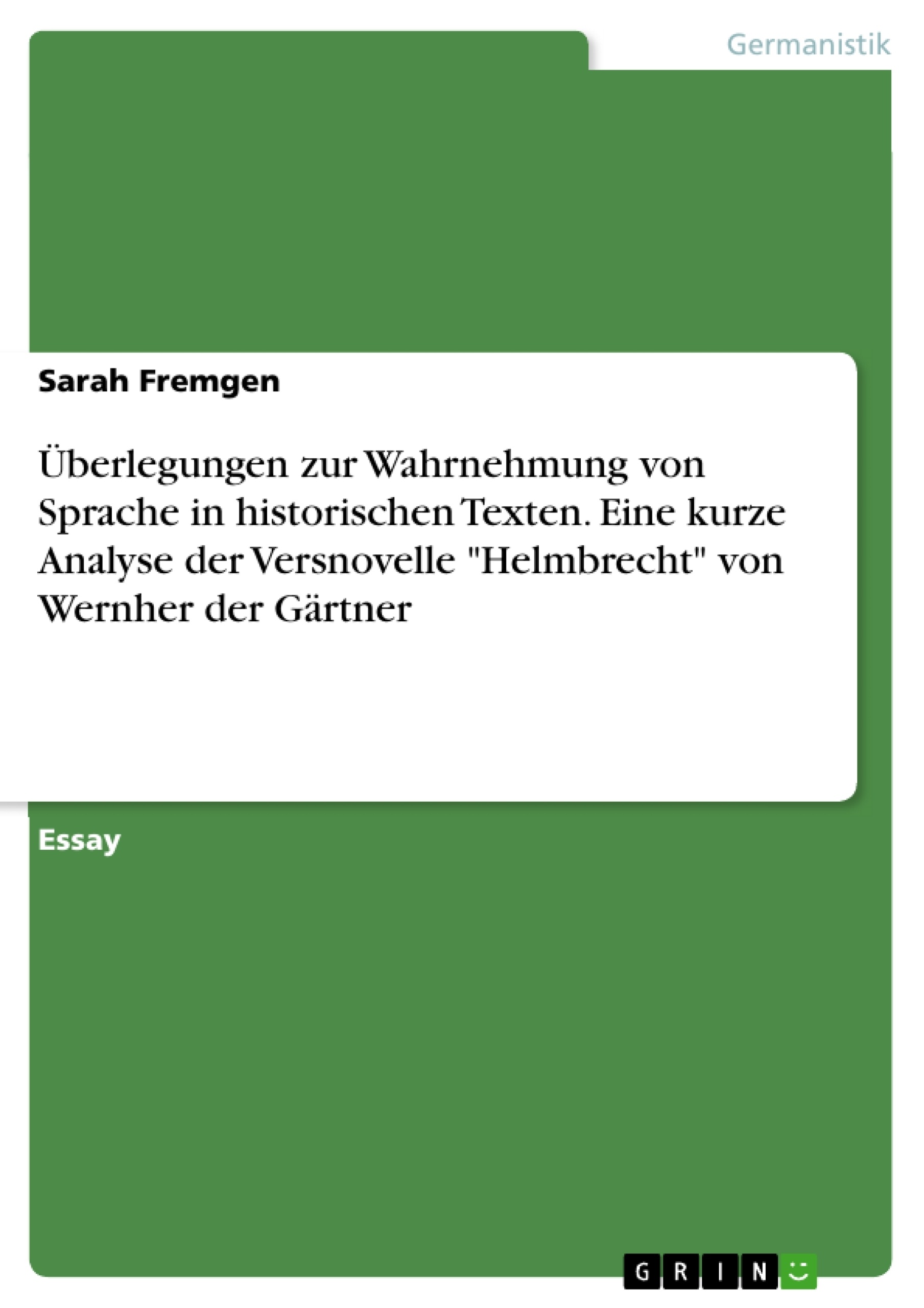Sprache ist das am häufigsten gebrauchte Mittel unserer Kommunikation; die Wichtigkeit von Sprache muss daher genauso wenig begründet werden wie die wissenschaftlichen Untersuchungen und Überlegungen zu ebendieser. Doch Sprache muss nicht immer eindeutig sein: Innerhalb der Kommunikation zweier Gesprächsteilnehmenden gibt es zwangsläufig einen Gesprächspartner, der spricht, während der andere das Gesprochene perzipiert. Dass Aussagen in diesen Kommunikationssituationen und damit die Sprache des Gegenübers anders oder sogar missverständlich wahrgenommen werden kann, ist ebenfalls keine neue Erkennt-nis, denn Missverständnisse in Gesprächen gehören zum Alltag eines jeden Sprechers oder (einer jeden) Sprecherin. Abseits von dieser linguistisch-pragmatischen Forschungsperspek-tive entwickelte sich im letzten Jahrzehnt jedoch eine weitere Perspektive, die sich auf die Wahrnehmung von Sprache aus der Sicht von linguistischen Laien, demnach auf die Sicht von Alltagssprecher:innen und nicht von Sprachwissenschaftler:innen, konzentriert. Damit rücken die Laiensprecher:innen in das Zentrum der Forschung dieser Disziplin, welche sich besonders auf die Wahrnehmung von Varietäten des Deutschen fokussiert. Obwohl diese perzeptionslinguistische Sichtweise noch relativ jung ist, gab es bereits im 14. Jahrhundert Belege für die Bewertung von Sprache innerhalb der Literatur; so zeigte Hugo von Trimberg im „Renner“ bereits Reflexionen über Varietäten des Deutschen. Es stellen sich also die Fragen, inwiefern Reflexion über Sprache bereits in mittelalterlicher Literatur zu finden ist, wie differenziert die kognitive Repräsentation von Sprache in Texten dieser Zeit dargestellt wird und wie die Wahrnehmung von Sprachvariation auf literarischer Ebene verarbeitet wird. Um diese Fragen zu beantworten, soll im Folgenden eine kurze, exemplarische Untersuchung einer Textstelle der im späten 13. Jahrhundert erschienenen Versnovelle "Helmbrecht" von Wernher der Gärtner erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Überlegungen zur Wahrnehmung von Sprache in historischen Texten – eine kurze Analyse des Helmbrechts
- Die Sprache des Ankömmlings
- Zweck der Sprachvariation
- Helmbrechts Sprachkenntnisse
- Die Reaktion der Familie auf Helmbrechts Sprache
- Die Sprachidentifikationskompetenz der Familie
- Sprache als Entscheidungskriterium
- Sprache als Erkennungsmerkmal
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse des Helmbrechts zielt darauf ab, die Wahrnehmung von Sprache in einem mittelalterlichen Text zu untersuchen und aufzuzeigen, wie sie als Mittel zur Charakterisierung, zur Konstruktion von Identität und zur Vermittlung sozialer und kultureller Hierarchien dient.
- Sprachvariation als Mittel der Charakterisierung
- Kognitive Repräsentation von Sprache im Mittelalter
- Sprache als Indikator für soziale und kulturelle Zugehörigkeit
- Die Rolle von Fremdsprachen in der Literatur
- Wahrnehmungsdialektologische Ansätze in der Literaturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
In den untersuchten Versen 697-838 des Helmbrechts kehrt der Protagonist, Helmbrecht, nach einjähriger Abwesenheit von seinen Raubritterzügen nach Hause zurück. Er begrüßt seine Familienmitglieder in verschiedenen Sprachen, darunter Latein, Französisch, Böhmisch und Flämisch/Niederdeutsch. Diese Sprachvariation führt zu Verwirrung und Missverständnissen innerhalb der Familie, die Helmbrechts Abstammung und Identität in Frage stellt.
Helmbrechts Sprachkenntnisse erweisen sich jedoch als fehlerhaft und die Familie ist nicht in der Lage, die meisten Sprachen zu verstehen. Die deutsche Sprache wird hingegen von der Familie differenzierter wahrgenommen und dient als wichtiges Kriterium für die Identifizierung des Ankömmlings. Trotz der Tatsache, dass Helmbrecht seinem Vater äußerlich sehr ähnlich sieht, wird er aufgrund seiner Sprachkenntnisse und seiner sozialen Prätention zunächst von der Familie abgelehnt.
Der Text demonstriert, dass Sprache im Mittelalter eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Identität, der Vermittlung von sozialen Hierarchien und der Abgrenzung von Gruppen spielt. Die Familie im Helmbrecht zeigt eine differenzierte Wahrnehmung von Sprache und ist in der Lage, bestimmte Sprachvarietäten geographisch zu verorten und mit bestimmten sozialen und kulturellen Gruppen zu assoziieren. Die Sprachvariation des Protagonisten dient ihm jedoch als Mittel, um sich von seiner Familie abzusetzen und als Mann von hohem Stand darzustellen.
Schlüsselwörter
Wahrnehmungsdialektologie, Sprachvariation, Identität, sozialer Stand, kulturelle Hierarchie, mittelalterliche Literatur, Helmbrecht, Fremdsprachen, kognitive Repräsentation, Sprachidentifikationskompetenz, Mittelhochdeutsch, Versnovelle.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Versnovelle "Helmbrecht"?
Der Bauernsohn Helmbrecht verlässt seinen Stand, um Raubritter zu werden. Bei seiner Rückkehr nach Hause versucht er, durch die Verwendung fremder Sprachen seine neue, vermeintlich höhere Identität zu demonstrieren.
Welche Sprachen verwendet Helmbrecht bei seiner Rückkehr?
Er grüßt seine Familie mit Brocken aus dem Lateinischen, Französischen, Böhmischen und Flämischen/Niederdeutschen, was bei seinen Eltern für Verwirrung sorgt.
Was zeigt der Text über die Sprachwahrnehmung im Mittelalter?
Der Text belegt, dass auch Laien im Mittelalter Sprachvariationen wahrnahmen und diese mit sozialen Hierarchien oder geographischer Herkunft verknüpften (Wahrnehmungsdialektologie).
Warum erkennt die Familie Helmbrecht zunächst nicht an?
Obwohl er seinem Vater ähnlich sieht, macht seine "fremde" Sprache ihn für die Familie unkenntlich. Erst als er wieder Deutsch spricht, wird er als Sohn akzeptiert.
Welche soziale Funktion hat Sprache im "Helmbrecht"?
Sprache dient als Distinktionsmerkmal. Helmbrecht nutzt sie zur sozialen Prätention, während die Eltern Sprache als Kriterium für Gruppenzugehörigkeit und Identität verwenden.
- Quote paper
- Sarah Fremgen (Author), 2023, Überlegungen zur Wahrnehmung von Sprache in historischen Texten. Eine kurze Analyse der Versnovelle "Helmbrecht" von Wernher der Gärtner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1394102