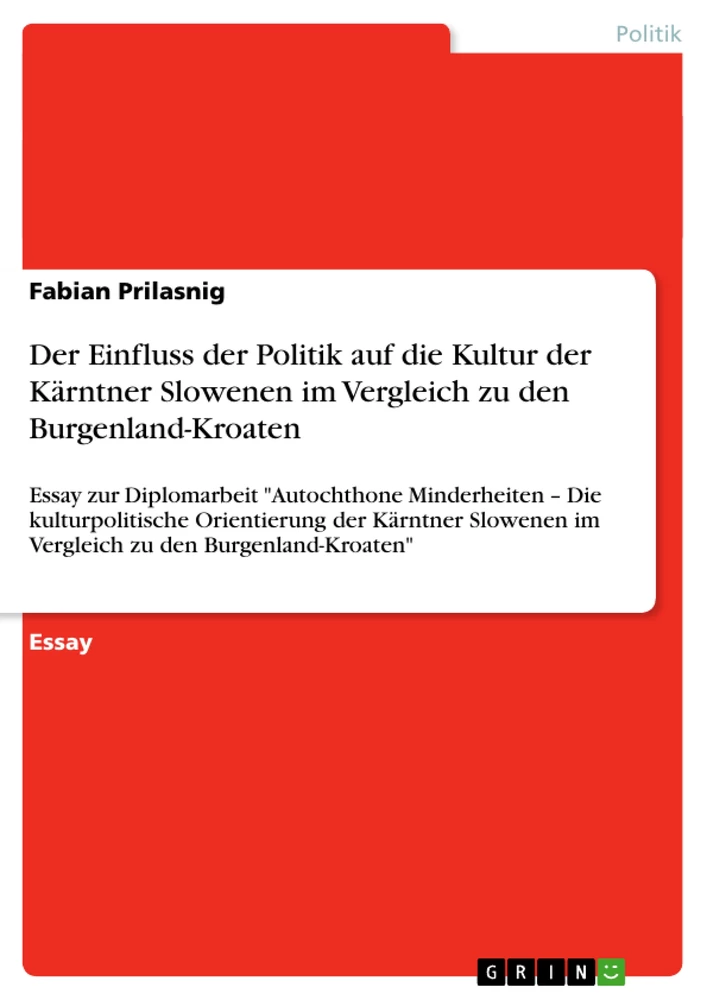Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die aktuelle kulturpolitische Situation im Burgenland im Vergleich zu jener in Kärnten entspannter ist. Die Politik übt keinen so starken Einfluss auf die Kultur und auf das Kulturschaffen aus wie jene in Kärnten, und die kulturelle Ausrichtung bzw. Orientierung der Burgenland-Kroaten zum Mutterland ist selbständiger und distanzierter als diejenige der Kärntner Slowenen.
Prilasnig Fabian Gottfried Klagenfurt/Celovec, Juni 2009
Der Einfluss der Politik auf die Kultur der Kärntner Slowenen im Vergleich zu den Burgenland-Kroaten Die kulturelle Ausrichtung der slowenischen Volksgruppe in Kärnten ist im Vergleich zur kroatischen Volksgruppe im Burgenland stärker von der Politik beeinflusst; hier sind Kultur, Politik und öffentliches Leben deutlicher verflochten. Die Gründe liegen in der Vergangenheit: Nach dem Zerfall der Monarchie Österreich-Ungarn kam es in Kärnten zu Grenzstreitigkeiten und zum sog.Abwehrkampfgegen militärische Einheiten des neugegründeten südslawischen SHS-Staates, der Südkärnten für sich beanspruchte. Die Volksabstimmung im Jahre 1920, bei der zum ersten Mal die Frage nach der politischen Orientierung der vorwiegend slowenisch sprachigen Bevölkerung Südkärntens gestellt wurde, führte zu einer kulturpolitischen Trennung zwischen der slowenischen und der deutschen Volksgruppe. Durch dieVerbindungvon Nationalität und Sprache(Begriff der Kulturnation) erhöhte sich der politische Druck auf die slowenische Volksgruppe in Kärnten, der eine starke Assimilierung bewirkte.
Der Nationalsozialismus bewirkte dann, dass die kulturpolitische Trennung vertieft und bis in die Gegenwart aufrecht erhalten worden ist. Im Gegensatz zum Burgenland, wo sich die kulturgeschichtliche Situation ganz anders gestaltet und der Deutschnationalismus daher nicht solche tiefen Wunden wie in Kärnten hinterlassen hat, entwickelte sich aufgrund dieser historischen Ereignisse in der Kärntner Bevölkerung die in der einschlägigen Literatur vielzitierte sog.Urangstvor dem Slowenischen bzw. Slawischen. DieseUrangstzeigte sich im Jahr 1972 im sog.Ortstafelsturm, bei dem zur Erfüllung des Artikels 7 des Staatsvertrages gerade aufgestellte zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten über Nacht von einem nicht gerade kleinen Teil der Bevölkerung gewaltsam entfernt wurden. Im Burgenland, das während der Zeit der Monarchie zum ungarischen Teil gehörte, war die heutige deutschsprachige Mehrheitsbevölkerung bis zum Jahr 1921 ebenfalls in der Situation einer Minderheit und erlebte gemeinsam mit den Burgenland-Kroaten den Assimilierungsdruck durch die ungarische Obrigkeit. Aus diesem Grund war dort nach dem Ersten Weltkrieg das Verständnis für die Bedürfnisse einer Minderheit ganz anders als in Kärnten, wo die territoriale Einheit des Landes immer die Kulturpolitik geprägt hat.
Das kulturelle Leben der kroatischen Volksgruppe wurde nicht so stark seitens der Politik beeinflusst, und es ist daher bis heute zu keiner Bildung einer eigenständigen kroatischen Partei gekommen, die bei einer politischen Wahl im Burgenland kandidiert hätte. In Kärnten bildete sich bald nach dem Zweiten Weltkrieg eine eigenständige slowenische Partei, dieEinheitsliste-Enotna Lista, die sich auf Gemeindeebene als eine fixe Größe etablierte und in zahlreichen Gemeinden Südkärntens mit eigenen Mandataren vertreten ist. Bei der letzten Gemeinderatswahl im März 2009 konnte sie zum ersten Mal sogar einen Bürgermeister stellen (Gemeinde Eisenkappel-Vellach/äelezna Kapla-Bela).
Ebenfalls zu beachten ist die unterschiedliche Siedlungssituation beider Volksgruppen. Während das Siedlungsgebiet der Kärntner Slowenen direkt an das slowenische Mutterland grenzt, sind die Burgenland-Kroaten weit entfernt vom kroatischen Mutterland im Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn inselartig angesiedelt. Dadurch ist der Kulturaustausch mit Kroatien nie so intensiv betrieben worden wie es in Kärnten mit Slowenien der Fall war, und es hat sich sogar eine eigene Schriftsprache, dasBurgenland-Kroatisch, als Zeichen einer gewissen, nicht nur geographischen, sondern auch kulturpolitischen Distanz zum Mutterland, herausgebildet. In der slowenischen Volksgruppe hingegen war schon immer, auch aufgrund der geographischen Lage, eine klare kulturpolitische Ausrichtung nach Laibach/Ljubljana erkennbar, und es stellte sich daher nicht die Frage nach einer kulturpolitischen Abgrenzung. Klagenfurt war sogar für ein bis zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts das kulturelle Zentrum des Slowenentums.
Wegen des starken deutschnationalen Elements in der politischen Landschaft Kärntens und des daher äußerst starken Germanisierungsdrucks, formierte sich bei den Kärntner Slowenen ein stärkerer politischer Wille zur Erhaltung des eigenen Volkstums bzw. Kultur als bei den Burgenland-Kroaten. Diese standen seitens der Landespolitik auch nie annähernd derart unter politischem Druck, auch wegen des Umstandes, dass im Burgenland noch zwei weitere autochthone Minderheiten leben, nämlich die Roma und die Ungarn.
Bei den Verhandlungen zum Artikel 7 des Staatsvertrages waren daher immer die Kärntner Slowenen und nicht die Burgenland-Kroaten im Mittelpunkt der Diskussionen. Ein passendes, aktuelles Beispiel ist die Umsetzung der jüngsten Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes bzgl. Topographieverordnung zum Volksgruppengesetz 1976, welche im Burgenland zu keinen derartigen politischen Spannungen führten wie in Kärnten, wo bis heute diese Erkenntnisse noch nicht exekutiert worden sind und die Gesetze des Rechtsstaates seitens der Politik nicht umgesetzt werden.
Der Artikel 7 des Staatsvertrages scheint in Kärnten vielmehr eine kulturpolitische Belastung anstatt eine kulturelle Bereicherung zu sein. Die historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts haben tiefe, nicht aufgearbeitete Spuren im kollektiven Gedächtnis der Kärntner Bevölkerung hinterlassen, sodass noch heutzutage, in Zeiten der europäischen Integration und Auflösung politischer Grenzen, die sog.
[...]
- Quote paper
- DI Mag Fabian Prilasnig (Author), 2009, Der Einfluss der Politik auf die Kultur der Kärntner Slowenen im Vergleich zu den Burgenland-Kroaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139453