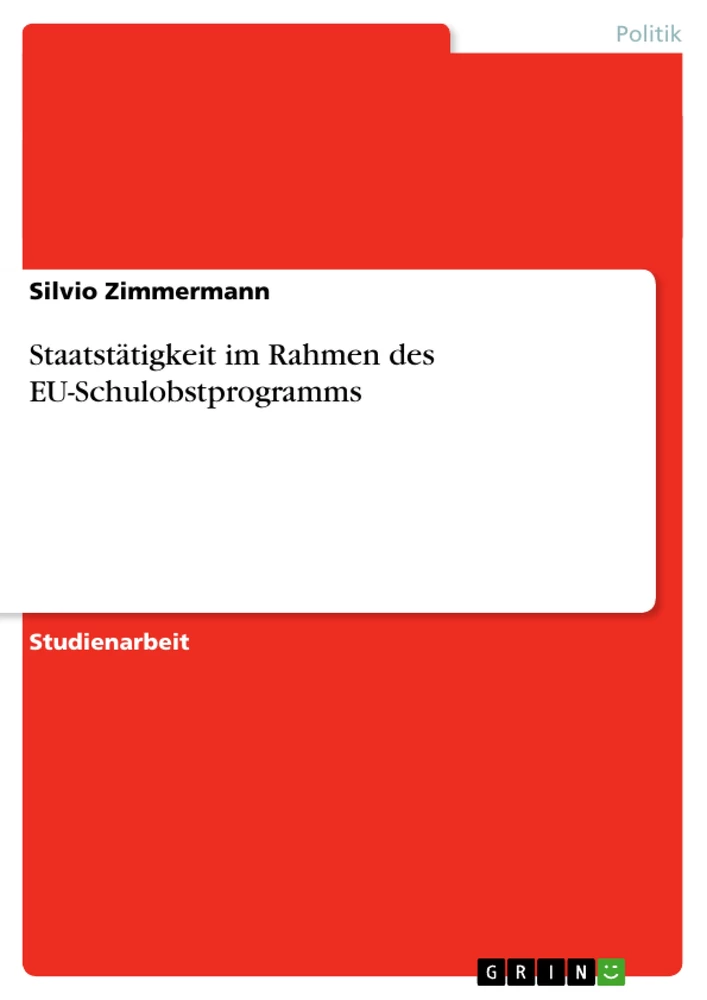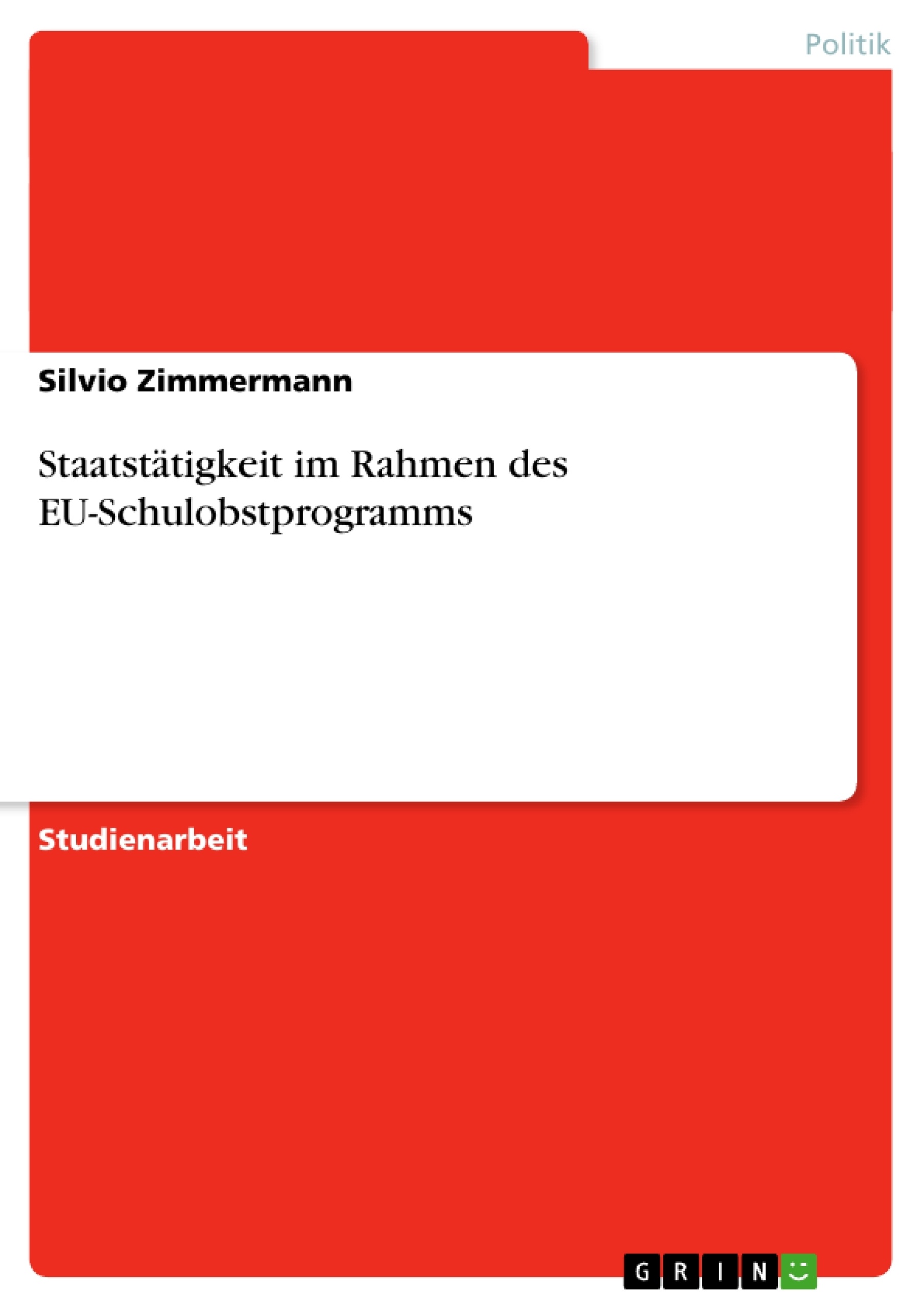Anlass der Arbeit ist das Nachzeichnen eines aktuellen Themas in der Politikformulierung – die europäische Initiative zur Einführung eines nationalen Schulobstprogramms. Im Blickpunkt steht der Begriff der Staatstätigkeit und die Konzeption von Mitteln, Aufgaben und Steuerungsanliegen.
Ich möchte zeigen, dass das Beispiel Schulobstprogramm keine Ausweitung von Staatstätigkeit, sondern die Korrektur falsch gewichteter Aufgabenentwicklungen ist.
Gliederung
1. Einleitung
2. Das EU-Schulobstprogramm
2.1 Wegpunkte des Programms
2.2 Einordnung
3. Zur ökonomischen Theorie der Staatsaufgaben
3.1 Welche Probleme treten auf?
3.2 Wie nimmt sich der Staat der Probleme an?
3.3 Ist das Schulobstprogramm eine neue Staatsaufgabe?
4. Zur Steuerungstheorie
5. Stichpunkt Europäisierung
6. Zusammenfassung
Verwendete Literatur
1. Einleitung
Anlass meiner Arbeit ist das Nachzeichnen eines aktuellen Themas in der Politikformulierung - die europäische Initiative zur Einführung eines nationalen Schulobstprogramms.1 Im Blickpunkt steht der Begriff der Staatstätigkeit und die Konzeption von Mitteln, Aufgaben und Steuerungsanliegen.
Ausgangspunkt ist die Feststellung von BENZ, "dass die Demokratisierung des mo- dernen Staates zu einem Wachstum von Staatsaufgaben beitrug, weil neue Gruppen ihre Ansprüche an den Staat geltend machten, insbesondere Gruppen, die am Markt benachteiligt waren".2 Die Indikatoren des Programms mögen diesen Befund bestä- tigen; beim zweiten Blick finden sich allerdings Aspekte, die über diese These hinaus gehen. Im Folgenden möchte ich daher zeigen, dass das Beispiel Schulobstprogramm keine Ausweitung von Staatstätigkeit, sondern die Korrektur falsch gewichteter Auf- gabenentwicklungen ist. Zusammenhängende externe Effekte in der Zielgruppe sind nun in den Vordergrund getreten und suchen Regulierung und Förderung durch den Staat, wodurch die Vermutung einer Ausweitung der Staatstätigkeit entsteht. Schließ- lich aber werden die Ansprüche und Forderungen der Gruppe benutzt, um Re-Orga- nisationen in anderen Politikfeldern zu begründen.
Zur Gliederung: Bevor ich in Kapitel 3 über die Definition der Gruppen, die benach- teiligt sind und das "Ziel der Regulierung von Produktion und Konsum zur Vermei- dung externer Effekte" 3 einen Bezug zur ökonomischen Theorie von Staatsaufgaben herstelle, werde ich im Folgenden einen kurzen Abriss der Entwicklung des Schul- obstprogramms geben. Kapitel 4 beleuchtet die akteurszentrierte Steuerungstheorie, da die Regelungen eine Struktur haben, "auf die sich Steuerungsaktivitäten richten bzw. von [der] Steuerung ausgeht".4 Abschnitt 5 ordnet eine Veränderung der "Staat- lichkeit" ein und Kapitel 6 gibt eine zusammenfassende Antwort auf meine Thesen. Wenn ich den Begriff der Staatstätigkeit verwende, beziehe ich mich auf eine Defini- tion von BENZ, die Staatstätigkeit mit konkreten Tätigkeitsfeldern bestimmt, die der Staat erfüllt.5 Das Schulobstprogramm der EU ist Bestandteil der (deutschen) Politik- felder Landwirtschaft, Bildung, Ernährung und Europa. Zur Aufgabe stehen die Ver- sorgung und Bildung von Verbrauchern und eine restrukturierte EU-Agrarpolitik.
2. Das EU-Schulobstprogramm
Die DGE entwickelte im Jahr 2007 6 im Auftrag des Bundesministeriums für Ernäh- rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und des BM für Gesundheit für rund 11 Millionen Kinder und Schüler in Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen 7 Qualitätsstandards für die tägliche Verpflegung. Ein Antrag der Bundestagsfraktion der Gr ü nen stellte ein Jahr später auf der Grundlage des Ernährungsberichts '08 dazu fest, dass im Rahmen empfohlener Lebensmittelmengen, noch "zu wenig pflanzliche Lebensmittel, insbesondere Gemüse, Obst, Brot, Kartoffeln und andere kohlenhy- dratreiche Beilagen […] verzehrt werden".8 Dieser Befund gleicht der Idee eines Ge- setzes zur Durchführung eines Schulobstprogramms aus der Feder des Bundesrates: 9
Mit der Verordnung (EG) Nr. 13/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005 über die Finan- zierung der gemeinsamen Agrarpolitik und (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein- heitliche GMO) zur Einführung eines Schulobstprogramms (ABl. L 5 vom 9.1.2009, S. 1) soll speziell dem geringen Obst- und Gemüseverzehr bei Kindern entgegengewirkt und der Obst- und Gemüseanteil in der Ernährung der Kinder nachhaltig erhöht werden.
In seinem Artikel für die Zeitschrift Das Parlament kommentiert HAUSDING später: "Da Europas Schüler offensichtlich immer dicker werden, sollen sie künftig […] kos- tenlos mit frischem Obst und Gemüse versorgt werden - alles im Interesse einer ge- sunden Ernährung".10 Wichtig ist, was HAUSDING nicht sagt: Eines der wichtigsten Ziele ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Marktorientierung des europäischen Obst- und Gemüsesektors zu fördern. Märkte sollen stabilisiert und die Versorgung sicher- gestellt werden. Erst mit der "Beteiligung der [Europäischen] Gemeinschaft im Rah- men eines Schulobstprogramms mit dem Ziel, Obst und Gemüse sowie Bananen an Schüler in Bildungseinrichtungen abzugeben, würde diesen Zielen entsprochen".11 Im Folgenden ein Blick auf die Entstehung des Programms.
2.1 Wegpunkte des Programms
Zur Bestimmung einzelner Wegpunkte bei der Einführung eines EU-Schulobstpro- gramms möchte ich den Policy-Cycle 12 anlegen. Beim aktuellen Stand der Gesetzge- bung sind allerdings noch nicht alle Phasen relevant; im Folgenden stehen (nur) die Problemdefinition, das Agenda-Setting und die Politikformulierung im Vordergrund. JANN und WEGRICH weisen darauf hin, dass für die Bearbeitung eines sozialen Pro- blems in einem ersten Schritt die Definition und Artikulierung der "Notwendigkeit eines steuernden Eingriffs öffentlicher Politik" notwendig ist.13 Diesen Schritt hat die Europäische Kommission im Dezember 2005 mit der Herausgabe des Gr ü nbuch - F ö rderung gesunder Ern ä hrung und k ö rperlicher Bewegung getan.14 Herauszufinden galt, welche Eingriffe bei welchen Bevölkerungsgruppen und auf welcher Ebene eine gesündere Ernährung in der EU fördern. Die Arbeit einer Europ ä ischen Aktionsplatt- form - EAP - resultierte 2007 schließlich in einer weiteren Analyse der Kommission: dem Weissbuch - Ern ä hrung, Ü bergewicht, Adipositas: Eine Strategie f ü r Europa.15 Die EAP möchte ich als Öffentlichkeit "innerhalb eines Zirkels von Interessengrup- pen und Experten" 16 bewerten. Nach Aussage der EU-Kommission beteiligten sich an ihr 32 Akteure "from food industry to consumer protection NGOs".17 Das zwei- jährige Agenda-Setting wechselte damit in die Phase der "Generierung von Alterna- tiven" 18; die Kommission gab dabei folgende Vorgaben: Initiiert werden sollten Al- ternativen für das Wissen, die Präferenzen und die Verhaltensweisen der Bürger; ver- besserte Verfügungsmöglichkeiten gesunder Lebensmittel; Konzentration auf wich- tige Lebensabschnitte bei der Förderung und die Förderung körperlicher Bewegung. Die EU-Kommission hat auf diese Weise ein "umfassendes Spektrum an Maßnah- men innerhalb ihrer Zuständigkeit dargelegt, die in den verschiedenen Politikberei- chen [der Mitgliedsstaaten] weiterzuführen sind".19
[...]
1 Kurz: kostenlose Abgabe von Obst und Gemüse an Kinder und Schüler.
2 Benz, Arthur 2004: Begriff und Wirklichkeit des modernen Staates. Hagen: Kurs 03223. S. 166
3 Ebd. S. 165
4 Ebd. S. 198
5 Vgl. ebd. S. 158
6 Vgl. DGE 2007: Qualitätsstandards für die Schulverpflegung. Info vom 03.09.2007
7 Schuljahr 2008/2009 – Vgl. Statistisches Bundesamt 2008: Kinder- und Jugendhilfe. Besuchsquote in Tageseinrichtungen am 15. März 2008, Kinder bis 6 Jahre – und: Statistisches Bundesamt 2009: 45,5% weniger Schülerinnen und Schüler in Ostdeutschland als 1992/93. Pressemitteilung Nr. 66 vom 26.02.2009
8 Bundestag 2009 c: Bundestag s-Drucksache 16/13476 vom 17.06.2009. Seite 1
9 Bundesrat 2009 a: Bundesrats-Drucksache 382/09 (B) vom 15.05.2009. Seite 1
10 Hausding, Götz 2009 a: Die Früchte des Staates. In: Das Parlament, Nr. 25 vom 15.06.2009
11 Europäische Kommission 2008 a: KOM(2008) 442, Seite 2
12 Vgl. Jann, Werner / Wegrich, Kai 2003: Phasenmodelle und Politikprozesse. In: Schubert / Bandelow (Hrsg.): Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München, Wien: Oldenbourg. S. 71 - 103
13 Ebd. Seite 83
14 Vgl. Europäische Kommission 2005: Grünbuch – Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung. KOM(2005) 637
15 Vgl. Europäische Kommission 2007 b: Weissbuch – Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für Europa. KOM(2007) 279
16 Jann, Werner / Wegrich, Kai 2003: Phasenmodelle und Politikprozesse. Seite 84
17 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm – Zugriff: 25.09.2009
18 Jann, Werner / Wegrich, Kai 2003: Phasenmodelle und Politikprozesse. Seite 85
19 Europäische Kommission 2007 a: Weissbuch. Seite 11
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des EU-Schulobstprogramms?
Das Programm soll den Obst- und Gemüseverzehr bei Kindern nachhaltig erhöhen und gleichzeitig die Marktorientierung des europäischen Agrarsektors fördern.
Ist das Schulobstprogramm eine neue Staatsaufgabe?
Die Arbeit argumentiert, dass es eher eine Korrektur falsch gewichteter Aufgaben und eine Reaktion auf externe Effekte (wie Übergewicht bei Kindern) ist.
Welche Rolle spielt der „Policy-Cycle“ in der Arbeit?
Der Policy-Cycle wird genutzt, um die Phasen der Problemdefinition, des Agenda-Settings und der Politikformulierung des Programms nachzuzeichnen.
Was ist das „Grünbuch“ der Europäischen Kommission?
Ein Dokument von 2005, das die Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung als notwendigen Eingriff öffentlicher Politik definierte.
Welche Politikfelder sind vom Schulobstprogramm betroffen?
Es berührt die Bereiche Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Ernährung und Europapolitik.
- Citar trabajo
- Silvio Zimmermann (Autor), 2009, Staatstätigkeit im Rahmen des EU-Schulobstprogramms, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139538