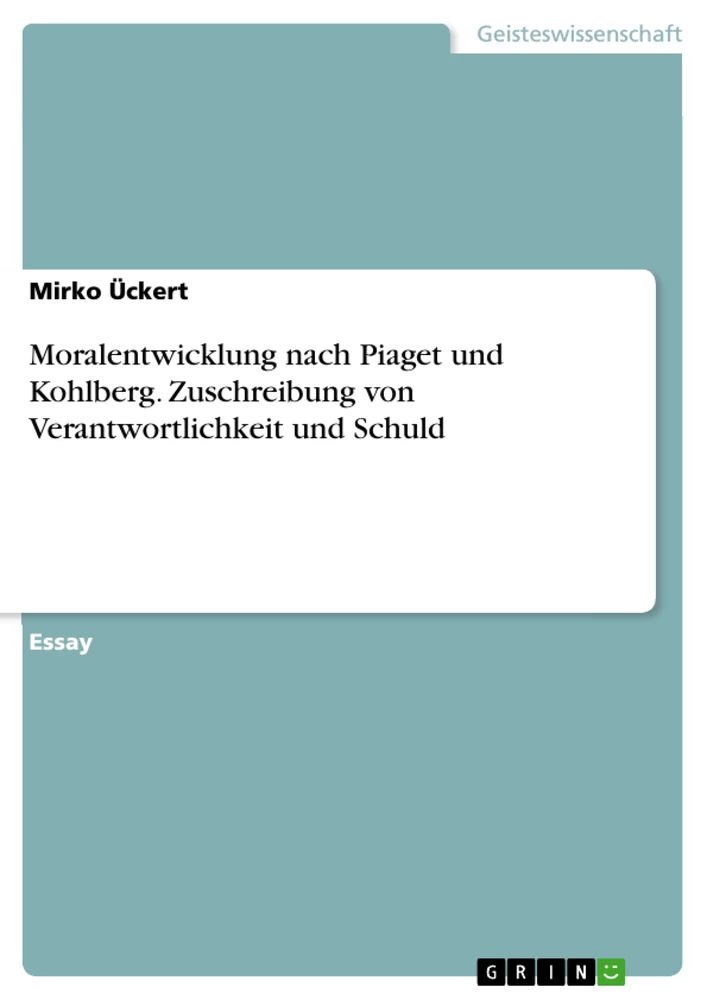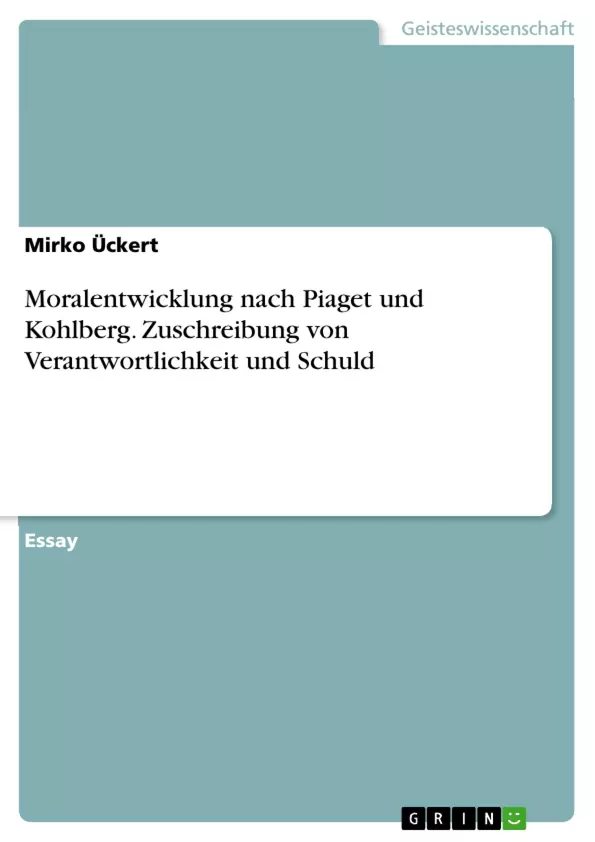Eines der wichtigsten Merkmale moderner demokratischer Staaten ist die Rechtsstaatlichkeit. Dieses Prinzip garantiert jeder natürlichen und juristischen Person einen Rahmen, in dem ihre Handlungen bzw. Nicht-Handlungen gesellschaftlich akzeptiert und institutionell gefördert werden. Dieser Rahmen konstituiert sich durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen, die die legislative Gewalt eines Staates entwickelt und schriftlich festhält.
Ziel dieses Vorgehens ist es unter anderem auch in der Bundesrepublik, durch ein demokratisch legitimiertes Verfahren einen für alle Personen gleichermaßen geltenden Katalog moralischer Normen aufzustellen und durchzusetzen. In der Konsequenz soll dadurch eine Gesellschaft entstehen, dessen Charakter sich durch eine gerechte Verteilung von Rechten und Pflichten, Vermögen und Bildung und Chancen und Risiken auszeichnet.
Dem folgend stellt sich die Frage danach, was Gerechtigkeit eigentlich ist, wie sie entsteht und wie das Individuum das Verständnis für dieses Konzept entwickelt und wie es damit umgeht. Diesen und anderen Fragen stellen sich unter anderem der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget und der US-amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg. Ihre Theorien über die Entwicklung von Moral sollen Gegenstand dieses Essays sein.
Essay III: Moralentwicklung nach Piaget und Kohlberg
Eines der wichtigsten Merkmale moderner demokratischer Staaten ist die Rechtstaatlichkeit. Dieses Prinzip garantiert jeder natürlichen und juristischen Person einen Rahmen, in dem ihre Handlungen bzw. Nicht-Handlungen gesellschaftlich akzeptiert und institutionell gefördert werden. Dieser Rahmen konstituiert sich durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen, die die legislative Gewalt eines Staates entwickelt und schriftlich festhält.
Ziel dieses Vorgehens ist es unter anderem auch in der Bundesrepublik, durch ein demokratisch legitimiertes Verfahren einen für alle Personen gleichermaßen geltenden Katalog moralischer Normen aufzustellen und durchzusetzen. In der Konsequenz soll dadurch eine Gesellschaft entstehen, dessen Charakter sich durch eine gerechte Verteilung von Rechten und Pflichten, Vermögen und Bildung und Chancen und Risiken auszeichnet.
Dem folgend stellt sich die Frage danach, was Gerechtigkeit eigentlich ist, wie sie entsteht und wie das Individuum das Verständnis für dieses Konzept entwickelt und wie es damit umgeht. Diesen und anderen Fragen stellen sich unter anderem der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget und der US-amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg. Ihre Theorien über die Entwicklung von Moral sollen Gegenstand dieses Essays sein.
Nach jeweils einer kurzen biographischen Übersicht zu der Person sollen die wichtigen Thesen und Kernaussagen des jeweiligen Modells bzw. der Forschungsergebnisse über die Moralentwicklung dargestellt werden. Darauf folgend soll die Frage näher beleuchtet werden, ob, und wenn, inwiefern verschiedene Einflussfaktoren auf Basis von unterschiedlicher kultureller Sozialisation Auswirkungen auf die Moralentwicklung bzw. auf ihre Teilbereiche haben.
1 Jean Piaget – Moralentwicklung
Der Schweizer Jean Piaget wurde am 09. August 1896 in Neuchâtel geboren und verstarb am 16. September 1980 in Genf. Er erwarb zunächst den Doktorgrad in Zoologie an der Universität Neuchâtel und studierte später Pädagogik und Kinderpsychologie an der Universität Zürich, bis er schließlich an das Jean-Jacques-Rousseau-Institut der Universität Genf berufen wurden, dessen Leiter er bis 1971 war. Jean Piaget ist einer der bedeutendsten Entwicklungspsychologen. Seinen Beitrag zu den Entwicklungstheorien und seine Ansätze über die Entwicklung und Funktion von Kognition und Identität sind noch heute von enormer Bedeutung für Forschung und Lehre.
Grundsätzlich unterteilt Piaget die moralische Entwicklung in zwei Stadien ein, in Heteronomie und Autonomie. Im Stadium der Heteronomie, was soviel wie Fremdbestimmtheit bedeutet, und welches vor allem in der Kindheit eine große Rolle spielt, werden Regeln als von unfehlbaren Autoritäten bestimmte Grenzen wahrgenommen, die es einzuhalten gilt. Sie sind nicht selbstbestimmt variierbar. Überschreitungen dieser Grenzen führen zu einer als legitim empfundenen Bestrafung durch die entsprechende Autorität und werden als logische Konsequenz für ein Fehlverhalten aufgefasst.1
Im Stadium der Autonomie werden Regeln weniger starr wahrgenommen. Sie gelten eher als soziale Übereinkünfte; sie weisen den Charakter eines sozialen Vertrages auf, zu dessen Einhaltung sich das Individuum verpflichtet, wenn es ihn eingeht. Aufgrund dessen liegt ihnen eine gewisse Variabilität zugrunde, was bedeutet, dass die vertraglich festgelegten Normen im gemeinsamen Konsens verändert werden können.
Die so fixierten Normen sollen die Aufrechterhaltung des sozialen Gefüges bzw. des Gerechtigkeitsempfindens sichern. Das Überschreiten dieser Gesetzmäßigkeiten wird als Verletzung des Vertrauens darin gesehen, dass das Gegenüber in Zukunft die Vertragspflichten einhält. Bestrafung ist in diesem Kontext ein Instrument mit zweierlei Zweck. Zum einen soll dem Delinquenten die Sinnhaftigkeit der Norm verdeutlicht werden. Andererseits soll ihm durch die Bestrafung auch eine Möglichkeit der Wiedergutmachung eingeräumt werden.2
1.1 Zuschreibung von Verantwortlichkeit und Schuld
Um moralisch handeln zu können, bedarf es eines Verständnisses dafür, was moralisches Handeln bedeutet und was eine moralische Handlung definiert. Dies wird unter dem Begriff der moralischen Norm zusammengefasst, welche als Richtlinie zur Bewertung eigenen und fremden Verhaltens dient. Im Zusammenhang damit werden nach Piaget bestimmte Emotionen hervorgerufen. Bei einer Normeinhaltung kann dies beispielsweise ein Gefühl der Befriedigung sein. Verstößt ein Individuum selbst gegen eine Norm und ist es sich dessen auch bewusst, so kann das zum Beispiel zu Schuldgefühlen führen. Bei der Bewertung eines fremden Normenverstoßes wären unter anderem Entrüstung oder Ärger eine mögliche Gefühlsregung.3
Zweierlei Voraussetzungen für moralisches Handeln im Zusammenhang mit der Zuweisung von Schuld und Verantwortlichkeit werden für Piagets Moralentwicklung aufgeführt. Zum einen umfasst dies das Vorhandensein von Handlungsalternativen. Einem Individuum muss es demnach möglich sein, in einer bestimmten Situation zwischen verschiedenen Optionen des Handelns, unter Abwägung u.a. moralischer Gewichtungen und dem Eigeninteresse, wählen zu können, wenn sich im Nachhinein die Frage nach der Verantwortlichkeit stellt.
Zweitens spielt es in diesem Kontext eine Rolle, ob das Individuum in seiner Entscheidung frei ist, oder ob es durch verschiede Einflussfaktoren in seiner Wahl eingeschränkt wird. Ein Normenverstoß wird in diesem Sinn weniger oder gar nicht schuldhaft angesehen, wenn der Akteur unter Androhung von Gewalt zu einer bestimmten Handlung genötigt wird. Dieses Prinzip der Unzurechnungsfähigkeit findet weiterhin vor allem in der praktischen Rechtsprechung Anwendung, wenn der Einzelne aufgrund von starken Affekten oder im Kontext vorübergehender oder dauerhafter Einschränkung der geistigen Kräfte nicht frei handeln kann, zum Beispiel aufgrund von Drogenkonsum, durch Geisteskrankheit oder einer Demenzerkrankung.4
1.2 Trends bei der Zuschreibung von Verantwortlichkeit und Schuld
Piaget leitete infolge zahlreicher empirischer Untersuchungen mit Kindern einige Trends in der Entwicklung von Moral ab. Zum einen, dass moralische Gefühle sehr stark von der wahrgenommenen Verantwortlichkeit des Individuums abhängen. Je weniger Selbstbestimmt in diesem Zusammenhang eine Schädigung anderer in Kauf genommen wird, desto weniger groß sind auch etwaige Gefühle wie Ärger, Empörung oder der Wunsch nach Bestrafung bei dem Geschädigten.5
Weiterhin beobachtete er die Tendenz, dass der Einzelne umso hilfsbereiter auftritt, je stärker er sich für einen verursachten Schaden in der Verantwortung fühlt. Umgekehrt erwies sich, dass Personen in Notlagen sich umso weniger der Hilfe anderer sicher sein konnten, je mehr sie für ihre Lage selbst in der Verantwortung standen. Das Empfinden und die Zuschreibung von Schuld und Verantwortlichkeit hat demnach eine große Auswirkung darauf, wie soziale Interaktion sich gestaltet, wenn ein Schade eingetreten ist oder abzuwenden gilt.6
Ein dritter Trend zeichnet sich nach Piaget ab, wenn der Fokus der Betrachtung auf die beiden Aspekte der Handlungsabsicht und des Handlungsausgangs betrachtet werden. Im Verlauf seiner Untersuchung wurde deutlich, dass Kinder dem Ausgang einer Handlung einen höheren Stellenwert beimessen, als die Absicht in der gehandelt wurde. Mit steigendem Alter jedoch ist eine stärkere Gewichtung hin zum Handlungsmotiv zu beobachten. Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung sind Menschen also eher gewillt, die gute Intention eines Handelnden zu honorieren, wobei das eigentliche Ergebnis der Bemühungen immer mehr in den Hintergrund rückt. Völlig vernachlässigt wird der Handlungsausgang jedoch nicht.
2 Kohlberg - Stufenmodell der Moralentwicklung
Lawrence Kohlberg wurde am 25. Oktober 1927 in New York geboren und schied am 17. Januar 1987 nach langer Krankheit aus dem Leben. Er war promovierter Psychologe mit seiner Dissertation über „Die moralische Entwicklung des Menschen“ und war lange Zeit Professor für Erziehungswissenschaft an der Harvard University. Im Gegensatz zu Jean Piaget sah er die moralische Entwicklung als lebenslangen Prozess an.
Er versuchte im Rahmen seiner Forschung die Moralentwicklung anhand verschiedener Ebenen und Stufen kategorisierbar zu machen. Dazu konfrontierte er Personen verschiedener Altersgruppen mit moralischen Dilemmata und ließ sie aus einem Katalog von Handlungsalternativen die ihnen moralische richtig erscheinende auswählen. Die favorisierten Optionen ordnete er bestimmten Ebenen und Abstufungen seines Modells zu. Diese Ebenen sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
[...]
1 Oerter, Ralf/Leo Montada (6. vollst. überarb. Aufl., 2008): Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz. S.587
2 Ebenda
3 Ebd. S. 589
4 Ebenda
5 Ebd. S. 590
6 Ebd. S. 591
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zwei Stadien der Moralentwicklung nach Piaget?
Piaget unterscheidet zwischen Heteronomie (Fremdbestimmtheit durch Autoritäten) und Autonomie (Regeln als veränderbare soziale Übereinkünfte).
Wie definiert Lawrence Kohlberg die Moralentwicklung?
Im Gegensatz zu Piaget sah Kohlberg die Moralentwicklung als lebenslangen Prozess an, den er in verschiedene Ebenen und Stufen unterteilte, basierend auf Reaktionen auf moralische Dilemmata.
Welche Rolle spielt die Handlungsabsicht bei der Schuldzuweisung?
Laut Piaget gewichten Kinder zunächst den Ausgang einer Handlung höher. Mit steigendem Alter verschiebt sich der Fokus hin zum Handlungsmotiv (der guten Absicht).
Was versteht man unter "Zuschreibung von Verantwortlichkeit"?
Es geht darum, ob ein Individuum für eine Handlung verantwortlich gemacht werden kann. Voraussetzungen dafür sind das Vorhandensein von Handlungsalternativen und die Freiheit der Entscheidung.
Welchen Einfluss hat die Sozialisation auf die Moral?
Die Arbeit untersucht, inwiefern unterschiedliche kulturelle Einflüsse und soziale Umgebungen die Entwicklung des Gerechtigkeitsempfindens und moralischer Normen prägen.
Warum ist Moralentwicklung für den Rechtsstaat wichtig?
Ein demokratischer Rechtsstaat basiert auf moralischen Normen und einer gerechten Verteilung von Rechten. Das Verständnis dafür, wie Individuen Gerechtigkeit erlernen, ist essenziell für das gesellschaftliche Zusammenleben.
- Citation du texte
- Mirko Ückert (Auteur), 2009, Moralentwicklung nach Piaget und Kohlberg. Zuschreibung von Verantwortlichkeit und Schuld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139615