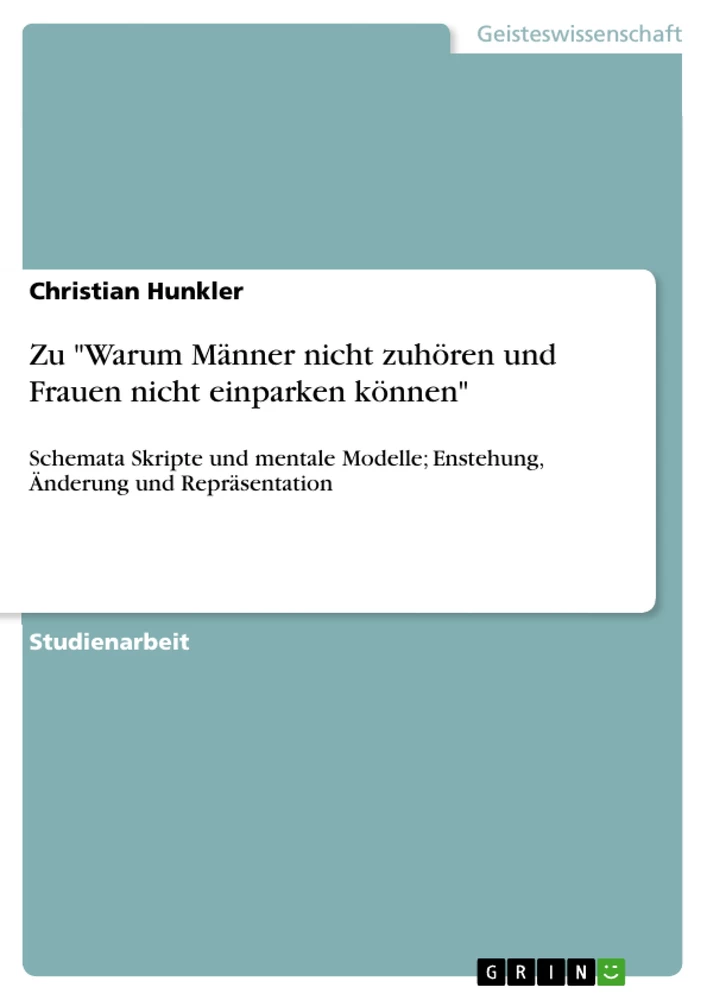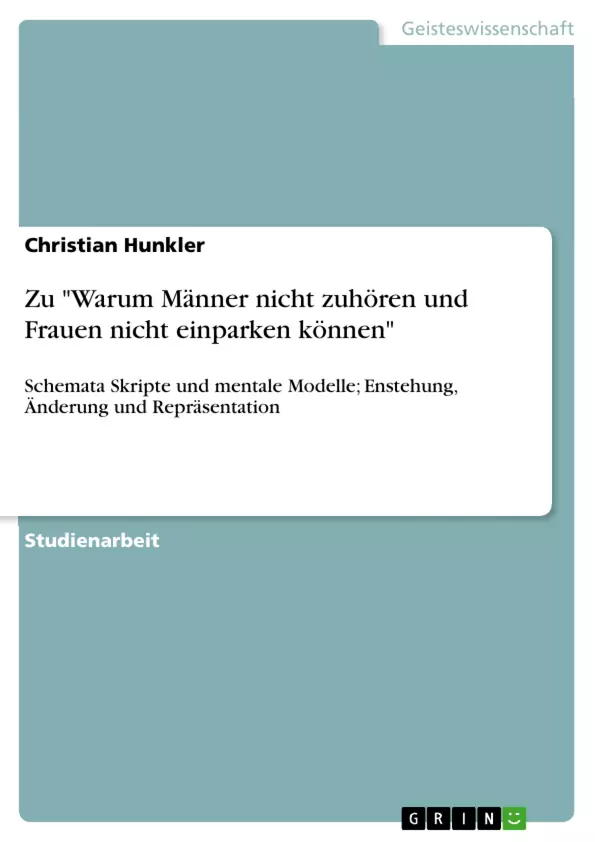Auch in der Soziologie werden ähnliche Konzepte, teilweise unter anderen Namen, beschrieben. Der „Cement of Society“ (ESSER 2000: 209), die „Strukturen der Lebenswelt“ bei SCHÜTZ, die „Alltagshandeln“ erst möglich machen (nach ESSER 1991: 93f.; 1993: 13; 2000: 206) oder GOFFMANS „Interaction Rituals“, welche die „... countless patterns and natural sequences of behavior ...“ (GOFFMAN 1967: 2) beschreiben, können im Kern auf Schemata oder schematische Wissensbestände bzw. Verarbeitung zurückgeführt werden. Je nach Fachrichtung und Autor werden ganz unterschiedliche Bezeichnungen herangezogen, die teilweise sinnvolle Unterscheidungen repräsentieren, teilweise aber fast exakt das gleiche Konzept formulieren. Auch wenn diese Arbeit keinen Vergleich zwischen verschiedenen „Arten“ von Schemata beinhalten soll, muss dennoch der Gegenstand beschrieben und sinnvoll definiert werden – dies geschieht in 2 Begriffklärung.
Das eigentliche Ziel der Arbeit ist es, die klassischen und neueren Modellvorstellungen und Theorien zur Entstehung von Schemata und ihrer Veränderung gegenüberzustellen (siehe Abschnitt 3 Entstehung und 4 Veränderung). Normalerweise wird davon ausgegangen, dass Schemata „ ... resistent gegenüber Veränderungen seien ...“ (SCHWARZ 1985: 284) und „ ... im Laufe konkreter Erfahrungen ... “ (EBENDA: 285) gelernt werden. Natürlich gibt es aber auch Evidenz dafür, dass Schemata sich ändern. Ebenso gibt es Hinweise auf bereits angeborene schematische Wissensbestände und das Erlernen von Schemata wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Im Endeffekt läuft die Frage nach Entstehung und Veränderung darauf hinaus, wie schematische Wissensbestände im Gehirn repräsentiert werden. Auch hier existieren kontroverse Sichtweisen. Ihnen widmet sich Abschnitt 5 Repräsentation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Eigenschaften von Schemata
- ,,Begriffslandkarte"
- Entstehung von Schemata
- Lerntheoretische Modelle?
- Basis für Schemata oder „Was wird gelernt“
- Abstraktionstheorie vs. Exemplartheorie
- Angeboren?
- Biologischer Determinismus
- Biologische Dominanz
- Änderung von Schemata
- Assimilation, Akkommodation & Kontrast
- Buchhaltermodell / Bekehrungsmodell / Substitutionsmodell
- Empirische Evidenz der „Klassiker“
- Assimilations- und Kontrasteffekte im Inklusions-Exklusions-Model
- Repräsentation
- Das Gehirn - wie und wo werden Schemata gespeichert
- Neokortisches vs. Hippokampales System – Macrae & Bodenhausen
- emotionales vs. rationales System - Massey
- Klassische Annahmen über die Repräsentation von Wissen im Gedächtnis
- Das Mode-Modell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Veränderung von Schemata, einer zentralen Form kognitiver Wissensverarbeitung, die stark die Wahrnehmung und das Handeln von Menschen beeinflusst. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse von klassischen und modernen Modellvorstellungen und Theorien, die die Entstehung und Veränderung von Schemata erklären.
- Die Definition und Eigenschaften von Schemata
- Die Entstehung von Schemata durch Lernen und biologische Faktoren
- Die Mechanismen der Veränderung von Schemata, wie Assimilation, Akkommodation und Kontrast
- Die Repräsentation von Schemata im Gehirn und die damit verbundenen Kontroversen
- Die Verbindung zwischen Schematheorie und sozialem Handeln im sogenannten „Mode-Modell“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Begriffsklärung, die die zentralen Eigenschaften von Schemata definiert und verschiedene Konzepte und Bezeichnungen, die in verschiedenen Disziplinen für Schemata verwendet werden, zusammenfasst. Im weiteren Verlauf werden die Entstehung von Schemata aus lerntheoretischer und biologischer Perspektive untersucht. Dabei werden verschiedene Modelle und Theorien, wie die Abstraktionstheorie und die Exemplartheorie, sowie die Debatte um angeborene schematische Wissensbestände beleuchtet. Das vierte Kapitel behandelt die Frage nach der Änderung von Schemata, wobei unterschiedliche Mechanismen wie Assimilation, Akkommodation und Kontrast sowie empirische Evidenz zur Veränderung von Schemata diskutiert werden. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Repräsentation von Schemata im Gehirn und geht dabei auf verschiedene Theorien und Modelle, wie das neokortische und hippocampale System sowie emotionale und rationale Verarbeitung, ein.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beleuchtet das zentrale Konzept von Schemata als kognitive Strukturen, die die Informationsverarbeitung und das Handeln von Menschen beeinflussen. Dabei stehen insbesondere die Entstehung und Veränderung von Schemata durch Lernen und biologische Faktoren, die Mechanismen der Änderung und die Repräsentation im Gehirn im Fokus.
Häufig gestellte Fragen
Was sind kognitive Schemata?
Schemata sind Wissensstrukturen im Gehirn, die Informationen organisieren und uns helfen, die Welt effizient wahrzunehmen und in Alltagssituationen schnell zu handeln.
Sind Schemata angeboren oder werden sie gelernt?
Die Arbeit diskutiert beide Ansichten: Es gibt Hinweise auf bereits angeborene schematische Wissensbestände (biologische Dominanz) sowie lerntheoretische Modelle zur Entstehung durch Erfahrung.
Was ist der Unterschied zwischen Assimilation und Akkommodation?
Bei der Assimilation werden neue Informationen in bestehende Schemata eingefügt. Bei der Akkommodation muss das Schema selbst verändert werden, um neuen, widersprüchlichen Erfahrungen gerecht zu werden.
Warum sind Schemata oft resistent gegenüber Veränderungen?
Schemata dienen der Stabilität unserer Wahrnehmung. Wir neigen dazu, Informationen so zu filtern oder umzudeuten, dass sie in unser bestehendes Weltbild passen (Assimilations-Effekt).
Wo werden Schemata im Gehirn repräsentiert?
Es existieren verschiedene Theorien, die zwischen neokortikalen Systemen (langfristige Speicherung) und hippokampalen Systemen oder emotionalen vs. rationalen Verarbeitungssystemen unterscheiden.
- Quote paper
- Christian Hunkler (Author), 2002, Zu "Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13966